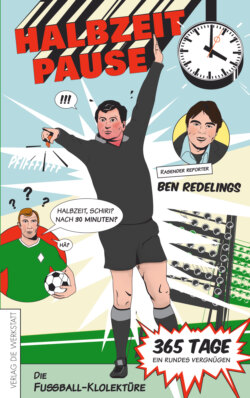Читать книгу Halbzeitpause - Ben Redelings - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEin Fußaller namens Paul Gascoigne
»George Best ohne Hirn.« Stan Seymour, Präsident von Newcastle, 1988
»Es heißt, er komme mit der Presse nicht zurecht, sei arrogant und außerdem ein Säufer. Wenn Sie mich fragen: Er hat alles, was man braucht.« George Best, 1988
»Ein Renaissance-Mensch aus der Tyneside. Jemand, der gleichzeitig furchterregend und albern sein kann.« Jimmy Greaves, Vorgänger von Gascoigne bei Tottenham und im englischen Team, 1996
»Gascoigne mit Pelé zu vergleichen ist so, als würde man den Entertainer Rolf Harris mit Rembrandt vergleichen.« Rodney Marsh, ehemaliger Stürmer der englischen Nationalmannschaft, 1990
»Gazza erinnert mich an Marilyn Monroe. Sie war zwar nicht die größte Schauspielerin der Welt, aber sie war ein Star, und man wartete gern, wenn sie zu spät kam, hehe.« Michael Caine, 1998
»Sie müssen entschuldigen. Er verfügt nur über einen äußerst begrenzten Wortschatz.« Lawrie McMenemy, Co-Trainer der englischen Nationalmannschat nach Gascoignes »Fuck off, Norway« gegenüber dem norwegischen Fernsehen, 1992
»Er ist ein phantastischer Spieler, wenn er nicht betrunken ist.« Brian Laudrup, Mitspieler bei den Rangers, 1997
»Das soll jetzt nicht unhöflich klingen, aber ich glaube, dass ihm Gott, als er ihn mit diesem enormen fußballerischen Talent bedachte, als Ausgleich dafür gleichzeitig sein Gehirn rausgenommen hat.« Tony Banks, Sportminister, in BBC Radio 5 Live, 1997
»Wenn man Zeitung liest, könnte man meinen, Paul und ich hätten ein Vater-Sohn-Verhältnis. Nun, ich hab zwei Söhne, und ich habe nie das Verlangen gehabt, sie zu schlagen, aber Gascoigne hätte ich das ein oder andere Mal gerne windelweich geprügelt.« Walter Smith, Gascoignes Trainer bei Everton und bei den Rangers, 2000
»Zu seiner Zeit war Gazza einfach phänomenal, der beste Spieler, den ich in diesem Land je gesehen habe. Beckham ist ein großer Fußballer, aber er kann ihm nicht mal die Schnürsenkel binden.« Paul Merson, 1999
Aus: Paul Gascoigne. Gazza. Mein verrücktes Leben, Bombus, München, 2005
Campino über Fußball: Homburg? Ein alberner Verein!
Der Frontmann der Düsseldorfer Band »Die Toten Hosen«, Campino, hat aus seinem Fan-Herzen noch nie eine Mördergrube gemacht. So bekennt er sich bei großen Turnieren öffentlich zur englischen Nationalmannschaft und lässt damit manch deutschen Patrioten zweimal kräftig schlucken. Und aufgrund seiner biografischen Wurzeln teilt er sich seine Liebe zur Fortuna aus Düsseldorf und dem Liverpooler FC zu gleichen Teilen auf. Dass er »nie zum FC Bayern München« gehen würde, hat er zusammen mit seinen Bandkollegen Mitte der Neunziger eindrucksvoll auf Platte gebannt und bereits Jahre vorher in einem Interview ohne Umschweife auf den Punkt gebracht: »Der FC Bayern? Von denen halte ich das Gleiche wie von München: Die ganze Stadt ist Schrott!«
Auch zu anderen Klubs hat Campino zumeist eine klare und schnörkellose Meinung. Als Ende der Achtziger eine Truppe aus dem Saarland kurzfristig für Furore sorgte, meinte Campino nur kurz und knapp: »Homburg? Ein alberner Verein!«
Und weil sich zu dieser Zeit auch die beiden Werksklubs aus Leverkusen und Uerdingen anschickten, den deutschen Fußball mit viel Geld im Rücken zu erobern, hatte der gebürtige Düsseldorfer auch hierfür nur Verachtung übrig: »Die Chemie-Heinis, die sollen doch turnen gehen!« Eine Meinung, die Campino im Jahre 2009 kurzfristig zurückstellen musste, weil sein Freund und ehemaliger Liverpool-Spieler Sami Hyypiä für die Bayer-Elf auflief: »Ich muss mich darauf vorbereiten, Sympathien für Bayer Leverkusen aufzubringen. Das ist als Düsseldorfer normalerweise nicht wirklich möglich, aber da geht bei mir dann die Freundschaft vor.«
Auch mit den Bayern hat er mittlerweile seinen Frieden gefunden: »Man kann mit Bayern München nur ordentlich als Feind umgehen, wenn man unsachlich bleibt. Sobald man sich an Fakten hält, wird es schwierig.«
Doch Bayern-Fan soll sein eigener Sohn im besten Falle dennoch nicht werden. Und um das zu verhindern, hat sich Campino bereits einen schlauen wie amüsanten Plan ausgedacht: »Ich werde ihm eine DVD von einem großen Liverpooler Sieg zeigen, aber nicht sagen, dass das Spiel schon stattgefunden hat, sondern so tun, als wäre es eine Live-Übertragung. Wir werden uns gemeinsam freuen und ich hoffe, damit ist der Virus platziert.«
Aber wahrscheinlich ist das überhaupt nicht mehr nötig, wie eine andere Geschichte beweist. Als der Kleine nämlich einmal auf der Straße von einem Bekannten gefragt wurde, wohin man denn unterwegs sei, sagte die Mutter: »Wir gehen zur Oma, Klöße essen. Lenny ist nämlich ein Klöße-Fan.« Woraufhin der Kleine den Kopf schüttelte und meinte: »Nein, ich bin doch Liverpool-Fan.«
Frisuren-Raten: Helden der Bundesliga
Männer, Frauen und Fußball
Die romantischen Treffen des Berti Vogts mit seiner Frau Monika, erzählt vom ehemaligen Bundestrainer höchstpersönlich: »Nach dem Spiel Deutschland gegen Polen bei der WM 1974 saßen wir am Flughafen. Ich war unansprechbar, hatte Schmerzen in der Leiste. Da kam eine nette blonde Stewardess: ›Herr Vogts, essen Sie doch eine Kleinigkeit.‹ Ich antwortete recht grob: ›Ich möchte meine Ruhe haben.‹ Und – aß dennoch ein wenig. Wir tauschten die Telefonnummern aus. Ein paar Wochen später trafen wir uns. Es war ein vernünftiges Treffen. Bei der EM 1996 wollte ich mit Monika unseren Hochzeitstag feiern – ganz allein. Im besten italienischen Lokal von Manchester. Wir kommen rein, und was sehen wir? Zehn unserer Spieler sitzen im Lokal. Es war trotzdem sehr schön.«
David Beckham, der Mann, der von sich selbst sagt, dass es herrlich sei, mit Victoria verheiratet zu sein, weil er all ihre Cremes benutzen könne, und der angeblich durch die Wohnung läuft und stolz ruft: »Ich bin eine Schwulen-Ikone, ich bin eine Schwulen-Ikone«, hat einmal über unseren ehemaligen Teamchef etwas sehr Nettes geäußert: »Ihr habt Franz Beckenbauer, der wird nie vom Thron gestoßen. Der könnte schwul sein und bliebe doch der Kaiser.«
Im Frühjahr 2010 nannte WDR-Moderator Frank Plasberg seine »Hart aber fair«-Sendung über das bestgehütete Geheimnis des Fußballs »Elf Freunde sollt ihr sein – Aber bitte ohne Anfassen«. Und der »letzte auf zwei Beinen stehende Macho«, Claude-Oliver Rudolph, war sich seiner Sache sehr sicher. Schwule könne es im Fußball nicht geben, sagte er und argumentierte hoch wissenschaftlich: »Für den Sport fehlt ihnen der Killerinstinkt. Als Bundesligaprofi erwarte ich ein testosteronwandelndes Monster, aber bei Schwulen gibt es eine biochemische Verschiebung.« Das Publikum staunte andächtig.
Wahrscheinlich wäre es komplett in eine Art Schockstarre gefallen, wenn auch noch Rudi Assauer live vor Ort gewesen wäre. Denn der hatte kurz zuvor in einem Zeitungsinterview erzählt, dass er in seiner aktiven Zeit »nie« einen schwulen Fußballer kennengelernt habe. Assauer hatte in diesem Zusammenhang jedoch auch noch eine andere delikate Geschichte parat: »Als ich noch in Bremen war, hörte ich, dass unser Masseur schwul ist. Ich bin zu ihm gegangen und habe ihm gesagt: ›Junge, tu’ dir einen Gefallen – such dir einen neuen Job.‹«
Schumachers Doping: »Er hat die Wahrheit, drum müssen wir ihn hinrichten!«
Das Schlimme an Schumachers Buch waren ja nicht die Doping-Vorwürfe. So etwas weiß ja jeder Profi oder Ex-Profi, dass das mal gemacht wird«, hat Sepp Maier kurz nach dem Erscheinen der Autobiografie »Anpfiff« des ehemaligen Nationaltorhüters Harald Schumacher fast unbemerkt von der Öffentlichkeit gesagt. Eine Meinung, die man vielleicht auch nicht hören wollte. Denn das Doping-Thema wurde zum eigentlichen Skandal des Buchs medial hochstilisiert. Vor allem auch deshalb, weil sich die gesamte Bundesliga von dem Vorwurf freisprach, dass irgendjemand zu irgendeinem Zeitpunkt verbotene Substanzen genommen habe. Michel Meyer, französischer Autor des Schumacher Buchs, zeigte sich resigniert angesichts der verlogenen Reaktionen: »Ich bin verblüfft über die heuchlerische Haltung des DFB. Ich denke seit einigen Tagen an ein Chanson von Guy Béart, wo der Refrain beginnt: ›Er hat die Wahrheit, drum müssen wir ihn hinrichten.‹«
Dass Doping unter den Fußballprofis sehr wohl ein Thema war, erzählte Manfred Kaltz bereits im Juli 1982 eher beiläufig: »Auf die Dauer bringt es nichts, wirft man sich vor dem Spiel eine Kapsel ein. Man läuft mehr, hat jedoch kein Gefühl mehr für den Punkt, wo man eigentlich kaputt ist und seine letzten Reserven angreift. Als Profi sollte man lieber die Finger von den Tabletten lassen; lieber mal schlechter spielen ohne Pillen und pausieren, wenn es körperlich nicht mehr geht.«
Peter Neururer, der knapp zwanzig Jahre nach Toni Schumacher einen neuen Skandal auslöste, als er sagte, dass in den achtziger Jahren vermutlich fast die Hälfte aller Spieler Captagon genommen habe, wusste genau, wie das Aufputschmittel wirkt: »Man sieht den Spielern den Konsum von Captagon an. Die Augen stehen anders. Der Spieler wird nicht mehr müde und neigt auf dem Platz zu Überreaktionen. Das war ein kompletter Wahnsinn, der da gemacht wurde.«
Wie so etwas in der Praxis aussehen konnte, zeigte der Schotte Willie Johnston. Ihm wurde bei der WM 1978 in einem Doping-Test die Einnahme von Steroiden nachgewiesen. Obwohl er seine Unschuld reklamierte, schickte man ihn nach Hause und belegte ihn mit einer internationalen Spielsperre von einem Jahr. Damals behauptete Johnston, er habe Medikamente gegen Fieber genommen. Später jedoch gab er sein Vergehen zu. Man darf vermuten, dass der Schotte auch anderen Substanzen gegenüber nicht gänzlich abgeneigt war. Seine Rote-Karten-Bilanz spricht jedenfalls Bände: In seiner zwölfjährigen Karriere schaffte es Johnston, beeindruckende zwanzig Mal vom Platz gestellt zu werden.
Wie ein Mann für einen Moment ein russischer Fußballstar wurde
Welcher kleine Junge träumt nicht davon, eines Tages im Trikot eines Bundesligisten auf den grünen Rasen eines vollbesetzten Stadions zu laufen, in die Menge zu winken und den Applaus der Fans in sich aufzusaugen. Für Wolfgang Koll, einen Kneipier und Journalisten aus Bonn, ging genau dieser Traum in Erfüllung.
Anfang der neunziger Jahre veranstaltete die Hamburger Morgenpost zusammen mit einem Radiosender und einigen Unternehmen die abgedrehte Aktion »Halluzi der Stadt-Spuk«. Zwischen Binnenalster und Reeperbahn wurden scheinbar Karpfen aus Gullys gefischt, in Schwimmbädern Urin-Melde-Anlagen installiert, per Funk betriebene Haifischflossen durch die Alster gejagt und U-Bahnen zu Schlafwagen umgebaut. Der Hamburger, der als Erster eine dieser Aktionen enttarnte, konnte per Telefon-Hotline attraktive Preise einheimsen.
Und da in der Hansestadt der Fußball damals mit zwei Erstligisten gerade florierte, durfte Halluzi natürlich auch ans runde Leder. Die Chance des Lebens für Wolfgang Koll. Von einem alten Freund, der mittlerweile in Hamburg lebte, war er beim Bier dazu überredet worden, bei dieser Aktion mitzuwirken. Und so lief Koll nur wenige Wochen nach diesem Versprechen als Igor Collinski vor 18.631 Zuschauern zum Warmmachen auf den Rasen des Millerntor-Stadions von St. Pauli. Euphorisch war er zuvor vom Stadionsprecher als der überraschende, sensationelle Neuzugang aus Russland angekündigt worden, der topfit direkt in den Kader gerutscht sei. Dem Mann, den das Pauli-Publikum auf dem Feld Verrenkungen machen sah, spannte das hautenge Trikot hingegen deutlich über einer üppigen Wampe. Was die TV-Kameras allerdings nicht davon abhielt, jede Regung des eigenartigen Russen zu verfolgen. Und so filmten sie auch Kolls schnelle Verletzung. Nur wenige Minuten nach dem Start einer großen Karriere musste Igor Collinski auf der Trage besorgter Sanitäter vom Platz befördert werden. Als der Mann mit Bierbauch schließlich auch noch von der Transportgelegenheit krachte, stimmte das gesamte Stadion begeistert applaudierend an: »Halluzi, Halluzi …«
Der damalige Hansa-Coach und frühere Trainer des Bonner SC, Erich Rutemöller, schaute Koll tief in die Augen. »Mensch, was machst du denn hier?«, fragte er Igor Collinski unten in den Katakomben und man sah Rutemöller deutlich an, dass er den Mann im Trikot vor sich, der eine leichte Bierfahne aussendete, irgendwoher kannte. Vielleicht hätte Koll den Schlachtruf aus gemeinsamen Tagen beim Bonner SC (»Wir brauchen keinen Rudi Völler, wir haben Erich Rutemöller«) anstimmen sollen, doch er sagte nur: »Ich muss jetzt raus!« Und dann erfüllte er sich als Igor Collinski für wenige Minuten den Traum aller fußballbegeisterten Kinder.
Legenden der Bundesliga
Als Ewald Lienen Trainer beim 1. FC Köln war, befragte man vor einem Spiel gegen den FC Schalke 04 eine Wahrsagerin, wie sie den Coach einschätzen würde. Und Medusa, die angeblich Alfred Biolek und Michail Gorbatschow zu ihren Kunden zählte, legte sich fest: »Der wird früher oder später überall scheitern. Ein großer Kämpfer zwar, doch er steht sich oft selbst im Weg. Dieser Mann findet keine Ruhe, weil er alles 1.000-prozentig machen will. Er gibt sich nie zufrieden, schafft sich dadurch viele Feinde. Er kann einfach keine Fehler verzeihen.« Dass Lienen Trainer ist, wusste Medusa übrigens angeblich nicht, denn von Fußball »verstehe sie leider gar nichts«.
In seinen Anfängen als Spieler war Ewald Lienen durchaus ein Spezialtyp. Seine Frau Rosi versuchte in einem Interview ein wenig seine Außenwirkung geradezurücken: »Viele Fans wollen nicht begreifen, weshalb mein Mann keine Autogramme schreibt. Die halten das für Arroganz. So ein Unsinn. Der Ewald setzt sich halt lieber hin und quatscht mit den Leuten ihre Probleme aus.« Wobei man sich das dann tatsächlich mal bildlich vor Augen führen sollte. Ein Fußballprofi, dem man mit all seinen Alltagssorgen kommen kann – frei nach dem Motto: »Du, Ewald, ich hätte da noch so eine Sache aus meiner Kindheit, die müsste ich unbedingt mal mit jemandem ausdiskutieren …«
Mitten im Interview klingelte das Telefon. Und Frau Rosi verriet: »Das war Ewald, der macht sich Gedanken um seine Kohlenhydrate. Er geht jetzt ein Steak essen.« Herrlich!
Ein anderer Stratege der damaligen Zeit war der Stürmer Manni Burgsmüller. Als der gebürtige Essener 1985 von Oberhausen zu Borussia Dortmund zurückkehren sollte, machte Burgsmüller ein kleines Geheimnis aus den Verhandlungen mit den Schwarz-Gelben. Einem Journalisten, der ihn direkt auf den möglichen Transfer und einen Kontakt zu Borussen-Präsidenten Reinhard Rauball, der sein Geld als Rechtsanwalt verdient, ansprach, entgegnete er: »Eine Verkehrssache, wegen zu hoher Geschwindigkeit.« Als die Umstehenden kollektiv lächelten, ergänzte Burgsmüller schelmisch grinsend: »Ja, okay, wir haben uns unterhalten.«