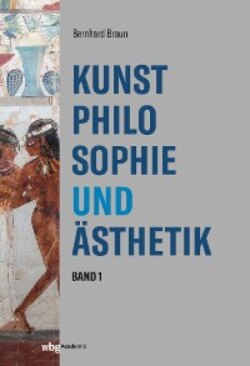Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3. Über die Macht der Dinge und das selbstgesponnene Bedeutungsgewebe
ОглавлениеSaurma-Jeltsch 2010
Boehm 1994, 327
Dieses Bekenntnis zum materiellen Werk als legitimen Untersuchungsgegenstand auch einer Kunstphilosophie darf selbstredend nicht übersehen lassen, dass Kunstphilosophie nicht primär von isolierten materiellen Dingen handelt, sondern von dem, was Autorinnen »the power of things« genannt haben. Gegenstände sind nie nur Materie, sie sind immer auch Bedeutung. Sie haben eine Aura, wirken Wunder, stehen für etwas anderes als das, was sie darstellen, oder sie werden von derartigem Mehrwert ausdrücklich auf ihre technisch-industrielle Natur hin »befreit«. Die folgende Geschichte ist keine von materiellen Kunst- und Architekturwerken, sondern von ihren Bedeutungen und den an sie geknüpften Erzählungen. Sie basiert auf dem Wunder, wie es überhaupt möglich ist, »mit bloßem Stoff (Pigmenten und Pinsel) appliziert auf einen materiellen Träger (Holz, Putz, Leinwand, Blech etc.), die höchsten Geheimnisse der Religion, des Geistes, oder eines aesthetischen Entzückens [zu] repräsentieren? […] Woher nehmen Bilder ihre Macht?«
Füssel 2017, 34
Die folgende Geschichte ist eine »Kultur-Geschichte« im besten Sinn des Wortes. Dieser Anspruch wiederum bringt es zwangsläufig mit sich, mit Blick auf den Kulturbegriff ein neues Fass zu öffnen. Dies schon deshalb, weil ich im Folgenden den Kulturbegriff angesichts von mehreren Dutzend Definitionsvorschlägen eher pragmatisch verwenden werde und damit Gefahr laufe, einem »Feuilleton-Kulturbegriff« zu verfallen. Es ist trotzdem völlig aussichtslos, diese Fragen trotz der nicht geringen Anzahl von Druckseiten hier in einem wünschenswerten Umfang zu behandeln. Wenigstens Absicht und methodische Option sollen aber in einem kurzen Stakkato offengelegt werden.
Kistler/Ulf 2012
Geertz 1983, 9
Vorweg gilt es daher festzuhalten, dass ich im Sinne der neueren Kulturtheorie und unter Berücksichtigung des »kulturellen Wandels«, dem auch der Kulturbegriff unterliegt, (1) den Kulturbegriff nicht an bestimmte Träger binde, sondern an bestimmte Praktiken (oder, wie Christoph Ulf und Erich Kistler vorschlagen, an kulturelle Akteure) – ohne dabei eine gruppenspezifische Färbung solcher Praktiken zu leugnen – und dass ich (2) dem großen Konsens folge, den Clifford Geertz, mit Max Weber im Hintergrund und Ernst Cassirer paraphrasierend, in seiner bekannten Definition abgesteckt hat. Demnach ist der Mensch ein Wesen, »das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe.« Unter Aufnahme eines Ausdrucks von Gilbert Ryle spricht Geertz von einer dichten Beschreibung. Diese semiotische Bestimmung impliziert auch eine konstruktivistische Komponente. Es geht um eine (immer schon durch das Subjekt strukturierte) Beschreibung und eine Deutung gegebener Daten.
Das heißt: Um die erwähnten Gegenstände (und Naturereignisse!) herum spinnen Menschen ein Bedeutungsgewebe, indem sie diese als Zeichen auffassen. Aus solchen mit Erzählungen aufgeladenen Gegenständen werden soziale Körper gebaut, welche Körper wieder neue Erzählungen generieren. So wie sich um Gegenstände oder Produkte und Ereignisse der Natur Erzählungen bilden, verdichtet sich umgekehrt das Gewebe der Erzählungen zu Artefakten.
Ebd.
Man steht bei der Analyse vor einem hochdynamischen Geschehen, wenn sich solche Gegenstände und damit die mit ihnen verbundenen Erzählungen geographisch bewegen, oder andersherum: wenn Akteure sich in Gegenden begeben, wo Dinge mit anderen Erzählungen aufgeladen sind. Auch die Wechselbeziehungen zwischen Erzählungen und Gegenständen, sowie Gegenständen und Rezipientinnen, Konsumentinnen und Nutzern, verweisen auf ein dynamisches Geschehen. Die Zusammenhänge machen klar, wie sehr die bekannten Bilderstürme und Zerstörungen von Werken der Kunst und Architektur Zerstörungen der mit ihnen verbundenen Geschichten sind. Umgekehrt ließen sich politische Machtansprüche durch den Einsatz von ein paar Obelisken aus Ägypten oder antiken Säulen, aus alten Bauwerken entwendet und oft über weite Strecken verfrachtet, untermauern. Die Untersuchung solcher Zusammenhänge »ist daher keine experimentelle Wissenschaft, die nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach Bedeutungen sucht.« Diese Fragen zu behandeln wäre ein eigenes Thema, aber sie werden im Folgenden hier und da in passenden Kontexten auftauchen und kurz angesprochen werden.
Einer Kunstphilosophie ließe sich derart die Aufgabe zuweisen, die aus Naturgegenständen und Artefakten (die selbst bereits als »philosophische Aussagen« gedeutet werden können) entstehenden kulturellen Erzählungen zu sondieren, während andere philosophische Genres die Beziehungen dieser Erzählungen untereinander ordnen.