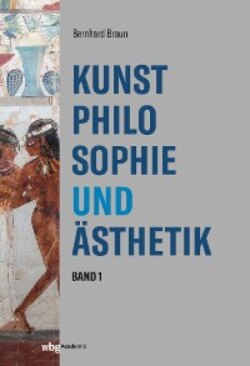Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.2. Epochenabgrenzung und Kapiteleinteilung
ОглавлениеFüssel 2017, 22
Le Goff 2016
»Epochenbezeichnungen und Periodisierungsfragen wirken in der modernen, sich als historische Kulturwissenschaft verstehenden Geschichtswissenschaft merkwürdig antiquiert und unzeitgemäß, […].« Diese stupende Äußerung ist Ausdruck einer zeitgenössischen Mode, die historischen Epochen, weil sie meist Konstruktionen des 19. Jh.s sind, auch gleich zu eliminieren. Einer der bedenkenswertesten neueren Essays dazu stammt aus der prominenten Feder von Jacques Le Goff.
Bauer 2018
Bauer 2004, 11
Er formuliert die vielleicht radikalste Antwort auf die Tatsache, dass Epochen bisweilen durch einzelne Historiker in die Welt gebracht wurden. Ohne Johann Gustav Droysen kein Hellenismus, ohne Alois Riegl keine Spätantike, ohne Jan Huizinga kein Spätmittelalter, ohne Jules Michelet und Jacob Burckhardt keine Renaissance? Man pflegt in der Historiographie inzwischen aufwendige Metadiskurse über die Benützung von Epochenbezeichnungen und für jeden Epochenbegriff jeweils lebhafte Binnendiskurse. Darf man noch von der Klassik in der Antike sprechen, welcher Begriff durch den Wust des Normativen verunstaltet wurde? Gab es eine Renaissance, die als Epoche im Süden Europas bereits wieder zu Ende war, noch bevor sie im Norden richtig begonnen hatte? Ist der Barock nicht so eng mit dem Absolutismus verstrickt, dass man am besten jenen Begriff gleich durch diesen ersetzt? Ich werde auf viele dieser Fragen am gegebenen Ort kurz eingehen, geschichtsphilosophischen Reflexionen, die letztlich jede Epochenabgrenzung mit sich führt, habe ich mich allerdings nicht gestellt. Mir klingen solche Vorschläge allzu sehr nach einem Austausch der einen durch eine andere Bezeichnung. Für überzeugender halte ich Hinweise, die solche Epochenbezeichnungen in einen größeren kulturellen Rahmen einpassen und Transformationen gegenüber Bruchkanten in den Vordergrund rücken. Ob man dann gleich alle Epochenbezeichnungen sistieren muss, ist freilich eine andere Frage, zumal man sich eines Instruments beraubt, faktische Gliederungen begrifflich zu fassen. Ich sehe deshalb – mit diesen ausdrücklichen Einschränkungen – nicht wirklich eine überzeugende Notwendigkeit, und bei dem vorliegenden Projekt schon gar keine Veranlassung, die übliche Einteilung zugunsten einer neuen, noch nicht bewährten Gruppierung über den Haufen zu werfen. Vielmehr denke ich, dass der üblichen Einteilung nach wie vor große Zweckmäßigkeit zukommt, etwa im Sinn einer Definition von Franz J. Bauer: »Wir definieren daher für unsere Zwecke den Begriff der Epoche als einen Abschnitt der historischen Entwicklung, der durch bestimmte durchgängige und vorherrschende Erscheinungen, Tendenzen oder Strukturen als ein relativ Einheitliches und Zusammenhängendes gekennzeichnet und dadurch vom allgemeinen Strom des Geschehens oder von anderen Abschnitten desselben deutlich unterschieden ist.«
Natürlich ist eine solche Definition nicht sklavisch durchzuhalten. Immer steht das systematisch-ideengeschichtliche Interesse im Vordergrund. So behandle ich beispielsweise die Spätantike in einem eigenen Abschnitt, weil sich in dieser »Epoche« mehrere kunstphilosophisch bedeutende Umwälzungen ergeben haben, wie das Christentum oder die Kultur von Byzanz. Die inhaltlich zusammengehörige islamische Kultur von den Anfängen bis in die Neuzeit wiederum wird in die zeitliche Epoche des Mittelalters eingebaut. Der Übergang vom 19. in das 20. Jh. ist besonders unscharf und die Abgrenzung, die der Erste Weltkrieg markiert, nicht viel mehr als eine schnell ergriffene Gelegenheit, nach dem »langen 19. Jahrhundert« endlich einen neuen Abschnitt beginnen zu können.
Das vorliegende Werk ist keine Philosophiegeschichte. Dieser Hinweis ist deshalb wichtig, weil es viele Darstellungen von Einzelpositionen gibt, die manchmal – bei kunstphilosophisch wichtig scheinenden Philosophen – auch mehrere Kapitel umfassen. In diesen Fällen wird stets auch eine komprimierte Darstellung der philosophischen Position versucht. Dabei geht es einzig darum, eine Position im Hinblick auf ein kunstphilosophisches Interesse zu beschreiben. Keinesfalls ist damit auch nur ansatzweise der Anspruch verknüpft, das philosophische Anliegen von beispielsweise Cusanus, Leibniz oder Wittgenstein in seiner Gesamtheit vorzustellen. Ähnliches gilt vice versa auch für kunstgeschichtlich orientierte Kapitel, die lediglich grobe Umrisse der Aktivitäten in bildender Kunst und Architektur einer Zeit abstecken und diese der Leserin und dem Leser in Erinnerung rufen wollen.