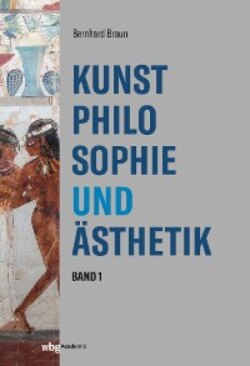Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.4. Europa – der Nabel der Welt?
ОглавлениеAls Max Hollein 2018 die Leitung des Vielsparten- und Weltmuseums Metropolitan Museum in New York übernahm, äußerte er in mehreren Interviews die Meinung, dass die alte historische Abfolge der Kunstgeschichte von Mesopotamien über Antike, Mittelalter und Renaissance bis zur Gegenwart überholt sei, weshalb er seine Aufgabe unter anderem darin sehe, diesen eurozentrischen Blickwinkel zu überwinden. Als konkrete praktische Konsequenz ergebe sich daraus die Stärkung außereuropäischer Sammlungen, von Südamerika über Ozeanien, den Fernen Osten bis Afrika. Eine solche Sicht eines über riesige Sammlungsbestände aus aller Welt verfügenden Museumsdirektors ist angesichts der in Abschnitt IX als Eigenart der Contemporary Art geschilderten Situation naheliegend und problemlos nachvollziehbar und geht auch am Autor der vorliegenden Arbeit nicht spurlos vorüber. Denn die Begrenzung einer solch umfangreichen Arbeit auf die Genres der bildenden Kunst und Architektur sollte kaum auf Widerworte stoßen. Ganz anders ist es mit der Begrenzung auf Europa, ein Unterfangen, das automatisch unter Eurozentrismusverdacht steht.
Davon gilt es sich hier ausdrücklich zu distanzieren. Die Begrenzung ergibt sich schlicht aus der Einsicht in eine beklagenswerte Inkongruenz von grenzenloser Neugierde und jener vermutlich von Hippokrates formulierten Wahrheit, die der römische Philosoph Seneca überlieferte: vita brevis, ars longa (die Kunst ist lang, aber das Leben kurz). Es geht aber auch um die Einsicht in die Grenzen von Kompetenz, die bereits bei der Darstellung der europäischen Sicht auf das Äußerste strapaziert werden.
Es kommt, das räume ich unumwunden ein, noch etwas hinzu: nämlich eine Begeisterung für den faszinierend reichen, vielfältigen und alten Kulturraum Europa. Aus dieser Begeisterung mag auch ein Gefühl der Dankbarkeit sprechen, dass es mir als einem Mitte der Fünfzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts Geborenen gegeben war, was noch keine Generation vor mir erleben durfte, nämlich mitten in diesem seit Jahrhunderten von Kriegen, Nöten und Schlachten heimgesuchten Kontinent ein Leben in Frieden, Prosperität und wachsender Aufklärung zu leben. Insofern hat es mich gefesselt, an dessen kultureller Erzählung mitzuschreiben. Dies nicht zuletzt deshalb, weil Europa in unseren Tagen angesichts der Geißel eines neu entfachten Nationalismus vor seiner größten Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg steht. Wir erleben eine erschreckende Rückabwicklung der Nachkriegs-Aussöhnung der verfeindeten Staaten durch die Gesellschaft spaltende Parolen, die mutwillige Zerstörung der hart und erfolgreich erkämpften liberalen Rechtsstaatlichkeit durch Verhöhnung und Ausschaltung der Gewaltenteilung, Presse-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit.
Umso wichtiger ist es, von diesem faszinierenden einheitlichen Kulturraum zu berichten, von der Entstehung Europas aus den orientalischen Erzählungen, dem kreativen Umgang damit und den Impulsen dieser Ideen, namentlich natürlich jener der Kunst, für die anderen Gegenden des Globus. Der Blick erinnert gleichsam an einen doppelten Trichter. Saugte Europa seine kulturellen Erzählungen aus einem riesigen geographischen Raum an, um sie über Jahrhunderte zu verwalten und dabei mit kreativem Mehrwert auszustatten, verbreiteten sich die nunmehr europäischen Erzählungen ab dem 19. Jh. über den gesamten Globus und forderten die jeweils autochthon entstandene lokale Prägung heraus.
Europas kulturelle Erzählungen waren stets gesamteuropäisch und nie auf willkürlich entstandene Nationalstaaten begrenzt. Eine führende Rolle nahmen dabei die Kunststile ein, die diese gesamteuropäische Verbundenheit einmalig widerspiegelten, zugleich aber immer auch die reizvollen lokalen Prägungen transportierten. Insofern hat der frühere Designer der Österreichischen Nationalbank, Robert Kalina, beim Entwurf der Geldscheine der europäischen Gemeinschaftswährung eine großartige Symbolik für dieses in Kultur, Kunst und Architektur längst vereinigte Europa gefunden.
Vor die Frage gestellt, was das Schwierigste an dem ganzen Projekt war, würde ich spontan antworten: das Aufhören! Beim Flanieren durch die unüberschaubaren Stellagen in den philosophischen und kunsthistorischen Bibliotheken, stieg in mir immer wieder das Bild hoch, wie im Film Der Name der Rose der von Sean Connery verkörperte William von Baskerville abgekämpft mit rußigem Gesicht und einigen geretteten Büchern in den Armen aus der brennenden Klosterbibliothek kommt. In der Tat fiel es schwer, die lockenden Titel, die einen auf der Wanderung über die vielen Wegen, die man neu entdeckt hat, und denen man gerne noch in ihren Abzweigungen nachgespürt hätte, auf den Bücherborden stehen zu lassen. Zwar nicht mit rußigem Gesicht, aber doch einigermaßen abgekämpft hoffe ich, dass dieses Buch trotz der zwangsläufigen Beschränkungen einen nützlichen Überblick ermöglicht, das Verständnis für Europas Kultur fördert und neugierig macht für die Sachen der Kunst und der Philosophie.