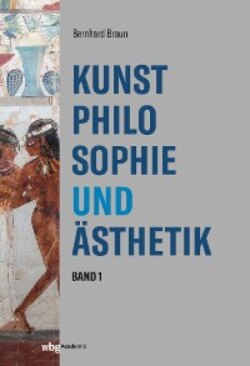Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inhalt
ОглавлениеBand 1
0. Einleitung
1.0. Projekt und Motivation
2.0. Inhaltliche Vorbemerkung
2.1. Kunstphilosophie und Ästhetik
2.2. Interdependenz kultureller Erzählungen
2.3. Über die Macht der Dinge und das selbstgesponnene Bedeutungsgewebe
3.0. Methodische Vorbemerkung
4.0. Varia
4.1. Leseanleitung
4.2. Epochenabgrenzung und Kapiteleinteilung
4.3. Schreibweisen, Abkürzungen, Gender
4.4. Europa – der Nabel der Welt?
I. Ur- und Frühgeschichte
1.0. Out of Africa – Kontexte
2.0. Die Anfänge der Kunst
3.0. Die Kunst des Paläolithikums
3.1. Kontexte
3.2. Das Weltbild des Paläolithikums
3.3. Der Kultort Höhle
3.4. Zeichen der Polarität
3.5. Ein kunstphilosophisches Resümee und das Ende der paläolithischen Kunstepoche
4.0. Die Neolithische Revolution
4.1. Kontexte
4.2. Das Weltbild des Neolithikums
4.3. Vom Mythos des Ortes – Der Beginn der Architektur
4.3.1. Offene und geschlossene Form
4.3.2. Zwischen Architektur und Skulptur
4.3.3. Vom Haus zur Siedlung
4.3.4. Das Anheben der Stadt
5.0. Die Tempelkultur auf dem maltesischen Archipel
II. Frühe Hochkulturen
1.0. Alter Orient
1.1. Kontexte
1.2. Die Kulturen des Alten Orients
1.2.1. Frühgeschichte
1.2.2. Die elamische und sumerische Kultur
1.2.2.1. Uruk/Gaura- und Dschemdet-Nasr-Zeit
1.2.2.1.1. Mythos und Religion
1.2.2.1.2. Kunst und Architektur
1.2.2.2. Frühdynastische Zeit
1.2.3. Akkad-Zeit
1.2.4. Ur III-Zeit – Neusumerische Zeit
1.2.5. Babylonische Zeit
1.2.6. Das Reich der Assyrer
1.2.7. Spätbabylonische Zeit
1.2.8. Von den Achämeniden bis zu Alexander dem Großen
2.0. Ägypten
2.1. Kontexte
2.1.1. Topografie und kulturelles Selbstverständnis
2.1.2. Eine Geschichte nach Königsdynastien
2.2. Mythos
2.2.1. Cheper als Chiffre für Entfaltung
2.2.2. Ma’at als Chiffre für Bestand
2.3. Religion
2.3.1. Polytheismus – Monotheismus
2.3.2. Ein und Alles – Eine Formel für Religion und Kunst
2.3.3. Kult des Todes – Kult des Lebens
2.4. Chthonisches und Sonnenkult – Pyramide und Obelisk
2.5. Der Tempel – Symbol kultureller Erinnerung
2.6. Kunst und Architektur – Spiel von Organischem und Kristall
2.6.1. Entwicklung der bildenden Kunst
2.6.2. Profanarchitektur
2.7. Die Hermetik, die Hieroglyphen und das Erbe Ägyptens
3.0. Israel und der judäische Monotheismus
3.1. Kontexte
3.2. Die Entstehung des Monotheismus
3.2.1. Jerusalem
3.2.2. David und JHWH
3.2.3. JHWH zwischen Immanenz und Transzendenz
3.2.4. JHWH, der Gott des Volkes Israel
3.2.5. Die Zuspitzung des nationalen Monotheismus im Streit um die Hellenisierung
3.2.6. Die ikonographischen Konsequenzen in Architektur und Kunst
3.2.6.1. Kunst
3.2.6.2. Der Tempel- und Synagogenbau
4.0. Der Alte Orient – Ein kultur- und kunstphilosophisches Resümee
5.0. Die Theorie der »Achsenzeit«
III. Die antike Welt – Griechenland und Rom
1.0. Auf dem Weg zum Griechischen
1.1. Kontexte
1.2. Kreta und die Ägäis: Die minoische Kultur
1.2.1. Kontexte
1.2.2. Religions- und Sozialgeschichte
1.2.3. Die Palastarchitektur und die Kunst
1.2.4. Der minoische Dynamismus
2.0 Griechenland
2.1. Mykene
2.1.1. Mykenische Religion
2.1.2. Zyklische Dynamik, Mysterion und Harmonie – die Quellen der Mysterienkulte als Quellen der Philosophie
2.1.3. Die Orphik
2.1.3.1. Urzustand und die Spaltung der Welt
2.1.3.2. Zeus und Eros als Chiffren für das Ringen um Statik und Prozess
2.2. Griechenland nach den Dunklen Jahrhunderten
2.2.1. Kontexte
2.2.2. Homer und Hesiod
2.2.3. Die Pythagoreer
2.2.4. Das Anheben der Kunstepochen – Der geometrische Stil
2.3. Das archaische Griechenland
2.3.1. Bildende Kunst
2.3.2. Die Anfänge des Tempelbaus und die Architektur
2.3.3. Der Beginn der europäischen Philosophie
2.3.3.1. Die ionische Philosophie
2.3.3.2. Parmenides und Heraklit
2.3.3.3. Dialektik
2.4. Griechenland in der Klassik
2.4.1. Bildende Kunst
2.4.2. Architektur
2.4.3. Athen in der »Moderne«
2.4.3.1. Die Geisteshaltung der Sophisten
2.4.3.2. Platon
2.4.3.2.1. Kontexte
2.4.3.2.2. Ontologie und Kunstphilosophie Platons
2.4.3.2.3. Das Frühwerk
2.4.3.2.4. Platons Ideenlehre und ihr doppeltes Scheitern
2.4.3.2.5. Platons Eros-Philosophie und die Konzeption des Schönen
2.4.3.2.6. Platons Ontologie des Bildes
2.4.3.3. Aristoteles
2.4.3.3.1. Kontexte
2.4.3.3.2. Die philosophische Position des Aristoteles
2.4.3.3.3. Kunstphilosophie und Ästhetik
2.5. Hellenismus
2.5.1. Kontexte
2.5.2. Die kunstphilosophischen Positionen der hellenistischen Schulen
2.5.3. Die Religion des Hellenismus
2.5.4. Kunst und Ästhetik im Hellenismus
3.0. Rom
3.1. Kontexte
3.1.1. Das Auftreten der Italiker
3.1.2. Die Etrusker und das Ringen mit Rom
3.1.3. Von der Gründung Roms bis zum Ende der Republik
3.1.4. Die Kaiserzeit
3.2. Römische Religion
3.3. Kunstphilosophische Aspekte der römischen Kunst und Architektur
3.3.1. Charakteristika römischer Kunst
3.3.2. Architektur
3.3.2.1. Der römische Tempel
3.3.2.2. Öffentliche und private Bauten
3.3.2.3. Die Basilika
3.3.3. Skulptur und Malerei
3.4. Konzepte der Kunstphilosophie und Ästhetik
3.4.1. Cicero
3.4.2. Horaz und Ovid
3.4.3. Vitruv
3.4.4. Pseudo-Longinos
Band 2
IV. Die Spätantike
1.0. Kontexte
1.1. Vom Heidentum zum Christentum
1.2. Die neuen Völker
2.0. Von der antiken zur spätantiken Kunst
3.0. Das Christentum
3.1. Kontexte
3.2. Jesus von Nazareth
3.3. Die Theologisierung des historischen Jesus
3.4. Kunstphilosophische Impulse des Christentums
3.5. Inkarnation versus Pneumatologie – ein gegenkulturelles Konzept
4.0. Philosophie und Ästhetik der griechischen und lateinischen Väter
4.1. Frühe Apologeten
4.2. Der Streit um die Christologie
4.2.1. Die Orientalen
4.2.2. Die Okzidentalen
4.3. Augustinus von Hippo und die Ästhetik der Zahl
4.4. Das Mönchtum des Ostens
5.0. Spätantike und frühchristliche Kunst
5.1. Die christliche Neucodierung antiker Kunst – Zeit und Themen derfrühchristlichen Kunst
5.1.1. Von der heidnischen zur christlichen Kunst
5.1.2. Themen der frühchristlichen Kunst am Beispiel der Grab- und Sarkophagkunst
5.1.3. Motive der Christusdarstellung
5.1.4. Die Sonnenkonnotation in der Konkurrenz mit dem Mithras-Kult
5.2. Die Basilika
5.2.1. Frühe Hauskirchen
5.2.2. Die Basilika und das Mosaik
6.0. Byzanz
6.1. Kontexte
6.2. Byzantinische Kunst und Architektur
6.2.1. Zentralbau
6.2.2. Die Bauten Justinians I.
6.2.3. Die kunsttheoretische Bedeutung der Narration in den spätantiken Sakralbauten
7.0. Der Neuplatonismus
7.1. Die Rezeption Platons
7.2. Der neuplatonische Dynamismus und seine Autoren
7.3. Der Neuplatonismus als Paradigma für Anagogie und die Darstellung des Undarstellbaren
8.0. Das Kultbild
8.1. Das christliche Bild
8.2. Das Acheiropoieton und die Ikone
8.3. Der Streit um das Bild
8.4. Die Philosophie des Bildes
V. Das Mittelalter
1.0. Kontexte
2.0. Zwischen Konstantin und Karl dem Großen
2.1. Boëthius
2.2. Andere Autoren neben Boëthius
3.0. Die Kultur des Islam
3.1. Der arabische Hintergrund
3.2. Kontexte
3.3. Philosophie und Wissenschaft im Islam
3.3.1. Kunstphilosophie und Ästhetik
3.3.2. Das Bilderverbot
3.3.3. Arabeske und Ornament
3.4. Islamische Architektur und Kunst
3.4.1. Grundlage der Architektur der Sakralräume
3.4.2. Zwischen Spätantike und dem Motivschatz Chinas – Die Kunst der islamischen Dynastien
3.4.2.1. Die Umaiyaden
3.4.2.2. Die Abbasiden
3.4.2.3. Die Fatimiden
3.4.2.4. Die Seldschuken
3.4.2.5. Die Osmanen
4.0. Die Karolingische Renaissance und die Ästhetik
4.1. Vorkarolingische Kunst und Architektur
4.2. Die Zeit Karls des Großen
4.2.1. Kontexte
4.2.2. Klöster
4.2.3. Die Intellektuellen zur Zeit Karls und die Stellungnahme des Westens im Bilderstreit
4.2.4. Johannes Scotus Eriugena
4.2.5. Architektur und bildende Kunst
5.0. Der Umbruch der Jahrtausendwende und das 11. Jahrhundert
5.1. Kontexte
5.2. Die Reform von Cluny
5.3. Ästhetik und Kunst im lateinischen Mittelalter nach der Jahrtausendwende
5.3.1. Methodische Anmerkungen
5.3.2. Inhaltliche Anmerkungen
5.4. Romanische Architektur und Kunst
5.4.1. Formale und kunstphilosophische Aspekte der romanischen Architektur
5.4.2. Formale und kunstphilosophische Aspekte der romanischen bildenden Kunst
6.0. Das 12. Jahrhundert
6.1. Kontexte
6.2. Die Domschulen
6.2.1. Die Schule von Chartres
6.2.2. Die Schule von St. Viktor
6.2.3. St. Denis und der Beginn der gotischen Architektur
6.2.4. Cîteaux und die asketische Architektur der Zisterzienser
7.0. Das 13. Jahrhundert
7.1. Kontexte
7.2. Die Scholastik
7.2.1. Die Form der scholastischen Literatur
7.2.2. Die scholastische Philosophie
7.2.2.1 Abaelard
7.2.2.2. Die Franziskaner und Dominikaner
7.2.2.3. Robert Grosseteste und die Lichtmetaphysik
7.2.2.4. Bonaventura
7.2.2.5. Albert der Große und seine Schule
7.2.2.6. Thomas von Aquin
7.2.2.6.1. Ontologie und Theologie
7.2.2.6.2. Ästhetik
7.2.2.6.3. Kunst
7.3. Die Gotik in Architektur und bildender Kunst
7.3.1. Formale und kunstphilosophische Aspekte der gotischen Architektur
7.3.2. Formale und kunstphilosophische Aspekte der gotischen Skulptur und Malerei
7.4. Gibt es eine Philosophie der gotischen Kathedrale?
8.0. Das 14. Jahrhundert und der Herbst des Mittelalters
8.1. Kontexte
8.2. Architektur und Kunst im Übergang
8.3. Philosophie und Ästhetik der Spätscholastik
9.0. Das Ende des Mittelalters
VI. Die Renaissance
1.0. Der Begriff der Renaissance
2.0. Das 15. und 16. Jahrhundert – Kontexte
3.0. Die Kultur der Renaissance
3.1. Die Entdeckung der Welt
3.2. Magie und Wissenschaft
3.3. Das neue Sozialgefüge
3.4. Der Brennpunkt Florenz
4.0. Philosophie und Humanismus
4.1. Der Humanismus
4.1.1. Begriff und Bedeutung
4.1.2. Humanistische Positionen und die Spannung zwischen Naturnachahmung und Genie
4.1.3. Der Paragone zwischen Literatur und Kunst
4.2. Die Philosophie der Renaissance und ihre kunstphilosophischen Gehalte
4.2.1. Nikolaus von Kues
4.2.2. Marsilio Ficino
4.2.3. Giordano Bruno
4.2.4. Weitere Philosophen der Renaissance
4.2.5. Philosophische Mystik
4.2.6. Die Staatsutopien
5.0. Die Perspektive
5.1. Voraussetzungen der Perspektive
5.2. Kontexte
5.3. Theorie der Perspektive
6.0. Bildende Kunst und Ästhetik der Renaissance
6.1. Dichtung und bildende Kunst
6.2. Die Wende in der bildenden Kunst
6.3. Die Bestimmungsmodi der Renaissancekunst
6.4. Die Künstler und ihre Traktate
6.4.1. Kunst als Wissenschaft: Cennini, Ghiberti, della Francesca, Dürer
6.4.2. Albertis Traktate zur bildenden Kunst
6.4.3. Kunst zwischen Theorie und Praxis: Leonardo, Michelangelo, Cellini
7.0. Die Architektur der Renaissance
7.1. Traktate zur Architektur
7.2. Der Sakralbau
7.3. Die großen Renaissance-Architekten und ihre kunstphilosophischen Fundamente
7.3.1. Filippo Brunelleschi
7.3.2. Leon Battista Alberti
7.3.2.1. Leben und Werk
7.3.2.2. Albertis Architekturtraktat
7.3.3. Donato Bramante
7.3.4. Andrea Palladio
8.0. Der Ausklang der Renaissance im Manierismus
8.1. Manierismus in der bildenden Kunst und der Streit um die Nachahmung
8.2. Manierismus in der Architektur
8.3. Vasari, Lomazzo, Zuccaro und die Theorie des Manierismus
Band 3
VII. Von der Neuzeit bis zur Französischen Revolution – das 17. und 18. Jahrhundert
1.0. Kontexte
1.1. Der Zerfall des totum – politische Implikationen
1.2. Das Unendliche und das Dynamische – die neue Wissenschaft und die endgültige Entdeckung der Welt
1.3. Mystik und der »Körper« der Kirche
1.4. Klassik und Barock
1.5. Die Kunstlandschaften Europas
1.5.1. Italien
1.5.2. Spanien und Portugal
1.5.3. Frankreich
1.5.4. England
1.5.5. Die Niederlande
1.5.6. Deutschland und Österreich
1.5.7. Russland und Osteuropa
2.0. Die Legitimität der Neuzeit und die Philosophie des Rationalismus
2.1. Zur Legitimitätsfrage der Neuzeit
2.2. Der Rationalismus
2.2.1. Die Vertreter des Rationalismus
2.2.2. Gracián und der bon goût
3.0. Struktur des Barock
3.1. Kontexte
3.2. Der Begriff barock
3.3. Dynamik und System – eine Philosophie des Barock
3.4. Die Motive barocker Kunst und Architektur
3.5. »Autoren« barocker Universalsprache
3.6. Ermüdung des Barock und das Rokoko
4.0. Theorie und Ästhetik des 17. und 18. Jahrhunderts und der Streit um die Klassizität
4.1. Die ästhetischen Theorien des Barock
4.2. Barock und Klassizismus
4.2.1. Die Nachahmung der Natur
4.2.2. Die Querelle des Anciens et des Modernes
4.2.3. Die Grand Tour als Voraussetzung des Klassizismus
4.2.4. Positionen des Klassizismus
4.2.4.1. Die Verschiebung des Demiurgischen zur Vernunft in den bildenden Künsten
4.2.4.2. Johann Joachim Winckelmann, Johann Georg Sulzer, Gotthold Ephraim Lessing und der Streit um die Griechenverehrung
4.2.4.3. Vom Barock zum Klassizismus in der Architektur
4.2.4.3.1. Höhepunkt und Erosion des Klassizismus in Frankreich und England
4.2.4.3.2. Die Rückkehr des Klassizismus nach Italien und Spanien
5.0. Der Empirismus
5.1. Philosophische Positionen des Empirismus
5.2. Kunstphilosophische Positionen zwischen Empirismus und Rationalismus
5.2.1. Auf dem Weg zur Begründung einer philosophischen Ästhetik
5.2.2. Denis Diderot und der Beginn der Kunstkritik
5.2.3. Alexander Baumgarten und der Beginn der Ästhetik
5.2.4. Edmund Burke und das Erhabene
5.2.5. Das Pittoreske und die Architektur des Gartens
5.2.6. Kunst und Erkenntnis
6.0. Immanuel Kant
6.1. Das Subjekt als Basis der kritischen Philosophie
6.2. Kants kritische praktische Philosophie
6.3. Ästhetik
6.3.1. Das Geschmacksurteil
6.3.2. Das ästhetische Urteil und das Schöne
6.3.3. Das Erhabene
6.3.4. Die Kunst und das Genie
7.0. Die Aufklärung
7.1. Jean Jacques Rousseau
7.2. Johann Gottfried Herder
VIII. Aufklärung und Moderne – das lange 19. Jahrhundert
1.0. Kontexte
1.1. Die Französische Revolution und der Aufstieg Napoleons
1.2. Die Befreiung von Napoleon und die Revolutionen von 1848
1.3. Die Idee des Nationalismus in der Politik Europas
2.0. Signaturen des 19. Jahrhunderts
2.1. Die neue Welt der Maschine und die ersten Global Players
2.2. Beschleunigung und Konservierung – Aufbegehren und Rückzug
2.2.1. Dynamisierung
2.2.2. Der Hygiene-Diskurs
3.0. Beharrung und Befreiung – Die Ästhetisierung von Kunst und Architektur
3.1. Die bildenden Künste
3.1.1. Die traditionellen Genres der bildenden Künste
3.1.2. Die Anfänge der Fotografie
3.2. Die Architektur
3.2.1. Das Ende des Klassizismus
3.2.1.1. Die Erosion der Regelästhetik
3.2.1.2. Die neue Sicht des antiken Erbes
3.2.2. »In welchem Style sollen wir bauen?« – Stile im 19. Jahrhundert
3.2.2.1. Die Pluralisierung der Stile
3.2.2.2. Die Neugotik
3.2.2.3. Die Debatte um die Pluralisierung der Stile
3.2.3. Von der Revolutionsarchitektur zum Funktionalismus
3.2.3.1. Zwischen Philosophie und Ingenieurstechnik
3.2.3.2. Material und Funktion
3.2.3.2.1. John Ruskin
3.2.3.2.2. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc
3.2.3.2.3. Zwischen Denkmalschutz und Modernisierung
4.0. Zwischen Aufklärung, Romantik und Idealismus
4.1. Friedrich Schiller
4.2. Johann Wolfgang von Goethe
5.0. Der Deutsche Idealismus
5.1. Johann Gottlieb Fichte
5.2. Friedrich Wilhelm Josef Schelling
5.2.1. Schellings philosophische Position
5.2.2. Schellings Kunstphilosophie
5.2.3. Das Älteste Systemprogramm des Deutschen Idealismus
5.3. Georg Friedrich Wilhelm Hegel
5.3.1. Hegels philosophisches Anliegen
5.3.2. Die Ästhetik Hegels
5.3.2.1. Kunst als Vergeistigung des Sinnlichen
5.3.2.2. Kunstschönheit versus Naturschönheit – Philosophie überflügelt die Kunst
5.3.2.3. Die Freiheit der Kunst und ihr »Ende«
5.3.3. Konsequenzen
6.0. Die Ästhetikdiskussion nach Hegel und das Ringen um den Ästhetikbegriff
6.1. Ästhetische Positionen im Umfeld des Deutschen Idealismus
6.1.1. Ästhetik im Liberalismus und Sozialismus des 19. Jahrhunderts
6.1.2. Die Hegel- und Marxrezeption in Russland: Westler gegen Slawophile und die neue Rolle der Ikone
6.1.3. Karl Friedrich Rosenkranz und die Ästhetik des Hässlichen
6.1.4. Arthur Schopenhauer
6.1.5. Friedrich Schleiermacher
6.1.6. Søren Kierkegaard
6.1.7. Friedrich Theodor Vischer
6.2. Ästhetik zwischen Idealismus und Empirismus
6.2.1. Gustav Theodor Fechner
6.2.2. Das Konzept der Einfühlung
7.0. Die Romantik
7.1. Kontexte
7.1.1. Der Begriff Romantik
7.1.2. Das Genie, die Inspiration und die Revolution
7.2. Romantik als ästhetischer Begriff
7.3. Friedrich und August Wilhelm Schlegel
7.4. Romantik in der Kunst
7.4.1. Das Subjekt in der Spannung von Entmächtigung und Ermächtigung
7.4.2. Die Natur als Chiffre der Seele
7.4.3. Die romantische Kunst und Architektur als Wegbereiter der Moderne
7.5. Vormärz und Biedermeier
8.0. Das Ringen um die Moderne
8.1. Nazarener und Präraffaeliten
8.2. Die katholische Kirche und ihr Kampf gegen die Moderne
9.0. Die Moderne
9.1. Topografie der Moderne
9.1.1. Das Transitorische gegen das Finale
9.1.2. Charles Baudelaire
9.1.3. Hippolyte-Adolphe Taine
9.1.4. Paul Valéry
9.2. Die Wege in die Moderne der Kunst
9.2.1. Der Realismus
9.2.2. Der Impressionismus
9.2.3. Der Jugendstil – ein Weg in die Moderne
9.2.3.1. Höhepunkt und Ende der Akademieästhetik
9.2.3.2. Das neue Gesamtkunstwerk
9.2.3.3. Der Jugendstil in der Architektur
10.0. Kunstphilosophische Positionen des Übergangs in ein neues Jahrhundert
10.1. Friedrich Nietzsche
10.2. Konrad Fiedler
10.3. Jacob Burckhardt
Band 4
IX. Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart
1.0. Kontexte
1.1. Beschleunigung – Produktion – Relativität
1.2. Die Künstler in der »Urkatastrophe«
1.3. Russlands Weg in die Diktatur
1.4. Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg
2.0. Malerei und Bildhauerei am Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert
2.1. Der Gang in die Abstraktion
2.1.1. Abstraktion, Gegenstandslosigkeit und Selbstreferentialität der Kunst
2.1.2. Die Wege in die ungegenständliche Kunst und ihre Motive
2.1.3. Die Ambivalenz der Moderne – kunstphilosophische Programmatik und Konsequenzen
2.2. Eine Geographie der »Ismen« der ersten Jahrhunderthälfte
2.2.1. Fauvismus – Expressionismus – Kubismus
2.2.2. Der Monte Verità
2.2.3. Dadaismus
2.2.4. Symbolismus
2.2.5. Surrealismus
2.2.6. Futurismus
2.2.7. Die russische Avantgarde: Konstruktivismus und Suprematismus
2.2.8. Werkbund und Bauhaus
2.2.9. De Stijl
2.2.10. Marcel Duchamp und das Ready-Made
2.3. Die neue »Sprache« der Moderne in der Architektur
2.3.1. Das Ende des Historismus
2.3.2. Positionen der Architektur in der ersten Jahrhunderthälfte
2.3.3. Frank Lloyd Wright
2.3.4. Ludwig Mies van der Rohe
2.3.5. Le Corbusier
3.0. Die philosophischen Positionen des 20. Jahrhunderts in ihrer kunstphilosophischen Bedeutung
3.1. Theosophie
3.2. Einzelpositionen um die Jahrhundertwende
3.2.1. Georg Lukács
3.2.2. John Dewey
3.2.3. Theodor Lipps und das Konzept der Einfühlung
3.2.4. Benedetto Croce
3.2.5. Robin George Collingwood
3.3. Der Neukantianismus
3.3.1. Ernst Cassirer
3.3.2. Nicolai Hartmann
3.4. Kunstgeschichte als Geistesgeschichte – Von der Ikonographie zur Ikonologie
3.4.1. Aby Warburg und der Warburg-Kreis
3.4.2. Die Ikonologie Erwin Panofskys und die Ikonik Max Imdahls
3.5. Die Phänomenologie
3.5.1. Edmund Husserl
3.5.1.1. Biographie und Werk
3.5.1.2. Prolegomena zu einer Ästhetik
3.5.2. Maurice Merleau-Ponty
3.6. Martin Heidegger
3.6.1. Fundamentalontologie
3.6.2. Die Kehre zur »Seinsgeschichte«
3.6.3. Philosophie der Kunst
3.7. Hans Georg Gadamer
3.8. Die Frankfurter Schule und die Kritische Theorie
3.8.1. Theodor Wiesengrund Adorno
3.8.1.1. Die kunstphilosophische Ambition von Adornos Philosophie
3.8.1.2. Die Ästhetische Theorie
3.8.2. Walter Benjamin
3.9. Sprachphilosophie und Analytische Philosophie
3.9.1. Ludwig Wittgenstein
3.9.2. Nelson Goodman
3.9.3. Arthur C. Danto
3.9.4. Richard Arthur Wollheim
3.9.5. Morris Weitz
3.9.6. George Dickie
3.9.7. Monroe C. Beardsley
3.9.8. Weitere kunstphilosophische Positionen der Analytischen Philosophie
4.0. Moderne und Postmoderne
4.1. Die Architektur der modernen Vernunft
4.2. Die Wege in die Postmoderne
4.3. Die Avantgarde zwischen Moderne und Postmoderne
4.4. Der Strukturalismus – Ferdinand de Saussure
4.4.1. Claude Lévi-Strauss
4.4.2. Roland Barthes
4.5. Der Poststrukturalismus
4.5.1. Jacques Derrida
4.5.2. Jean-François Lyotard
4.5.3. Michel Foucault
4.5.4. Georges Bataille
4.5.5. Jacques Lacan
4.5.6. Gilles Deleuze und Félix Guattari
4.6. Die Postmoderne
4.6.1. Die Theorie der Postmoderne
4.6.2. Postmoderne Kunst und Architektur
4.7. Die Thematisierung der Medialität
4.7.1. Marshall McLuhan
4.7.2. Vilém Flusser
4.7.3. Paul Virilio
4.7.4. Jean Baudrillard
4.7.5. Das göttliche Google und eine neue Aufklärung
5.0. Die Entwicklung von bildender Kunst und Architektur nach dem Zweiten Weltkrieg
5.1. Kontexte
5.1.1. Die Revolutionen der Sechzigerjahre
5.1.2. Zwischen Technikeuphorie und Zukunftsangst – Apollo 11 und Club of Rome
5.1.3. Das Friedens- und Aufklärungsprojekt der Europäischen Union und die Bedrohung durch den Nationalismus
5.2. Die Kunst zwischen Adornos moralischem Moratorium und D11
5.2.1. Abstrakter Expressionismus und Informel
5.2.2. Pop Art – Funk Art – Nouveau Réalisme
5.2.3. Minimal Art
5.2.4. Concept Art
5.2.5. Zero und Land Art
5.2.6. Aktionskünste: Performance – Happening – Fluxus – Body Art
5.2.6.1. Der performative Charakter der Kunst
5.2.6.2. get involved!
5.2.6.3. Performance und Fluxus – die Auflösung der Kunstgenres
5.2.6.4. Gegen den Körper – mit dem Körper: Body Art
5.2.6.5. Soziale Plastik und die Heteronomie der Kunst
5.2.7. Zwischen Videokamera und Spam Bots: Medienkunst
5.3. Strömungen der Nachkriegsarchitektur
5.3.1. Die Kritik am Funktionalismus
5.3.2. Die »Ismen« in der Architektur
6.0. Contemporary – Tendenzen der Gegenwart in Architektur und Kunst
6.1. Die Architektur zwischen Funktionalismus und Crossover
6.1.1. Maschine und Utopie
6.1.2. Biomorphie und Metabolismus – physical vs. digital
6.1.3. Blasen – Blobs – Schäume
6.1.4. Sustainability und Co-Working. Der social- und ecological turn in der Architektur
6.2. Bildende Kunst
6.2.1. Crossover: Sampling – Switching
6.2.2. Street Art – Space Invading
6.2.3. Post-Digital – Post-Internet
6.2.4. Kunst – Event – Markt
X. Kunstphilosophie und Ästhetik – eine systematische Sichtung
1.0. Kunstphilosophie und Ästhetik
1.1. Kunstphilosophie
1.2. Ästhetik
1.2.1. Die historischen Wurzeln und ihre gegenwärtige Revitalisierung
1.2.2. Ästhetik als Perspektive auf Kunst und Wahrnehmung
1.3. Schönheit
1.3.1. Der Schönheitsbegriffs in der Tradition
1.3.2. Systematische Anmerkungen zum Schönheitsbegriff
1.3.2.1. Charakteristika des Schönheitsbegriffs
1.3.2.2. Begründungsversuche von Schönheit
1.3.2.3. Schönheit als Form
1.4. Ästhetische Erfahrung statt Schönheit
1.4.1. Ästhetische Wahrnehmung
1.4.2. Ästhetische Eigenschaften und ästhetische Gegenstände
1.4.3. Ästhetik zwischen ästhetisch und künstlerisch
2.0. Was ist Kunst
2.1. Kunstbegriff und Essentialismus
2.2. Kunst – Nachahmung oder Ausdruck
2.2.1. Mimesis als Produktion
2.2.2. Mimesis und Repräsentation
2.2.3. Religiöse und profane Expression
2.3. Wahrheit und Unwahrheit der Kunst
2.4. Deskriptiver und normativer Kunst- und Kunstwerkbegriff
2.5. Zweckfreiheit und Selbstreferentialität der Kunst
2.6. Die Vielfalt der Künste
2.6.1. Ist Architektur eine Kunst?
2.6.2. Die Rangordnung der Künste
2.6.3. Die Interaktion der Künste – ihre Einheit
2.7. Kunst als ästhetische Kommunikation und das Verstehen von Kunst
2.8. Kunst als Kunstpraxis und als Institution
3.0. Was ist ein Kunstwerk
3.1. Produktionsästhetischer und rezeptionsästhetischer Kunstwerkbegriff
3.2. Kunstwerk als Intention
3.3. Das offene Kunstwerk
3.4. Das Kunstwerk als Zeichen
3.5. Die Frage nach dem ontologischen Status des Kunstwerks
3.5.1. Was für ein Gegenstand ist ein Kunstwerk
3.5.1.1. Das Kunstwerk als materieller Gegenstand
3.5.1.2. Das Kunstwerk als mentaler Gegenstand
3.5.1.3. Das Kunstwerk als abstrakter Gegenstand
3.5.1.4. Die Type-Token-Theorie
3.5.1.5. Das Kunstwerk zwischen Original und Vorkommnis
3.5.2. Artefakte – Kunstwerke – Kunstgegenstände
3.5.3. Kunst ohne Werk
4.0. Bild und Bildtheorie
4.1. Vom linguistic zum iconic turn
4.2. The power of image – Das Bild zwischen Magie und Nachahmung
4.2.1. Materialität und Bildobjekt
4.2.2. Oberfläche und Raumtiefe
4.2.3. Bildträger und Bildobjekt
5.0. Geschichte der Kunstphilosophie und Ästhetik – ein Resümee in systematischer Absicht
XI. Verzeichnisse
1.0. Sachverzeichnis
2.0. Namensverzeichnis
3.0. Literaturverzeichnis
3.1. Lexika, Nachschlagwerke, Abkürzungen
3.2. Konsultierte Literatur
4.0. Abbildungsverzeichnis
4.1. Abbildungsnachweise
4.2. Verwendete Abkürzungen der Museen
5.0. Danksagung