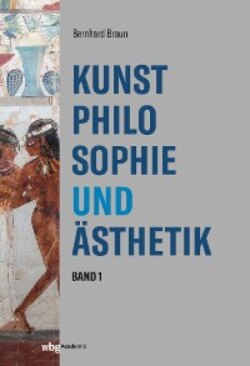Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.0. Die Anfänge der Kunst
ОглавлениеPuta 2015, 45
Der Beginn der Kunst liegt wie jener der Kulturgeschichte insgesamt im Dunkeln. Das ist sowohl unter historischen als auch unter systematischen Gesichtspunkten so. Denn es gibt keinen fixierten Kanon von Kennzeichen, mit denen man entscheiden könnte, was exakt als Kunst anzusprechen ist. Braucht es dazu Artefakte, genügen bewusst ausgewählte objets trouvés oder kann bereits ein Niederwerfen aus Schreck vor einem Donnergrollen oder der sengenden Hitze der Mittagssonne als Kunst angesprochen werden? Das Sprechen von Kunst hat immer mit geographischen, historischen und kulturellen Kontexten zu tun. Kunst ist in dieser frühen Zeit ein sehr weiter Begriff und man richtet unter diesem Titel den Blick mit einiger Großzügigkeit bereits auf die ersten Steinwerkzeuge in Form von »Geröllgeräten« (Chopper), also Steinabschlägen (vor etwa 2,5 Mio. Jahren), und die etwas späteren Knochenwerkzeuge. Eine strenge Unterscheidung von solchen Artefakten und Objekten, die jenseits der Nutz- und Gebrauchbarkeit angesiedelt sind, ist in diesen Zeiten nur schwer möglich und daher wenig sinnvoll. Auch wenn Werkzeuge dem Überleben dienten und kaum als Kunst in engerem Sinn anzusprechen sind, verweisen solche Gegenstände auf einen Kultur-Kontext. Steinwerkzeuge haben zu tun mit der Erschließung der anfangs kaum genützten Nahrungsressource Fleisch. Das eröffnete in einer noch weitgehend undifferenzierten Gesellschaft jedenfalls das große Kapitel Kultur: »Indem die frühen Vertreter der Gattung Homo ihre natürliche Körperausstattung durch selbstgefertigte technische Hilfsmittel zu erweitern begannen, […] schlug mit anderen Worten die Geburtsstunde der Kultur, und indem sich unsere Vorfahren seitdem kulturell und nicht mehr nur körperlich und genetisch an ihre Umwelt anpaßten, beschritten sie einen völlig neuen evolutionären Weg.«
Kuckenburg 2001, 31
Leroi-Gourhan 1988, 301
Das erste »Werkzeug« des Menschen war die Hand. An ihr arbeitete die Evolution. Schließlich stand der Mensch vor der Aufgabe, die Hand zu »verlängern«, um die sich stellenden Herausforderungen zu bewältigen. »Menschlich ist die menschliche Hand durch das, was sich von ihr löst […]«, bemerkte André Leroi-Gourhan treffend.
Puta 2015, 45
Floss 2015, 123
Die erste überragende Verlängerung der Hand in diesem Sinn war der Faustkeil, der von etwa 1,7 Mio. bis 50.000 in Einsatz war. Bei der Produktion dieses Instruments kam es zu einem deutlichen künstlerischen Mehrwert, sodass viele Forscher bereits von einer ausdrücklichen Handwerkskunst sprechen. »Prehistoric art can be proof of the fact that in the final phase of anthropogenesis people crossed over the utilitarian threshold of ›cultural reality‹ and began to create ›value culture‹.« Kunst im engeren Sinn sei entstanden, so diese Meinung, als Artefakte keine rein utilitaristische Funktion mehr hatten, sondern einen Mehrwert, der bereits als kulturelles Symbolsystem fungierte, wenn »modes of behaviour« auftauchten, »that went beyond the use of tools and other subsistence processes […].«
Doch solches ist naturgemäß schwer feststellbar, denn zu diesem Mehrwert gehört bereits ein einfaches Ornament. Noch aussichtsloser erscheint in solchem Kontext eine exakte Datierung. Lässt man Kunst in einem engeren Sinn mit der Ornamentierung beginnen, führen Funde einen bis auf etwa 250.000 Jahre zurück zu den Produzenten von Jagdwaffen, geschlagenen Feuersteinwerkzeugen, Knochenpfriemen: dem Homo erectus und dem Neandertaler.
Feustel 1987, 61 ähnlich Pochat 1996, 11
Huizinga 1939, 51 Gadamer 1974, 113
Inwieweit solche Ornamente symbolisch zu lesen sind oder gar als Manifestation einer »spezifisch geistigen Auseinandersetzung der Menschen mit ihrer natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt« gedeutet werden dürfen, ist eine schwierige Frage. Lässt sich in so früher Zeit in den schöpferischen Mehrwert ein ausdrückliches geistiges Programm hineindeuten, gar der Niederschlag eines Weltbildes? Oder stand am Anfang der Kunst ausschließlich der Zufall? Hat der Steinzeitmensch spielerisch Linien in den Sand gezeichnet, nur um dann – erstaunt über das »Ergebnis« – dieses Experiment weiter zu verfolgen? Gilt für den Beginn von Kunst und Kultur das homo-ludens-Konzept von Johan Huizinga, wonach der »Kultur in ihren ursprünglichen Phasen etwas Spielmäßiges eigen ist […]«? Ist es so, dass »menschliche Kultur ohne ein Spielelement überhaupt nicht denkbar ist.«
Puta 2015, 46
Das sind alles Fragen, für deren Beantwortung das Datenmaterial bei weitem nicht ausreicht. Manche Autorinnen sprechen angesichts der Schwierigkeiten lieber von Proto-Kunst als von Kunst: »Proto-art covers the non-utilitarian expressions of creativity that were made even before the onset of the Upper Paleolithic revolution and of the creative explosion that occurred outside the territory of what is now Europe.«
Der Vorteil einer solchen Unterscheidung ist, dass sich die große Periode der Kunst des Paläolithikums (3.) von den Vorläufern absetzen lässt. Trotzdem ist die Unterscheidung nicht ohne Willkür, denn natürlich ist schon das Werkzeug als solches Ausdruck einer spezifischen geistig-kulturellen Situation. Insofern erscheint es nicht unklug, im Sinne des oben vorgeschlagenen weiten Kunstbegriffs, Kunst- und Handwerk ungetrennt zu lassen. Dies gilt unter gewissen Hinsichten für jede Zeit bis zur Gegenwart. Eine künstlerische Gestaltung (allgemeiner: Form) – heute spricht man von Design – kann einen solchen Ausdruck der Zeit zu einem eigenständigen Ausdruck einer Kulturphase (Stil) verdichten. Ornamentik hatte in der Kunstgeschichte oft einen symbolischen Gehalt und war nicht nur eine belanglose Spielerei.
Wynn 1985, 41
Pringle 2013, 40
Geht man mit einem solchen methodischen Besteck an diese frühe Kunst heran, müsste man auch die Frage nach der ästhetischen Sensibilität in dieser Zeit stellen. Wie hat sich in der Evolution eine solche (also in erster Linie sinnliche) Sensibilität entwickelt? Dass die Anthropologen von einer parallelen Entwicklung von Sprache und Werkzeug ausgehen, wurde bereits oben erwähnt. Daher verweist die Handwerkskunst auch auf eine Intelligenzentwicklung bereits ab 1,5 Mio. Jahren hin. Das deckt sich mit der verbreiteten Meinung, dass die »Wurzeln der Schöpferkraft [scheinen] sogar schon […] vor dem Auftritt des Homo sapiens vor knapp 200.000 Jahren« zu liegen scheinen.
Dieses Thema ist naturgemäß hoch umstritten, wird kontrovers diskutiert und durch neue Funde immer wieder aktualisiert. In El Greifa in der libyschen Sahara fanden deutsche Wissenschaftler vor kurzem 200.000 Jahre alte Perlen aus Straußeneierschalen. Solche waren bisher allenfalls mit einem Alter von 50.000 Jahren bekannt. Wenn im älteren Paläolithikum bereits Schmuck hergestellt wurde, könnte man daraus schließen, dass es zu dieser Zeit bereits eine Form sozialer Hierarchie der Gesellschaft und/oder ein (je nach Deutung des Sinnes dieses Fundes) religiös-magisches Denken (Talisman) gegeben hat.
Figurstein
Wegen der Bedeutung solcher Artefakte bedarf es auch einer Kennzeichnung dessen, was als Artefakt gelten kann. 1981 wurde auf den Golanhöhen die etwa 250.000 Jahre alte sogenannte »Proto-Venus« (Venus von Berekhat Ram) ausgegraben. Es handelt sich um einen 3,5 cm großen Tuffstein, der einer venusartigen Frauenfigur ähnlich ist. Zahlreiche Untersuchungen ergaben, dass es sich um einen von Menschen nachbearbeiteten Stein handelt. Die Auszeichnung des bislang ältesten »Kunstwerks« der Geschichte für diesen »Figurstein« kann freilich nur bedingt vergeben werden. Denn über die Bedeutung oder die Symbolik dieses Fundstücks sind keine seriösen Aussagen möglich. Trotzdem sollte zumindest der Kandidatenstatus erhalten bleiben. Das Alter passt größenordnungsmäßig zu Funden von Ornamentierungen. So gesehen hätte der Zeitraum vor etwa 250.000 Jahren für den Beginn der Kunst beim heutigen Stand der Kenntnisse einiges für sich.
Keinen Konsens gibt es hingegen darüber, ob bloß von Menschen aufgelesene, von der Natur geformte figurale Steine (die aus solchen Zeiträumen in größerer Zahl bekannt sind) bereits als Kunstwerke zu betrachten sind. Martin Kuckenburg schlägt durchaus nachvollziehbar zumindest die Einordnung als Objekte der Kultur vor: »Dieser ›Gebrauch‹ und die darin zum Ausdruck kommende Wertschätzung verwandelte sie von reinen Natur- in vollwertige ›Kulturobjekte‹ […].«
Kuckenburg 2001, 128
X.3.2.
Derartige Funde reichen weit in die Geschichte zurück. Das Gesicht von Makapansgat (vielleicht vom Australopithecus africanus) wird auf das unglaubliche Alter von 3 Millionen Jahren geschätzt und die in der marokkanischen Sahara gefundene, 5,9 cm große Sandstein-Figur eines menschlichen Körpers (Steinfigur von Tan-Tan) ist vielleicht eine halbe Million Jahre alt und stammt vermutlich vom Homo erectus. In beiden Fällen ist eine menschliche Nachbearbeitung nicht festzustellen. Aber die Bewunderung von objets trouvés, ihre Einordnung in einen mentalen Kosmos, ist eine Tätigkeit der Kultur und vielleicht auch eine der Kunst. Diese Einordnung hängt nun eher an systematischen Fragen nach dem Wesen der Kunst. Wenige Probleme, solche objets trouvés als Kunstwerke zu betrachten, hat die Intentionstheorie der Kunst.
Sphäroid
König 1973, 32 Mahlstedt 2004, 106
Für den Philosophen erregend ist der Gedanke, dass zu diesen ersten Kulturwerken die Sphäroide gehören, die bis auf 300.000 Jahre zurückreichen, ebenfalls Fundstücke, aber meist durch Abschläge in ihrer Form perfektioniert. Wie schon beim Feuer ist auch bei der Geometrie des Kreises und der Kugel, die von den Gestirnen Sonne und Mond dominant vorgegeben ist, die Verführung groß, den frühesten Vorfahren Welt- und Kosmosdeutungen zu unterstellen: »Sollten wir mit ihnen die früheste Objektivierung der weltinterpretativen Grunderfahrung gefunden haben?«, fragt sich Marie König. Sphäroide tauchen auch im Neolithikum in großer Fülle auf und werden dort als »Ursprungszeichen des Lebens« interpretiert.
VIII.3.2.3./IX.6.1.1.f.
Folgte man solchen Mutmaßungen, dann hätte es schon an der Wiege der Menschheit eine Verehrung der Vollkommenheit der Kugel gegeben, die uns über die gesamte Kulturgeschichte begleitet, über frühgeschichtliche Schädelkulte, frühe philosophische und kosmologische Erzählungen bis zur neueren Architekturgeschichte, von der sogenannten Revolutionsarchitektur des 19. Jh.s bis zu den Sphäroiden Richard Buckminster Fullers. Zudem wäre dies, einige Jahrhunderttausende vor unserer Zeit, die einzige wirklich »authentische« Verehrung der Kugel. Alle späteren Kulte könnte man als reflektierte kulturelle Erzählungen werten in einer Zeit, die bereits zwischen Oben und Unten, Diesseits und Jenseits differenziert hat.
Leroi-Gourhan 1988, 351
Diese frühen Kunstwerke samt ihren dahinter liegenden Weltbildern stammen aus einer Zeit vor dem Auftreten des Homo sapiens. Das macht die Funde so außergewöhnlich und ihre Bewertung zusätzlich brisant. Die Fragen der paläoanthropologischen Forschung führen nicht zuletzt in das philosophische Unterholz der Naturalismusdebatte. Unbestritten scheint, dass die Evolution mit der Bevorzugung von Gesichts- und Gehörsinn die Weichen für die künftigen Kunstformen gestellt hat. »Man stelle sich nur einmal vor, wie die Ästhetik beschaffen wäre, wenn der Tastsinn […] oder der Geruchssinn die primären Sinne geworden wären; ›Syntaktien‹ oder ›Olfaktien‹ wären möglich geworden, Gemälde aus Gerüchen und Symphonien aus Berührungen, Bauwerke aus harmonischen Schwingungen, Gedichte aus Salzen und Säuren […].« Was André Leroi-Gourhan hier mit viel Phantasie ausmalte, fand in der späteren Metaphorik durchaus einen gewissen Raum in Architektur und Kunst. Eine Barockkirche kann als gebaute Schwingung und materialisierter Klang angesprochen werden.
VII.3.4.
IX.5.2.6.1.
Trotz dieser unüberwindbar scheinenden Schwierigkeiten sollten Fragen nach dem Antrieb künstlerischer Tätigkeit und nach dem dahinter liegenden »Weltbild« nicht aus methodischer Vorsicht vollkommen ausgeblendet werden, so spekulativ die Antworten auch bleiben mögen. Ähnlich wie in der Archäologie aus dem Fundkontext gerissene Stücke wenig Aussagekraft besitzen, sind Kunst- und Bauwerke nichts weiter als materialisierte Screenshots einer performativen Situation. Kunst war über weite Strecken immer performativ. Erhalten geblieben sind indes lediglich die materiellen Teile. Aber diese sind nichts weniger als Zeichen von Weltdeutung, damit Teile von Kultur und erst für ein so interpretiertes vestigium hominum ist es letztlich Wert, irgendwo »an Land zu gehen«. Daher werden in der einschlägigen Literatur solche Fragen zu Recht beherzt angegangen.
Leroi-Gourhan 1988, 146
Conard 2011
André Leroi-Gourhan vermutet im Angesicht nur spärlicher archäologischer Daten den Eintritt in »die Welt des symbolischen Denkens« bei den Neandertalern. Künstlerische Äußerungen setzen wohl Gefühle und die Fähigkeit zur Artikulation von Gefühlen voraus. Dass es nach dem Erlegen eines großen Tieres zu Ausbrüchen von Freude kam und man dies vielleicht in Tänzen zum Ausdruck brachte, ist ebenso plausibel wie die Nachahmung von Geräuschen und Formen der Natur, die man als angenehm empfand. Wann der Mensch als animal symbolicum begann, diese realen Erscheinungen der Natur symbolisch zu überhöhen, das heißt dann auch, wann Menschen begannen, ihre Existenzängste durch eine frühe Form der Religion zu kompensieren, bleibt Gegenstand der Diskussion um die Interpretation der Funde. Ganz generell ist dem Ausgräber der bislang ältesten plastischen Kunstwerke der Welt in der Schwäbischen Alb, Nicholas Conard, zuzustimmen, wenn er meint, dass es keinen plausiblen Grund gibt, »warum die Intensität der religiösen Wahrnehmung und der damit verbundenen Gefühlswelt wesentlich anders gewesen sein soll als unsere heutige.«
Immerhin gab es in dieser frühen Zeit Bestattungsrituale, die zumindest mit einem gewissen Maß an Affektivität, wenn nicht sogar mit einer religiösen Gefühlswelt in Verbindung gebracht werden könnten. Die Ansicht Conards entspricht einer Korrektur der fortschrittsaffinen Entwicklungstheorien des 19. Jh.s und sie wird von vielen Forschern geteilt.