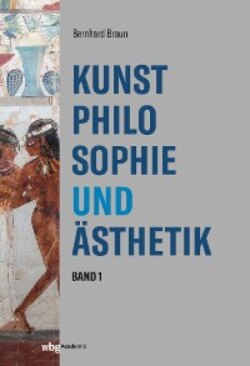Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.0. Out of Africa – Kontexte
ОглавлениеEs mag überraschen, aber die Paläoanthropologie ist durch reiche Funde, die immer wieder zu weltweit angeregten Diskussionen Anlass geben und scheinbar bewährte Hypothesen in Frage stellen, eine außerordentlich dynamische Wissenschaft. Viele der einschlägigen Theorien haben zwar eine kurze Verfallszeit, dennoch erfahren einige durch die ständigen neuen archäologischen Befunde von verschiedenen Seiten eine bemerkenswerte Bestätigung.
Nach der gängigen Theorie ist der anatomisch moderne Mensch (Homo sapiens) aus (Ost-)afrika nach Asien und Europa gewandert (Out-of-Africa-Theorie). Damit bestätigt die neuere Forschung eine Mutmaßung, die bereits Charles Darwin angestellt hatte. Für die Entstehung dieses Menschentyps in Ost- und Südafrika wird aufgrund von Funden in Äthiopien und Messungen mit der sogenannten molekularen Uhr (Mutationsrate einer Population) meist der Zeitraum vor etwa 200.000 Jahren angegeben (manche postulieren noch einen einige hunderttausend Jahre älteren früharchaischen Homo sapiens als Vorgänger). Neuere Funde von Fossilien mutmaßlich eines Homo sapiens in Marokko (Jebel Irhoud) haben die Diskussion um das Alter des Homo sapiens neuerlich in Bewegung gebracht. Sowohl das Alter von etwa 300.000 Jahren als auch der Fundort Nordafrika passt schlecht in das bisher gängige Schema. Der Stammbaum dieses modernen Menschen ist durch zahlreiche Arten sehr komplex und dementsprechend umstritten.
Die Stammesgeschichte des Menschen begann mit der Trennung der Homini von den Schimpansen, die dann eine jeweils eigenständige Evolution durchlaufen haben. Die heute bevorzugte Terminologie unterscheidet die Homini (Menschen) von den Hominiden (Menschenaffen; früher Ponginae). Von etwa zwei Dutzend Menschenaffenarten sind heute nur mehr vier (Schimpanse, die davon unterschiedenen Bonobos, Gorilla, Orang-Utan) übrig geblieben. Als Zeitpunkt der (dauerhaften!) Trennung gilt nach mehreren neuen Funden, Berechnungs- und Messmethoden etwa 6 bis 7 Mio. Jahre, allerdings mit großen Unsicherheiten. Die meisten Forscher gehen von einer langen Parallelexistenz verschiedener Arten aus und halten lineare Stammbäume für überholt. Sie sprechen lieber von einem »Stammbusch« als von einem Stammbaum.
Aus diesem Stammbusch wurden in den vergangenen Jahrzehnten von spektakulären Entdeckungen berichtet. Besonderes Aufsehen erregten die Funde des rund 6 Mio. Jahre alten »Millennium-Man« Orrorin tugenensis im Jahr 2000 in Kenia und jene von Sahelanthropus tchadensis und Ardipithecus kadabba im Jahr 2001 mit ähnlichem Alter. Auch die Entdeckungen im Afar-Dreieck Äthiopiens wurden populär. Darunter war der 4,4 Mio. alte »Ardi« (Ardipithecus ramidus), der vielleicht ein Vorfahre der nach einem Beatles-Song benannten 3 Mio. Jahre alten »Lucy« war (Typ des Australopithecus afarensis). 2013 fand man in einer Höhle in Südafrika Knochenreste des Homo naledi. Es handelt sich um eine (zur Abfassungszeit dieser Zeilen) noch nicht datierte Mischform aus Hominiden und modernem Menschen.
Bei den erwähnten Funden handelt es sich um aufrecht gehende Vorfahren, die aber noch große Teile der Zeit auf Bäumen gelebt haben dürften. Von ihnen sind die Australopithecinen (4 bis 2 Mio. Jahre), denen man erste Steinbearbeitung zuschreibt, mit vielen Unterformen, die bedeutendsten. Als erster Feuerbenützer gilt der Homo erectus (ab etwa 2 Mio. bis 90.000 Jahre), der in den Stammbaum sowohl des europäischen Neandertalers als auch des Homo sapiens gehört. Die Vorgänger des Homo sapiens wurden letztlich alle deutlich älter, als es der moderne Mensch bislang ist. Erste handwerkliche, künstlerische und damit kulturelle Tätigkeiten begannen weit vor dem derzeit lebenden Menschentyp.
Beaumont 2011
Frazier 1930
Die Feuernutzung wurde jüngst nach Funden in der Wonderwerk-Höhle und in der Swartkrans-Höhle in Südafrika auf etwa 1 Mio. Jahre zurückdatiert. Zu diesem Thema gibt es lebhafte Debatten. Viele Autoren erliegen der magischen Anziehung des Feuers und können sich nicht vorstellen, dass nicht auch Menschen in sehr frühen Zeiten diesem Zauber erlegen sind. Der erste technische Umgang mit dem Feuer ist schwierig nachzuweisen, er wird aber mit großem Konsens jedenfalls in die Zeit des Altpaläolithikums, also etwa vor 2 bis 2,5 Millionen Jahren bis etwa 300.000 Jahren, datiert.
Leroi-Gourhan 1988, 150
Aus dieser Zeit stammen auch erste Steinwerkzeuge. Viele Anthropologen, unter ihnen André Leroi-Gourhan, sehen einen Zusammenhang von Werkzeug- und Sprachentwicklung: »Der organische Zusammenhang erscheint stark genug, um dem Australopithecus und dem Archanthropus eine Sprache zuzugestehen, die dem Niveau ihrer Werkzeuge entspricht.« In der Tat dürfte die Entwicklung der Sprache einige Millionen Jahre zurückliegen und sowohl der Homo erectus als auch der Neandertaler werden über Sprache verfügt haben, wenngleich diese nicht so effizient war wie unsere.
In mehreren Wanderungsschüben gelangten die Homini nach Eurasien. Der Homo erectus war offenbar der erste Wanderer. Er lässt sich vor 1,5 Mio. Jahren in China und Indonesien nachweisen und ab 800.000 in Europa. Vor etwa 1 Mio. Jahren dürften der neu entdeckte Denisova-Mensch, vermutlich ein entfernter Vorläufer des Neandertalers, und wenig später eine andere Vorform des Neandertalers (der sich nur in Europa entwickelt hat) gewandert sein.
Gabunia et al. 2000
Diese Ordnung der »vormodernen« Vorgänger, die weitaus länger existierten als der heute lebende Homo sapiens und die in mehreren Schüben schon weit vor der Besiedlung durch den modernen Menschen aus Afrika nach Europa vorgestoßen waren, wird durch neuere Funde nochmals komplexer. Der im Atapuercas-Höhlensystem in der Nähe von Burgos gefundene Homo antecessor lässt sich bis auf 1,2 Mio. Jahre zurückdatieren. Im Burghügel von Dmanisi in Georgien stieß man gar auf zwei Millionen Jahre alte Erectus-Fossilien, der bislang älteste Nachweis einer ersten Auswanderungswelle aus Afrika, wobei die genaue Zuordnung unklar ist. Diese vielfältige globale Besiedlung hat bislang die (alte) These eines multiregionalen Ursprungs des Homo sapiens nicht gestützt, sie verliert gegenüber Out of Africa deutlich an Boden.
Armitage et al. 2011
Offenbar zwischen 95.000 und 60.000 wanderte der moderne Mensch nach Asien und Europa. Hans-Peter Uerpmann hat neuerdings diese Wanderung auf 125.000 vorverlegt und auf Grund von Funden menschlicher »Spuren« in Form von Steinwerkzeugen zudem eine zweite Wanderungsroute vorgeschlagen. Demnach sei die Einwanderung nicht nur über den üblichen Korridor Sinai-Israel (»levantinischer Korridor«) verlaufen, sondern auch durch den angesichts der globalen Eiszeit (von etwa 200.000 bis 130.000) nur schmalen und passierbaren Bab al-Mandab, also durch das Rote Meer auf die damals fruchtbare arabische Halbinsel. Bisweilen erscheint in der neueren Forschung dieser Zugang zu Eurasien sogar plausibler zu sein. Über das mögliche Zeitfenster einer solchen Meeresdurchquerung und die Herkunft der gefundenen Werkzeuge gibt es eine angeregte Diskussion. Funde von Schädelteilen eines Homo sapiens in Israel (Misliya-Höhle), dessen Alter 2018 auf etwa 180.000 Jahre eingegrenzt werden konnte, hat die Datierungsfrage neuerlich durcheinandergewirbelt und jenen Forschern Auftrieb gegeben, die von mehreren Wellen einer Auswanderung aus Afrika ausgehen.
Mellars 2006 Macaulay 2005
Kuckenburg 2001, 160f
Puta 2015, 50 vorsichtiger Leitner 2015, 104
In Europa ist der moderne Mensch jedenfalls seit etwa 45.000 – später als in Asien und Australien – nachweisbar. Er lebte dort parallel mit unabhängig entstandenen aufrecht gehenden Homini wie dem Neandertaler, der vor etwa 30.000 Jahren ausstarb. Stoff für angeregte Debatten liefert die Frage nach dem kulturellen Niveau dieser Homini. Inzwischen vermutet man – anders als früher – beim Neandertaler Sprechfähigkeit und im Sinne der oben erwähnten Kongruenz auch erhebliche technische und künstlerische Fertigkeiten. Man konnte die Benützung von Farbe und die anspruchsvolle Handhabung des Birkenpechs, des ältesten Klebe- und »Kunststoffs«, nachweisen. Eine 1995 in einer Höhle Divje Babe beim slowenischen Cerkno gefundene Flöte wird Neandertalern zugeschrieben. Vermutlich stellten sie Schmuck her und führten Körperbemalung durch. »[…] Neanderthals stood at the very threshold of creating a symbolic culture.« Diskutiert wird allenfalls noch, ob das autochthone Leistungen waren oder durch die Begegnung mit dem modernen Menschen ausgelöst wurden. Eine Verbesserung der Fundsituation aus einer Zeit vor dem Auftreten des modernen Menschen wird helfen, diese Frage zu entscheiden.