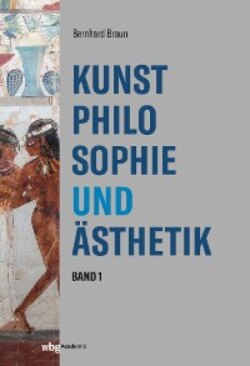Читать книгу Kunstphilosophie und Ästhetik - Bernhard Braun - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.0. Methodische Vorbemerkung
ОглавлениеDas Verhältnis zwischen historischem (Abschnitte I–X) und systematischem Teil (Abschnitt X) scheint bei Betrachtung des Inhaltsverzeichnisses völlig unausgewogen. Sollte dieser Eindruck aufkommen, handelte es sich allerdings um ein Missverständnis. Geschichte und Systematik sind in meinem Verständnis kein Gegensatz. Die ideengeschichtliche Sicht auf die Geschichte ist stets von systematischen Interessen geleitet, während eine Systematik ohne historisches Fundament eigenartig abgehoben bleibt. Im Folgenden werden daher im geschichtlichen Teil unentwegt systematische Fragen abgearbeitet. Im Abschnitt X geht es um eine resümierende Zusammenführung der zahlreichen Positionen unter systematischen Gesichtspunkten und um die Aufarbeitung von Fragen, die bis dahin keinen rechten Ort der Darstellung gefunden haben, wie allgemeine Fragen nach der Kunst, dem Kunstwerk, dem Schönen oder nach den Begriffen Kunstphilosophie und Ästhetik generell.
Zu den methodischen Bemerkungen gehört, ähnlich wie beim Impressum von Druckwerken, die Offenlegung der eigenen methodischen Position sowie der präferierten Schulrichtung. Gehört Erstgenanntes zum Standard, ist die Offenlegung der philosophischen Ausrichtung keineswegs selbstverständlich. In aller Regel operieren Kolleginnen und Kollegen nämlich meist unreflektiert im Rahmen ihrer methodischen Position, sei es eine phänomenologische, hermeneutische, idealistische, materialistische, existentialistische, strukturalistische, poststrukturalistische, positivistische, analytisch-sprachphilosophische etc., und erwecken dabei den Eindruck, ihre Position entspreche dem gängigen philosophischen Tagesgeschäft. Das Problem dabei ist, dass die eingenommene Position auch das Ergebnis mitbestimmt.
Connelly 2007, 276
Zum Unterschied von vielen meiner Kolleginnen konnte ich mich nie exklusiv für eine bestimmte philosophische Schule erwärmen. Mein Problem dabei waren die zwangsläufigen Engführungen, in die jede Position früher oder später führt, was letztlich, etwas geschwollen ausgedrückt, zu einem Verlust der Lesbarkeit von Welt führt. Bei der vorliegenden Darstellung empfand ich diese Einstellung als Vorteil. Denn es ist mein Anliegen, soweit das im gegebenen Rahmen möglich ist, die verschiedenen methodischen und philosophischen Positionen in ihren Eigenarten, ihre Stärken und Schwächen zu würdigen. Die Darstellung der verschiedenen Inhalte umfasst daher auch die Darstellung der verschiedenen Methoden, mit denen die jeweiligen Inhalte eine unterschiedliche Bewertung erfahren. Wie einem das oft passiert im Leben eines Wissenschaftlers, habe ich diesen Gedanken bei einem anderen in so pointierter Formulierung gefunden, dass ich es selbst nicht besser zu sagen vermöchte: »Like tools in a tool kit, different methods can be used to achieve different results. The multimethodological approach allows for checks an balances, as well as for surprises, opening up new possibilities that could never have been anticipated in advance.«
X.2.1.
Auch wenn ich mich keiner philosophischen Schule im engeren Sinn zugehörig fühle, bedeutet das nicht, dass ich nicht für bestimmte Methoden mehr und für andere weniger Sympathie bekunde und von ihnen in verschiedener Intensität angeregt worden bin. In der Philosophie haben Ideen der Poststrukturalisten manch heilsames Erweckungserlebnis im Schlummer eines scheinbar sicheren Koordinatensystems ausgelöst. Gleichwohl bin ich einem rudimentären Idealismus dort verhaftetet geblieben, wo es schlicht um den Sprachgebrauch geht. Ich werde im Folgenden von der bildenden Kunst, der Architektur und den Kunstwerken sprechen, wenngleich ich natürlich um die Problematik solcher Verallgemeinerungen weiß und mich mit dieser an entsprechender Stelle auseinandersetzen werde. Und die Ausrichtung auf kulturelle Erzählungen impliziert, dass man die Augen vor konstruktivistischen Aspekten bei deren Formulierung nicht verschließt.
Nach dem bisher Gesagten bündelt sich mein methodisches Vorgehen in fünf Punkten: (1) Es geht um die Akzeptanz von Interdependenzen kultureller Erzählungen, also der Verstrickung von Kunst und Architektur in die Kulturgeschichte, als notwendige Voraussetzung für eine ideengeschichtliche Betrachtung von Kunstphilosophie und Ästhetik. (2) Solche Interdependenzen basieren auf dem im letzten Kapitel beschriebenen Kulturbegriff als ein Gewebe selbstgesponnener (damit eben auch konstruierter) Erzählungen. Er vermeidet einen Essentialismus und ist für die vorliegende Untersuchung leitend, auch wenn der Ausdruck Kultur im Folgenden (letztlich aus Gründen der Bequemlichkeit und besseren Kommunizierbarkeit) eher pragmatisch verwandt wird. Dabei steht (3) bei allen zu konstatierenden Diskontinuitäten und Brüchen die Kontinuität der europäischen Kulturgeschichte im Vordergrund. (4) Die Untersuchung wahrt, wie gerade festgestellt, Abstand von einer methodischen Monokultur und versucht die Vielfalt der philosophischen und methodischen Positionen, wenn schon nicht darzustellen, dann jedenfalls möglichst fair im Blick zu behalten. Schließlich sei (5) darauf hingewiesen, dass es, wie das bei allen großen Überblickswerken aus einer Hand so ist, nur in jenen Fällen um eigene Quellenforschung geht, die gerade auf dem Weg meiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit Philosophiegeschichte lagen. Über weite Strecken stand die Literaturforschung im Vordergrund. In beiden Fällen war es mir wichtig, verschiedene Forschungsergebnisse möglichst unvoreingenommen zu einer Synthese zu führen, aber sie dann doch im Lichte der großen Erzählung auch aus eigener Urteilskraft zu bewerten.