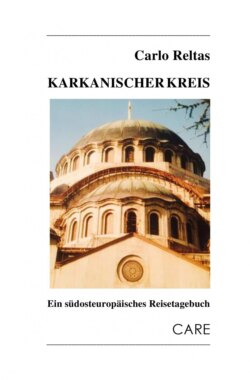Читать книгу Karkanischer Kreis - Carlo Reltas - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
In der Holzklasse nach Moldawien
ОглавлениеKaum hat man den Zug bestiegen – es gibt Holzklasse und Video, was immer das heißen mag, etwa ICE-Standard? – da beginnt das allgemeine Geraschel in den Plastiktaschen. Die meisten Fahrgäste in der Holzklasse sind ältere Damen, die für ihre Familien auf Einkaufstour waren, schwer bepackt mit den zur Jahrtausendwende typischen voluminösen Plastikkoffern der osteuropäischen Marktfrauen. Deren Last ist in der Regel auf ein Rollgestell geschnallt. Das Geraschel wird potenziert durch die Original-Plastikverpackungen der neu erstandenen Textilien, die frau sich schon einmal vor den schweren Busen hält, um der Nachbarin das Teil vorzuführen.
Nächster Auftritt: Ein älterer Herr taucht auf, er hat ebenfalls eine Plastiktasche geschultert und in der Hand eine durchsichtige Tüte mit Druckerzeugnissen: Gasety (Zeitungen), Magazine, Kriminalromane und … Dr. Nostradamus! Die uralten Kamellen des größten Schwarzmalers der Geschichte finden immer noch Absatz. Der Zeitungsverkäufer kassiert für seine Billigprodukte Kopeke auf Kopeke.
Dritte Szene: Tante Natascha tritt ins Abteil, und zwar mit einem riesigen Pappkarton, darin Kuchen, Kuchen, Kuchen, Kuchen, andere Süßigkeiten für den kleinen Hunger, Kekse in Staniolverpackungen, auch Eis und Schokolade. Das wäre seine allerletzte Gelegenheit zur Proviantierung gewesen, aber Karl hat seine übrig gebliebenen Griwna bereits am frühen Morgen im ultramodernen Supermarkt verprasst, ebenfalls für Kekse, Schokolade, Limonade, Mineralwasser – die Standardausstattung eben. Der Dieselmotor läuft an. Tante Natascha verkauft weiter. Die geschäftstüchtige Dame hat gute Nerven und schafft es noch rechtzeitig von Bord.
Vor dem Einsteigen war Karl erneut einen Moment irritiert. Als Zielort war an Gleis 2 zwar Kischinewa angegeben (mindestens die dritte Schreibweise), aber die Zugnummer lautet 641 statt 642 und als Uhrzeit steht daneben 11.17 Uhr. Offenbar sind das die Ankunftszeit des Pendelzugs aus Moldawien und die Zugnummer für die Herfahrt.
Mittlerweile breitet eine Babuschka ihre gekauften Textilien gerollt auf ihrer Sitzbank aus und macht sich lang, ihre Mitfahrerin gegenüber ebenfalls. Pünktlich um 11.48 Uhr setzt sich die Waggon-Karawane in Bewegung. Da darf sich Karl ja wohl ebenfalls auf seiner Sitzbank am Ende des Abteils ausstrecken. Aus Odessa heraus geht es vorbei an einer großen, vor sich hin rostenden Industrieanlage und Kleingärten mit Datschen auf der anderen Seite.
Der Schaffner kommt. Alle zeigen brav ihre Fahrkarten. Die beiden Babuschkas schlummern bereits. Der Uniformierte stupst eine an, die langsam, langsam zu sich kommt. Ihrer Freundin verpasst sie einen Klaps und zeigt auf die Amtsperson. Die Geschäftsfrau sortiert die Innentasche ihrer Windjacke und holt ein Bündel Banknoten heraus. Sie reicht dem Schaffner ein paar davon. Als er leicht protestiert, weist sie auf ihr reichliches Gepäck, als ob sie sagen wollte, dass sie sich damit nicht auch noch um eine Fahrkarte kümmern konnte. Der Kondukteur steckt das Geld ein, ohne ein Billet ausgehändigt zu haben. Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, dass er leicht widerwillig das Gesicht verzieht, als ihm die immer noch blonde Großmutter das Bargeldgeschäft aufnötigt und er sich schließlich milde darauf einlässt.
Der Zug rollt an dörflicher Szenerie vorbei. Sieht so das Vorbild für das „Kumanets“ aus? Teppiche hängen auf der Stange, Enten watscheln über den Hof, weit und breit keine Dorfschöne im bunten Sonntagsstaat – Alltagsrealität fern der Verklärung im schicken Folklorerestaurant. Nach kurzem Stopp in Rosdilna geht es weiter Richtung Grenze.
Die Grenzkontrollen verlaufen etwas komplizierter, da die Kontrolleurin und ihr bewaffneter Assistent nur Russisch sprechen. Nachdem sie einen Dritten hinzugezogen haben, bekommt Karl eine Immigration Card, wo er alles Wesentliche (Passnummer, Visumsnummer, Verkehrsmittel: Zug Nummer 642) auf Kyrillisch einzutragen und zu unterschreiben hat. Nachdem alles mit dem Visum verglichen ist, bekommt er einen Stempel und ein freundliches Bye-bye der wasserstoffblonden Dame. Der Zöllner, der wenig später aufkreuzt, spricht zu Karls Überraschung ein paar Worte Deutsch. Trotzdem sagt Karl, während er mit dem Finger auf seine Taschen zeigt, „Odeschda“ (Kleidung) und „Knigi, Slawari“ (Bücher, Wörterbücher). Er will noch wissen: „Haben Sie Devisen dabei?“ Als Karl ihm einen vornotierten Zettel mit dem Dollar- und dem Euro-Betrag vorweist, ist er zufrieden und will die Valuta noch nicht einmal sehen. Er fragt noch: „Wo leben Sie? Berlin?“ Und Karl sagt „Ja“, um ihn nicht noch mit den Besonderheiten eines Zweitwohnsitzes in der Hauptstadt und einem Familienwohnsitz am Siebengebirgsrand nahe der alten Bundeshaupstadt Bonn zu verwirren.
Bei der Weiterfahrt sieht er als Nächstes bewässerte Felder in einem breiten, flachen Tal. Die Autostraße, die Moldawien mit der Ukraine verbindet, verläuft hier parallel zur Bahnstrecke.
Ein gemütlicher, würdevoller Mann – man könnte ihn für einen Grundschulrektor halten – kommt als Oberkondukteur und kassiert nach, während der Zug nach Tiraspol hineinfährt. Von dieser zweitgrößten Stadt Moldawiens, die der prorussischen, praktisch abgespaltenen Region Transnistrien als Hauptstadt dient, sieht Karl vor allem große Wohnblocks, zum Teil noch im Rohbau. Riesenrohrleitungen begleiten die Bahnreisenden hinter Tiraspol und zeugen davon, dass in Transnistrien die Schwerindustrie Moldawiens beheimatet ist oder besser: war. Denn das vorwiegend russischsprachige Transnistrien ist seit den 90er Jahren de facto ein eigener Staat, auch wenn es offziell von keinem anderen Land anerkannt worden ist, auch nicht von seiner großen wirtschaftlichen und militärischen Stütze Russland.
Ganz am Westrand von Tiraspol fällt ein großer Sportkomplex dem Bahnreisenden auf. Ein blitzsauberes Fußballstadion steht in der Mitte, davor entstehen eine fast genauso große Sporthalle und ein weiteres Stadion mit Laufbahn. Bauherr ist der Sheriff-Konzern, der größte private Arbeitgeber Transnistriens, nach dem der Sportkomplex auch benannt ist. „Sheriff“ besitzt eine Tankstellenkette, Supermärkte, Großbäckereien, eine Baufirma und Vieles mehr, vor allem aber ausgezeichnete Beziehungen in die Politik dieses De-facto-Staates. Seit Eröffnung des Stadions im Jahr 2002 spielt dort der Profifußballverein Sheriff Tiraspol, und zwar – Karl kann es nicht fassen – trotz der komplizierten politischen Lage in der höchsten gesamtmoldawischen Liga! [Anmerkung 2016: Die „Sheriffs“ sind sogar der moldawische Rekordmeister mit 14 Titeln zwischen 2001 und 2016.] Der Konzern verdankt seinen Namen im Übrigen der früheren Tätigkeit der Unternehmensgründer. Sie waren zu kommunistischer Zeit – ja was wohl? – Polizisten.
Hinter Bender, der mit Tiraspol zu einer Agglomeration verwachsenen zweitgrößten Stadt Transnistriens, hält der Zug an einer kleinen Bahnstation ohne Namensschild in einer sanften Hügellandschaft. Die ausgestiegenen Bahnbeamten treffen sich zu einem Schwätzchen unter weit ausladenden Bäumen. Ein Knabe verkauft den Passagieren Weintrauben aus einem Eimer – eine ländliche Bilderbuchidylle. An diesem bukolischen Ort hält eine mittelalte grauhaarige Frau laute Volksreden. Die Mitreisenden schweigen betreten. „Beschwert sie sich über die politische Lage und die Lebensverhältnisse?“ fragt sich Karl. Das einzige Wort, das er aufschnappt, lautet „mapгapин“ (Margarine).
Das Schwätzchen der Bahnbeamten zieht und zieht sich. Nach längerem Aufenthalt geht es weiter. Karl sorgt sich nicht um die politische Lage, sondern darum, ob er den Anschlusszug nach Bukarest noch erreichen kann. Die Landschaft ist wieder von Kleinlandwirtschaft geprägt. „Socoleni“ ist der erste Bahnhof mit Namensschild in lateinischer Schrift, die hier das Kyrillsche abgelöst hat. Karl dämmert, dass der Zug seinen längeren Zwischenstopp wohl an der – eigentlich gar nicht existierenden –Grenze zwischen dem vorwiegend rumänischsprachigen Moldawien und seinem völkerrechtlich als eigener Staat inexistenten, mehrheitlich russischsprachigen Teil Transnistrien eingelegt hat. Fatalistisch schaut er auf die Kleingärten zur Rechten und die großen Felder zur Linken.
Als der internationale Bummelzug etwa um 17.10 Uhr in der Hauptstadt – rumänisch Chişinǎu, russisch Kischinew – eintrifft, ist der Bukarest-Express, wie befürchtet, schon abgefahren. Karl begibt sich von der Holzklasse direkt in den Weltraum. Er schnappt sich seinen Rucksack und geht – vorbei am armseligen Flohmarkt neben dem Bahnhof – zu Fuß die paar hundert Meter über den Juri-Gagarin-Boulevard hinüber zum Luxushotel namens COSMOS. Dessen Turm reckt sich phallisch in den Himmel, von dem einst (1961) Juri Gagarin als erster Mensch weiter in den Weltraum flog.