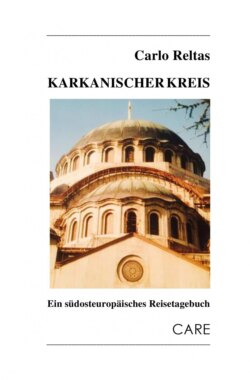Читать книгу Karkanischer Kreis - Carlo Reltas - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Oleg – Cicerone von Černivci
ОглавлениеOleg steht an der Bahnsteigkante, ein großer, dunkelblonder Mann von etwa dreißig Jahren, eher Ende zwanzig. Karl ist er sofort aufgefallen. Denn die meisten anderen Wartenden schnattern miteinander, Marktfrauen mit riesengroßen Plastikreisetaschen von geringem Eigengewicht, prall gefüllt mit westlich-modischer Billigware aus den Supermärkten und Kaufhäusern Polens, die sie Gewinn bringend auf den fliegenden Märkten ihrer ukrainischen Heimat weiter zu verkaufen gedenken. Er dagegen geht in Gedanken verloren auf dem Perron von Przemysl auf und ab.
In dieser polnischen Grenzstadt war Karl nolens, volens dem Zug entstiegen. Spurwechsel! Die Transitreisenden müssen über drei durchgehende Bahnkörper hinübergehen zu einer Gleisanlage, die dort beginnt. Da gehen die Züge nach Osten in die Ukraine ab. Doch zwischen Ankunft und Weiterfahrt war ihm eine knappe Stunde Zeit geblieben, um der immer noch habsburgisch geprägten Altstadt dieser ehemals größten Garnisonsstadt Galiziens einen Kurzbesuch abzustatten. Über Kopfsteinpflaster und an barocken Gebäuden vorbei geht er die Franziskanerstraße hinunter. Er passiert die gleichnamige Kirche und schreitet über den Rynek, den Marktplatz mit seinen Patrizierhäusern, die von der reichen Vergangenheit Przemysls als Handelsplatz zwischen Krakau und Kiew, zwischen Schwarzem Meer und Ostsee zeugen.
Er blickt hoch zur katholischen Kathedrale und zur Burg aus dem 17. Jahrhundert. Aber ihm bleibt gerade noch die Zeit, hinunter zu spazieren zum Fluss San, wo im Zweiten Weltkrieg gemäß dem Molotow-Ribbentrop-Abkommen die Demarkationslinie zwischen Russen und Deutschen verlief. Karl bleibt auf der östlichen, der Altstadtseite, ersteigt wieder die Höhe, überquert am Altstadtrand die vielbefahrene Hauptstraße nach Lemberg, um wieder zum Bahnhof zu gelangen, wo sein Zug – ebenfalls mit dem Ziel Lemberg (ukrainisch: Lviv) – auf ihn warten sollte.
Bevor er den Bahnsteig Richtung Ukraine betreten kann, gilt es, schon die erste Kontrolle vor dem Eintritt in das Nachbarland über sich ergehen zu lassen. Gültiges Ticket, gültige Identitätspapiere? Ohne diese Überprüfung wird man nicht auf diesen Teil des Bahnhofs gelassen, der durch einen hohen Gitterzaun vom Teil für die polnischen Inlandszüge abgetrennt ist. Karl hat zwar ein Ticket von Krakau bis Czernowitz oder besser Černovcy, wie es auf Polnisch und Russisch heißt, oder noch besser Černivci, wie der ukrainische Name lautet, aber eine Platzkarte nur für die Strecke bis zur Grenze. Für den innerukrainischen Nachtzug fehlt ihm noch das Schlafwagen-Supplement. Was tun? Die vollbepackten Händlerinnen sehen nicht gerade so aus, als ob sie ihm Auskunft auf Englisch geben könnten.
Also fragt er den jungen Mann an der Bahnsteigkante. Es stellt sich heraus, dass Oleg, wie er sich mit Namen vorstellt, sogar ein wenig Deutsch beherrscht. Karl solle sich keine Sorgen machen. An der Grenzstation Mostyska würden die ukrainischen Schaffner an Bord kommen, die die entsprechenden Aufschläge verkaufen. „Wohin fahren Sie denn?“ fragt der junge Akademiker. Oleg ist nämlich Lektor für Ukrainisch an der Universität von Warschau. „Černivci? Das trifft sich gut! Da will ich auch hin.“
Karl und Oleg unterhalten sich angeregt über Gott und die Welt. Nach knapp drei Stunden tauchen tatsächlich die Kondukteure auf. Ganz perfekter Gastgeber, bezahlt Oleg Karls Zuschlag für den Schlafplatz bis Černivci in ukrainischer Währung. Karl hat noch keine Griwna in der Tasche. „Das kannst du mir ja morgen zurückzahlen“, bemerkt der junge Lektor. Natürlich freut sich Karl über diesen freundlichen und eloquenten Reisegefährten. Die weiteren eineinhalb Stunden Fahrt bis Lemberg vergehen wie im Flug. Dort richten sie in ihrem Kurswagen nach Černivci die Betten her. Ankunftszeit an ihrem Zielort ist in aller Herrgottsfrühe, um vier Uhr zwanzig genau. Deshalb wird es Zeit, sich in die Horizontale zu begeben.
Vorher will Oleg aber noch Eines klären. Dass Karl um halb fünf Uhr morgens einige Stunden im Wartesaal verbringen will, bevor er sich bei einem Rundgang die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt der Bukowina anschaut und am Nachmittag in den Zug nach Odessa am Schwarzen Meer steigt, hält er für keine gute Idee. Er solle ihn doch nach Hause begleiten. Dort könne man sich ein paar Stündchen ausruhen. Danach könne er ihm gerne seine Heimatstadt zeigen. Karl hat schon auf seiner Ostsee-Umrundung die geradezu bedingungslose osteuropäische Gastfreundschaft kennen gelernt und bei den Diskussionen mit Oleg auf der bereits stundenlangen Fahrt auch seinen neuen Freund schätzen gelernt. So hat er keine Bedenken, dankend zuzusagen. Er legt sich zur Seite. Noch eine Weile hört er das Rattern der Räder und das Flüstern in den anderen Schlafkojen. Dann ist er eingeschlummert.
Noch ziemlich verschlafen steigen Oleg und Karl um Viertel nach Vier von ihren Pritschen. „Mann, mir kommt’s so vor, als sei ich gerade erst eingeschlafen“, stöhnt Karl. „Du kannst froh sein, dass du jetzt nicht bis zum Morgengrauen in der Bahnhofshalle ausharren musst, bevor du mit deiner Besichtigungstour beginnen kannst“, meint Oleg. Recht hat er. Pünktlich um 4 Uhr 20 fährt der Nachtzug in Černivci ein. Schnell durchschreiten sie einen leeren Kuppelraum, die Haupthalle des unten im Tal des Flusses Pruth gelegenen Bahnhofs. Vor dem weißen, klassizistischen Gebäude verstauen sie ihr Gepäck in einem Taxi. Und schon geht die Fahrt über das Kopfsteinpflaster der Gagarin-Straße, die zunächst am Bahngelände entlang führt und sich dann in einer Rechtskurve den Hügel hinauf zum Stadtzentrum schwingt. Nur der Oberleitungsbus kommt ihnen auf der Steigung entgegen. Links und rechts stehen zwei- bis viergeschossige Bauten, die alle noch aus vorkommunistischer Zeit stammen könnten.
Oben im Zentrum geht die Gagarin- in die Golowna-Straße über, die sich über den ganzen Hügelrücken bis in den Süden der Stadt zieht. Eine schöne Kirche taucht zur Rechten auf, dann eine Zweite. „Das ist meine Kirche“, weist Oleg mit dem Finger aus dem Taxi. „Die römisch-katholische Heiligkreuz-Kirche. Sie ist schon fast 200 Jahre“, bemerkt er stolz. Klar, die polnischstämmigen Ukrainer suchen natürlich die papsttreue Kirche auf. „Wir feiern an diesem Wochenende das große Gemeindefest. Wir schlafen uns erst aus. Aber heute Nachmittag gehe ich mit dir dorthin.“
Das Taxi rattert weiter über das regennasse Pflaster. Nach ein paar hundert Metern fahren sie längs über den Zentralplatz mit dem zu österreichisch-ungarischen Zeiten errichteten Rathaus auf der Hügelkuppe. Der noch müde Karl nimmt kurz den Rathausturm wahr, nickt kurz ein, bis ihn Oleg im weiteren Verlauf der Golowna-, also Hauptstraße auf das nächste Gotteshaus zur Linken aufmerksam macht, die rosafarbene rumänisch-orthodoxe Kathedrale. „Und dahinter – kannst du jetzt nicht sehen – würdest du die armenische Kirche entdecken“, weiß sein Stadtführer. So „erfährt“ Karl bereits im Morgengrauen im doppelten Sinne das Multikulturelle der Bukowina-Hauptstadt.
Durch ein grünes Spalier von Straßenbäumen auf den Bürgersteigen, weiter vorbei an Altbauten und über Kopfsteinplaster braust der schweigsame Chauffeur. Nachdem der Zentralpark zur Rechten hinter ihnen liegt, erreichen sie schließlich die Ringstraße im Süden, den Nesaležnosti-Prospekt, die Unabhängigkeitsallee. Hier stehen links und rechts fünfstöckige Wohnblöcke aus den 60er Jahren. Der damalige sowjetische Regierungschef Nikita Chruschtschow hatte im Rahmen seiner Wirtschaftsreformen auch den Wohnungsbau forciert, für damalige Verhältnisse hochmoderne Bauten. Endlich wurde nicht nur in den Aufbau von Schwerindustrie und Militär investiert, sondern auch in ein besseres Leben für die Bevölkerung. Hier war auch Olegs Familie eingezogen.
Die Blöcke stehen mit der Schmalseite im rechten Winkel zum breit angelegten, ebenfalls von Baumreihen flankierten Prospekt. Karl folgt Oleg zu einem der Eingänge. Gleich im Erdgeschoss steckt er seinen Schlüssel in eine der Wohnungstüren. Als sie in den Flur treten, kommt ihnen im kurzen T-Shirt barfuß eine junge Frau in Slip entgegen. Sie hat ihren Bruder erwartet, reibt sich die schläfrigen Augen und schaut verwundert aus der Wäsche, als sie sieht, dass Oleg nicht allein ist. Der Bruder stellt den deutschen Gast seiner jüngeren Schwester vor, erklärt, dass sie beide noch todmüde seien, und bereitet auf die Schnelle im Wohnzimmer ein Morgenlager für Karl. Die vielen Kissen mit Häkelüberzügen werden zur Seite gelegt und Bettzeug zurecht gerückt. Dann wünschen sie sich zum zweiten Mal in dieser Nacht einen guten Schlaf.
Als sich Karl um halb Neun aus dem Bettzeug herausschält, hört er Geräusche aus der Küche. Oleg war bereits einkaufen und bereitet das Frühstück. Seine Schwester Marija ist schon fort, zur Arbeit in einem Büro. Sie ist die einzige der Familie, die permanent in ihrer Heimatstadt Černivci lebt. Die Mutter schafft als Krankenschwester in Rom. „In Italien?“ fragt Karl verwundert. „Ja, so ist es. Und mein Vater arbeitet als Ingenieur in einem Stahlwerk in Donezk in der Ostukraine. Ich selber bin, wie du weißt, als Lektor in Warschau tätig. So ist die Familie in alle vier Himmelsrichtungen verteilt“, erläutert Oleg mit einem leicht gequälten Lächeln.
Der schmale Küchenraum bietet doch Platz für ein Tischchen, an dem die beiden sich niederlassen. Es gibt die typischen Elemente des ukrainischen Frühstücks: Weißer Frischkäse sowie frische Gurken und Tomaten, dazu Graubrot und natürlich etwas Fleischwurst.
Gestärkt von dieser Brotzeit machen sich die beiden auf den Weg. Bei der Sberbank-Filiale an der Ecke Golowna/ Nesaležnostiti-Prospekt spendet der Automat dieser größten russischen Bank tatsächlich die Landeswährung Griwna, so wie es Oleg dem ungläubigen EC-Kartenhalter Karl versprochen hat. So für alle Eventualitäten ausgestattet, ziehen sie durch Nikitas 60er Jahre-Wohnblocksiedlung in Richtung Innenstadt. Sie wählen den Weg über die parallel zur Golowna verlaufende Fedkovyča, seit Generationen eine der bevorzugten Wohnstraßen – erst von Czernowitz und später von Černivci. Hier haben die diversen Machthaber der Bukowina ihre Spuren hinterlassen.
Die Rumänen, die 1918 die Bukowina besetzt hatten und als Gewinnler des 1. Weltkriegs im Friedensvertrag von Saint-Germain auch zugesprochen bekommen hatten, haben hier einige prächtige Wohnhäuser errichtet. Das grüne Haus in der Nr. 54 gibt ein eindrucksvolles Beispiel für den rumänischen Stil. Seinen Mittelteil mit von Balustraden geschmückten Balkons flankieren zwei Erkertürme mit spitz zulaufenden, rot gedeckten Haubendächern. Kein Wunder, dass hier nach der Besetzung durch sowjetische Truppen Offiziere der Roten Armee residierten. Andere Villenfassaden (zum Beispiel in der Nummer 24) zieren sogar Reliefs von Wappen. „Sind das die Zeichen österreichischer oder ungarischer Adelsfamilien?“ fragt Karl. Oleg ist überfragt. „Gut möglich.“
Schöne Fassaden aus der kaiserlichen und königlichen oder auch k.u. k. Zeit der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie zieren auch die zur Stadtmitte hin ansteigende „Straße der Roten Armee“ (Červonoarmiijs’ka), auf die die beiden Stadtwanderer von der Fedkovyča wechseln. Die Apteka, also Apotheke in der Nr. 28 ist ein prächtiges Beispiel dafür. Die Rotarmee-Straße überquert den größten Platz der Stadt, den Soborna-Plošča. Früher hieß er einmal Austria-Platz. Im angrenzenden Park stand zu jener Zeit eine Büste von Kaiserin Elisabeth. Statt „Sissi“ beherrscht immer noch ein Sowjetsoldat die Szenerie. Die Skulptur steht mit wehendem Mantel, ein Gewehr in der Rechten, mit der Linken die aufgepflanzte Standartenfahne haltend, vor einem polierten braunen, hohen Obelisken und feiert den Sieg im 2. Weltkrieg. Indes, die Spuren der Roten Armee beginnen zu verwischen. Nach den dramatischen Ereignissen vom Februar 2014 in der Hauptstadt Kiew wird die Červonoarmiijs’ka in „Straße der Helden des Majdan“ umbenannt.
Blick vom Zentralplatz in Herrengasse
Doch davon wissen Oleg und Karl noch nichts. Sie kommen endlich am Zentralplatz mit dem Rathaus an. Der blaue Anstrich des 1843 errichteten Gebäudes kommt an diesem regennassen Tag vor dem Grau des Himmels nur schwach zur Geltung. Doch mit seinem dreistufigen Turm mitten über dem Portal beherrscht das Haus der Stadtregierung von der Stirnseite den langgestreckten Platz. In seiner Südostecke zweigt eine Fußgängerzone ab, auf die Oleg voller Stolz hinweist. „Das ist die Herrengasse. Sie war schon zur Zeit von Kaiser Franz-Joseph der Ort, wo man einkaufen und spazieren ging. Spazieren, sagt man das?“ fragt er. „Durchaus“, meint Karl. „In einem solch prächtigen städtischen Ambiente könnte man das sogar flanieren nennen.“ Das große hochherrschaftliche Haus mit Turm an der Ecke zum Ringplatz, wie der zentrale Platz unter österreichischer Herrschaft hieß, ziert heute noch eine elegante Fassade. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass im dortigen Café vor dem Ersten Weltkrieg das deutsch-jüdische Bürgertum und die vielen Literaten der mehrsprachigen Bukowina-Metropole ein- und ausgingen.
Heute ist dort eine Bank untergebracht, ebenso wie gegenüber im eleganten Gebäude des Hotel-Restaurants „Belle Vue“ mit seinem charakteristischen, langgestreckten Balkon über die gesamte erste Etage. Darunter im Erdgeschoss residiert nun die russische Sberbank. Trotz aller kyrillischen Schriftzeichen rundum fühlt Karl sich in eine vergangene „österreichische“ Zeit versetzt. Die Architektur spiegelt immer noch die Aura des Fin de Siècle.
Die Herrengasse trägt längst nicht mehr ihren deutschen Namen. Nach der ukrainischen Nationaldichterin Olga Kobyljanska ist sie heute benannt, genauso wie das Stadttheater, das 1905 als Schiller-Theater eingeweiht worden war. Nach fünf Minuten Fußweg sind Oleg und Karl dort angelangt. Den Theatervorplatz schmückt eine Parkanlage mit Bänken und Blumenrabatten. Unmittelbar vor dem Portal sitzt sie auf einem Sockel, die Verfechterin des ukrainischen Nationalgedankens. Bei der Einweihung des Kunsttempels saß dort ein Bruder im Geiste, der freiheitsliebende Friedrich Schiller. „Hey Oleg, das muss ich fotografieren“, ruft Karl. Und so posiert der blonde Oleg zusammen mit der zur überlebensgroßen Skulptur gewordenen Olga, auf den Stufen stehend, die Hand lässig auf den Sockel des Denkmals der Frau gestützt, die 1942 unter deutscher Besatzung 78jährig gestorben und zu einer Art Nationalheiligen geworden ist.
Über dem Eingang prangt eine Banderole. SALOMEA steht da. Anscheinend hat sich das Programm trotz einer wechselvollen Geschichte unter österreichischer, rumänischer, deutscher, sowjetischer und ukrainischer Leitung doch nicht total geändert. Richard Srauss hat seine Oper Salome im selben Jahr vollendet, in dem auch das heutige Kobyljanska-Theater fertig wurde. In der ersten Blütezeit gastierten hier vor vollbesetztem Haus Theatertruppen aus Wien, Berlin, Wilna und Moskau.
Ein mächtiger Portalbogen, über den sich wie eine Haube das Bühnenhaus erhebt, beherrscht den Mittelteil mit dem Eingang. Der Bogen ruht zu beiden Seiten auf einem Paar klassizistischer Säulen. Sie verstärken den weihevollen Eindruck auf den Stadtwanderer, der sich dem Musentempel über den blumengesäumten Vorplatz nähert.
Oleg führt Karl stolz um das von den Wiener Architekten Fellner & Helmer gestaltete prächtige Gebäude herum. Den paneuropäischen Anspruch, den die Erbauer im multinationalen Czernowitz des Fin de Siècle geltend machen wollten, unterstreichen die Büsten der Großdichter, die im oberen Teil der Seitenfronten vor kreisrunden, von Stuck umkränzten Fenstern platziert sind. Auf den Ehrenplätzen über den großen Fenstern der Vorderfront kommen der Brite Shakespeare und der Franzose Molière hinzu. Um die Ecke herum in der Schillerstraße – so heißt sie tatsächlich immer noch – ist als Erster der Russe Puschkin zu sehen und gleich anschließend der vom Vorplatz verbannte Schiller mit seinen wallenden Locken. „Toll, Europas ,Chefdramatiker‘ geben sich hier ein Stelldichein“, konstatiert Karl. „Wart’s ab, das ist noch nicht alles“, bittet Oleg um Geduld.
Das russisch-deutsche Paar geht hinüber zur anderen Seitenfront. Grinsend zeigt Oleg zwischen dem Blattwerk von Bäumen zur Seitenfassade hoch: „Schau mal, da ist Herr Goethe aus Frankfurt.“ Karl hätte ihn fast übersehen, denn die kyrillische Schrifttafel unter der Büste enthält nur vier Buchstaben. Tatsächlich, der deutsche Dichterfürst schaut von dort würdevoll auf ihn herab. „Gete“ steht da in kyrillischen Zeichen. Die Russen und Ukrainer belassen es, wenn sie transkribieren, eben beim reinen Umsetzen ihrer Lautung. „Deutschen Augen und Ohren kommen diese Transkription und diese Lautung ein wenig unkorrekt vor“, bekrittelt der Beckmesser Karl.
Immerhin, auch Černivci erweist dem alten Goethe noch die Ehre als Straßennamensgeber. So nehmen sie die hinter dem Theater verlaufende Gete-Straße, um hinüber zur Vulitzja Universitetska zu schreiten. Dieser Hort der Wissenschaft residiert seit der Sowjetzeit im ehemaligen Bischofspalais des orthodoxen Metropoliten der Bukowina und Dalmatiens. Das prächtige Gebäude der Nationalen Jurij-Fedkovyč-Universität wurde 2011 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Die Studenten – so Oleg, der sich dort der polnischen Literatur verschrieben hatte – empfinden es als eine Ehre, „in diesen heiligen Hallen“ ihren Studien nachgehen zu dürfen. Der von 1864 bis 1882 entstandene riesige Ziegelbau des tschechischen Architekten Josef Hlavka, der im Übrigen auch die Wiener Hofoper errichtete, ist geprägt von einem Stilmix aus romanischen, gotischen und byzantinischen Elementen – auch dies ein Beleg für die Verschmelzung verschiedenster kultureller Einflüsse in der Hauptstadt der Bukowina.
An diesem Samstag bleibt die Lehrstätte verschlossen, so spazieren die beiden um den weitläufigen, U-förmigen Gebäudekomplex herum und über die Josef-Hlavka-Straße hinauf zum Park auf der Habsburghöhe. Von dort geht es durch den Wald steil hinunter ins Pruth-Tal, wo die Züge verkehren. Ein neuer September-Schauer geht hernieder. Eilig stürmen sie die Bahnhofshalle und schütteln sich wie junge Hunde ihr Fell die Feuchtigkeit aus ihren Kleidern.
Oleg ist es gewesen, der Wert darauf gelegt hat, Karls Fahrkarte ans Schwarze Meer schon vorab zu besorgen. „Dann können wir in aller Ruhe anschließend zum Gemeindefest gehen, und du ersparst dir den Stress mit dem Fahrkartenkauf unmittelbar vor der Abfahrt“, hat er schon beim Frühstück geraten. Gesagt, getan. Und tatsächlich, der Ticketerwerb ist gar nicht so unkompliziert. Karl muss als Ausländer an einen besonderen Schalter. Dort wird peinlich genau seine Reisepassnummer notiert. Bezahlt werden kann nur bar. Gut, dass er am Morgen schon die Griwna aus dem Automaten der Sberbank gezogen hat und dass er Oleg als Übersetzer dabei hat. Denn der Bahnbeamte will alles Mögliche wissen. Auch den Vornamen des Vaters. „Ebenfalls Karl? Aha. Also Karl Karlovič“, vermerkt er. „Wir Ukrainer ehren wie die Russen unsere Väter, indem wir ihre Namen zusammen mit unserem nennen“, erläutert Oleg Fjedorovič.
Auf dem Bahnhofsvorplatz nehmen sie an einem Kiosk noch schnell einen kleinen Snack zu sich. Dann endlich geht Olegs Herzenswunsch in Erfüllung. Sie fahren im Taxi zur Heiligkreuzkirche. Dort feiern an diesem Wochenende die römisch-katholischen Christen ihr Pfarrfest. Und sie tun das im ökumenischen Geiste. Alle sind eingeladen: die Orthodoxen, die Unierten (Ukrainische griechisch-katholische Kirche) und die Protestanten. Karl, der im dicht besetzten Kirchenschiff neben Oleg auf der Bank Platz genommen hat, fällt beim Einzug der Priester vor allem der Pope der Unierten auf, dieser mit Rom verbundenen Kirche, die aber weiter den byzantinischen Ritus pflegt. Wie die anderen Ehrwürden trägt er ein farbenprächtiges Gewand. Hervor sticht er durch seinen goldenen Hirtenstab und die noch prächtigere Kopfbedeckung, ein Mittelding zwischen Turban, Krone und Haube. Über dem golddurchwirkten Stirnband verbreitert sich dieser Hut etwas und schließt oben kuppelförmig ab. Der pausbäckige Pope sieht aus wie einer der Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland, die durch Karls Kindheitserinnerungen geistern.
Der festliche Charakter der Messe wird weiter durch die Fahnen vieler kirchlicher Organisationen unterstrichen, die an den Seiten des Kirchenschiffes aufgepflanzt sind. Auch die Kolpingfahne fehlt hier nicht. Der von dem deutschen Priester Adolph Kolping Mitte des 19. Jahrhunderts gegründete Gesellenverein ist als internationales Sozialwerk heute noch in 60 Ländern aktiv, offenbar auch in der nunmehr ukrainischen Bukowina, wo es natürlich seit österreichischer Zeit verwurzelt ist.
In der ukrainisch gehaltenen Zeremonie wird auch eine Ansage in Polnisch gesprochen. 70 Prozent der Gläubigen der Heiligkreuz-Pfarrei sind polnischer Abstammung oder haben sogar ihre polnische Nationalität bewahrt. Oleg selber steht als Beispiel dafür. Seine Mutter hat polnische Vorfahren.
Zu Karls Überraschung betet einer der vielen Priester, die den Festgottesdienst mitgestalten, seinen Segensspruch sogar in deutscher Sprache. Man merkt seinem Akzent an, dass dies nicht seine Muttersprache ist. Aber die Worte sind korrekt und dem deutschen Zufallsgottesdienstbesucher aus ferner Kindheit vertraut. Grußworte, Gebete und Gesänge wechseln sich ab. Bevor der gastgebende Pfarrer zu seiner Predigt anhebt, stupst Karl seinen Banknachbarn an und weist auf die fortgeschrittene Zeit auf seiner Armbanduhr hin. „Du, ich muss los. Bleib nur hier. Ich kenn‘ ja jetzt den Weg. Herzlichen Dank noch einmal für alles. Und hoffentlich bis bald!“
Inmitten der Festmesse reicht es nur für eine flüchtige Umarmung. Dann mogelt sich Karl still durch die Masse der Gläubigen hinaus und tritt vor die Kirche. Sein Blick fällt auf die andere Seite des Platzes. Nicht weit davon begann das alte Judenviertel, wo im 2. Weltkrieg die deutschen Besatzer zehntausende Juden in einem Ghetto zusammenpferchten. Die meisten haben sie später nach Transnistrien deportiert und dort ermordet.
Karl eilt zum Bahnhof und nimmt den Nachmittagszug nach Odessa. Das „bis bald“, was er seinem Cicerone von Černivci zugeraunt hatte, wartet noch auf die Einlösung. Gelegentlich haben sie E-Mails ausgetauscht. Anlässlich der Orangenen Revolution führten sie eine politische Diskussion. Die optimistische Einschätzung der westlich Orientierten, dass mit einer vorbehaltlosen Zuwendung zum Westen alles gut werde, mochte Oleg nicht teilen. Von seinem Vater, der sein Geld in der Schwerindustrie im Donezker Becken verdiente, wusste er nur zu gut, dass dort im Osten der Ukraine bei vielen eine ganz andere Sicht der Dinge vorherrschte. „Im Grunde ist die Ukraine ein in Ost und West geteiltes Land“, schrieb er mit Blick auf die Russophilen im Osten schon Jahre vor der dramatischen Zuspitzung der politischen Lage in der Majdan-Revolution.
Zwei Jahre nach der Majdan-Revolution erhielt Karl eine erfreuliche Nachricht. Der ehemalige Ukrainisch-Lektor an der Uni Warschau ist mittlerweile Polnisch-Lektor an der Fedkovyč-Universität. Der Cicerone von Černivci hat in seiner Heimatstadt tiefere Wurzeln geschlagen.