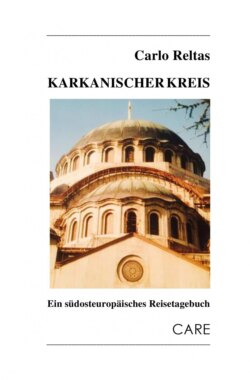Читать книгу Karkanischer Kreis - Carlo Reltas - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Besuch bei Damen und der Tochter
Оглавление„Dzien dobry, Polska!“ Wie auf dem Nordostkurs rund um die Ostsee, zu dem Karl vier Jahre zuvor aufgebrochen war, so führt auch sein Weg nach Südosten auf dem Karkanischen Kreis entlang der Karpaten und über die Balkan-Halbinsel zunächst nach Polen. Verschlafen war er dem Berliner Nachtzug nach Krakau entstiegen. Am Bahnhof wartet schon der Obwarzanki-Verkäufer mit seinen frisch gebackenen Sesam- und Mohnkringeln. Diesen Kringeln wird Karl auf seiner Reise noch öfters begegnen, Obwarzanki hier, ähnliche Namen an den Stationen der Reise bis hin nach Istanbul, wo ein verwandtes und gleichermaßen beliebtes Gebäck Simit heißt. Die Kringel duften warm. Er nimmt gleich zwei davon. „Dzien dobry, Polska! Guten Morgen, Polen!“
Die alte Königsstadt Krakau ist noch feucht vom morgendlichen Sommerregen. Karl und seine Berliner Freundin wandern am begrünten Stadtring entlang, der nur wenige hundert Meter südlich des Bahnhofs beginnt. Nora begleitet ihn auf seiner Südosteuropatour bis in die alte polnische Königsstadt und wird am folgenden Tag von dieser ersten Station des karkanischen Kreises in die deutsche Hauptstadt zurückkehren. Ihr gemeinsames Ziel ist das Gästehaus der Jagiellonen-Universität. Wer hat dort nicht alles studiert, der unvergleichliche Seher Stanislaw Lem zum Beispiel, der weltberühmteste Science-Fiction-Autor, der sich selber lieber mit feiner Ironie einen „heimwerkelnden Philosophen“ der Moderne nannte. Oder Wislawa Szymborska, die Szymborska, die große alte Dame der polnischen Poesie und Literaturnobelpreisträgerin von 1996. In den Tagen seines Besuchs zusammen mit Nora leben beide noch in der Stadt, wo nach wie vor das Herz der polnischen Literatur schlagen soll. So war es nur logisch, dass die Europäische Union just im Milleniumsjahr 2000 auch Krakau zur Kulturhaupstadt Europas erkoren hat. Angetroffen aber haben die beiden die beiden nicht, nicht im Uni-Gästehaus und auch nicht im Garten des Literaturhauses, wo sie angeblich ein- und ausgingen.
In der Floriansgasse, über die einst auch die polnischen Herrscher Einzug in die Stadt an der Weichsel hielten, steigen sie in die zweite Etage ihrer Wissenschaftlerherberge und schauen aus den breiten Fenstern auf diese Fußgängerstraße, unten Geschäfte aller Art und der auch in Osteuropa allgegenwärtig gewordene McDonald‘s. Zur Rechten fällt der Blick nochmals auf den mächtigen Barbakan, die wuchtige Bastei mit meterdicken Ziegelmauern, die die spätmittelalterlichen Stadtherren zum Schutz ihrer Reichtümer außen vor das Florianstor gesetzt haben. Zur Linken mündet die Florianska in den Hauptmarkt, wo das steht, was es zu beschützen galt, die Reichtümer der Stadt, nicht zuletzt versammelt in den Tuchhallen, dem prächtigen, langgestreckten Gebäude inmitten dieses Haupthandelsplatzes.
Nachdem die beiden Berliner die Unibetten ausprobiert und sich auch sonst gut erholt haben, wollen sie unbedingt einer anderen Dame ihre Reverenz erweisen oder – genau genommen – sie schauen und bewundern: die Dame mit dem Hermelin, ein Meisterwerk Leonardo da Vincis, das 1800 vom Fürsten Adam Jerzy Czatoryski erworben wurde und nun normaler Weise im Czatoryski-Museum zu sehen ist. Aber ach, just bei ihrem Besuch befindet sich Cecilia Gallerani mal wieder auf Reisen. Doch Karl wird die schöne Geliebte des Mailänder Fürsten Ludovico Sforza einige Jahre später doch noch zu Gesicht bekommen. Die junge Italienerin mit dem verträumten Blick zur Seite und dem eigenartigen Streicheltier auf dem Arm kommt als eines der „Gesichter der Renaissance“ 2011 nach Berlin. Von dieser Ausstellung im Bode-Museum bringt er ein Plakat mit heim und hängt es zu Hause auf, so dass er sich am Anblick der in Krakau mit großem Bedauern vermissten Schönen seitdem täglich ergötzen kann.
Im Viertel nahe dem Czatoryski-Museum lockt so manches Café zur Einkehr. Mit Jolanda, Karls Tochter, die ab Herbst 2005 als Erasmus-Studentin fast ein Jahr in Krakau verbringt, kehrt er dort gerne ein. In einer romantischen Stube mit alten Nähmaschinen und anderem Zierrat von anno dunnemals schlürfen sie heiße Schokoladen. Noch nostalgischer wirkt das Ambiente im „Es war einmal in Kazimierz“ (Dawno temu na Kazimierzu). Das Restaurant im alten Judenviertel Kazimierz mit diesem elegischen Namen nimmt den Besucher mit auf eine Zeitreise. An der Längsseite des Hauses zur Straße scheinen sich Zugänge zu fünf verschiedenen Lädchen aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zu befinden. Betritt man das Haus von der zum Szeroka-Platz mündenden Schmalseite taucht man jedoch in ein Speiselokal aus einer vergangenen Welt ein. Auch hier die unvermeidliche Singer-Nähmaschine, ein reich verzierter eiserner Ofen, alte Holztische, siebenarmige Leuchter, in den Regalen Werkzeug traditionellen Handwerks – der ganze Raum gibt Zeugnis von Krakaus jüdischer Kultur vor dem Holocaust. Karl und seine Tochter lassen sich dort eine Kartoffelsuppe munden, die wunderbar schmeckt, jedoch so stark mit Knoblauch gewürzt ist, dass sie ärgste Befürchtungen für den Rest des Abends hegen. Aber Jolandas Studienkollegen und Freunde lassen sich nichts anmerken, als Tochter und Vater nach ihrem nostalgischen Abendmahl zum Konzert im jüdischen Kulturzentrum eintreffen.
Die berühmteste Klezmer-Band Krakaus mit Namen Kroké, was nichts anderes als das jiddische Wort für Krakau ist, spielt endlich mal wieder in ihrer Heimatstadt. Mit Viola, Flöte, Akkordeon, Bass und Schlagzeug ist die Besetzung etwas anders als die einer traditionellen Klezmer-Combo. Vor allem scheuen Tomasz Kukurba und seine Mitstreiter bei der Modernisierung des Klezmer nicht die elektronische Verstärkung bis hin zur Verzerrung. Klezmer ist ja sowieso schon sehr dynamisch. Aber Krokés Temperament und Musik wird manchmal geradezu wild, geht zurück zum Zarten und beschleunigt erneut – und das alles mit atemberaubender Virtuosität in mal rasantem, mal getragenem Spiel. Ist das noch Klezmer? Ist das nun Jazz? Es ist KROKÉ! Das junge Publikum im neu verglasten Foyer des Kulturzentrums ist hingerissen vor Begeisterung.
Nach dem Konzert verziehen sich die Musikenthusiasten in die Kneipen rund um den Neuen Platz mit seinem Marktrundbau in der Mitte. Als Karl sieben Monate später zusammen mit seinem Sohn Fabian erneut nach Krakau reist, um Jolanda nach dem Erasmus-Jahr mitsamt ihrem neu erworbenen polnischen Hausstand nach Berlin zurück zu verfrachten, da geht es wieder zur Kneipenszene am plac Nowy. Es ist WM-Zeit. In den Hinterräumen oder im Obergeschoss der Schankstätten flimmern die Großbildschirme. Deutschland gegen Argentinien, Italien gegen Ukraine – die Emotionen unter den Erasmus-Studenten aus allen möglichen Ländern Europas und ihren polnischen Gastgebern wogen hoch. Fußballkonflikte sind die Schönsten, denn nach Frust oder Freude, nach Sieg oder Niederlage sind Versöhnung und Frieden beim Bier danach schnell wiederhergestellt.
Doch zurück zur Karkanien-Tour: Das Kazimierz mit seinen Synagogen, dem jüdischen Friedhof und den sonnigen Straßencafés am Szeroka-Platz gehören natürlich auch zum Programm von Nora und Karl. Auch dem Touristenstrom zur Königsburg Wawel schließen sie sich an. Oberhalb der Weichsel am Südrand des Stadtrings gelegen, hat man von dort einen schönen Blick über die Flusslandschaft und auf die Industrievorstädte. In der ehemaligen Emaillewaren-Fabrik Oskar Schindlers ist dort inzwischen ein staatliches Geschichtsmuseum entstanden, das die Zeit der deutschen Besatzung von 1939 bis 1945 zum Thema hat und natürlich auch das Schicksal der Juden im Krakauer Ghetto.
Das Innere der Burg entfaltet monarchische Pracht, in der Kathedrale mit ihren berühmten Toten wie auch im eigentlichen Schloss mit seinen vielen Prunksälen. In Erinnerung bleibt Karl der Audienzsaal, mit dem die polnischen Herrscher schon vor Jahrhunderten die Gesandten fremder Länder zu beeindrucken vermochten, nicht wegen der Gobelins, nicht wegen der Kassettendecke mit den holzgeschnittenen Charakterköpfen, sondern weil hier historisches Ambiente mit Leben erfüllt wird. Ein Streicherquartett spielt auf, in historischen Gewändern zwar, aber voller Leben und mit dem Schwung der Jugend und der Anmut der polnischen Violonistin, die als Burgfräulein verkleidet mit ihrem hingebungsvollen Spiel an die verträumte Dame mit dem Hermelin denken lässt.
Marien-Basilika am Hauptmarkt
Am Abend kehren Nora und Karl am Hauptmarkt in eines der renommiertesten Restaurants am Platze ein, das Restauracja Wierzynek. 1364 steht über dem Eingang. Die Ursprünge des Gourmet-Tempels sollen bis auf ein gigantisches Festmahl auf dem Krakauer Hauptmarkt zurückgehen, das König Kasimir der Große im Jahr zuvor anlässlich der Hochzeit seiner Enkelin Elisabeth mit Kaiser Karl IV. gegeben hat. Auf Knedliki, Knödel zu Hirschbraten, eine Spezialität tschechischen Ursprungs, fällt die Wahl der Besucher aus Berlin. Zusammen mit einem schweren ungarischen Rotwein lassen sich Nora und Karl dieses traditionelle Abendmahl in gediegenem Ambiente im ersten Obergeschoss schmecken. Brokatvorhänge, geschnörkelte Stühle, blütenweiße Servietten und schweres Besteck geben dem Dinner ein quasi-bourgeoises Gepräge. Oder doch gar ein Königlich-Kaiserliches? Wie auch immer, die lange Stadtwanderung und das köstliche Mahl bescheren ihnen einen tiefen Schlaf im Uni-Gästehaus.
Der Morgen in Krakau beginnt für Karl an jenem Tag mit einer Laufrunde auf dem grünen Parkring, der anstelle des Stadtwalls heute die Altstadt umschließt. Der Lauf bietet Gelegenheit zum Abschiednehmen, vom Barbakan, vom Schloss, vom Slowacki-Theater und von diversen Kirchtürmen entlang der Strecke. Noch einmal geduscht, noch einmal gepackt – und schon stehen sie nach eineinhalb Tagen wieder auf dem Bahnsteig. Nora bleibt noch ein wenig, bevor sie am Nachmittag nach Berlin zurückreist, Karl besteigt den D-Zug zur polnischen Ostgrenze nach Przemysl, wo er in den Nachtzug nach Černivci in der ukrainischen Bukowina wechseln will. Die Eisenbahn fährt über die Weichsel. Auf der südlichen Flussseite begrenzte das Bahngelände das jüdische Ghetto nach Osten. Bald nachdem das Industriegelände mit der ehemaligen Emaillewarenfabrik passiert ist, die für viele Juden zur Arbeits- und Zufluchtsstätte vor den Schergen des NS-Regimes wurde, knickt die Bahn nach Osten ab. In Richtung Tarnow, Reszow, Przemysl und Ukraine verläuft sie zunächst entlang der Autobahn.
Während zur Rechten die Autos brausen, sind weit im Norden jenseits der Weichsel die Türme der Stahlwerke von Nowa Huta zu erkennen. An einem Sonntag sind Karl und seine Tochter Jolanda dorthin mit der Straßenbahn gefahren, bis vor das Tor des Kombinats mit seinem imposanten Verwaltungsgebäude im Stil der Stalin-Ära. Hinein auf das riesige Werksgelände, das sich inzwischen in den Händen des weltweit größten Stahlkonzerns ArcelorMittal befindet, konnten sie nicht. Die Schranke ist nur für Werksangehörige zu passieren. Wohl aber pilgern sie anschließend über eine Ringstraße der 1949 speziell für die Arbeiterschaft des Eisenhüttenkombinats gegründeten sozialistischen Musterstadt. Ihr Ziel? Eine Kirche mit einer besonderen Geschichte! Die Wohnungsblöcke, die sie auf dem Weg dorthin passieren, haben grüne Vorgärten mit nun schon Jahrzehnte alten Bäumen. Das grüne Ambiente lässt erahnen, dass hier ein „Arbeiterparadies“ geplant war. Erkennbar ist diese Neue Heimat in die Jahre gekommen und bedarf sie der Renovierung. Gleichwohl lässt sich nachvollziehen, dass in dieser neuen Wohnstadt für das nahe, aber doch durch einen Parkgürtel auf Abstand gehaltene Werk eine eigene Identität der Bewohnerschaft entstanden ist.
Nowa Huta ist zwar ein Stadtteil von Krakau, aber es ist verständlich, wenn mancher Einwohner der „Neuen Hütte“ nur ein- bis zweimal im Jahr ins Zentrum der Königsstadt fährt. Man hat ein eigenes Zentrum mit einem Zentralplatz, der inzwischen bemerkenswerter Weise nach Ronald Reagan benannt ist. Man hat Sportanlagen, Kinos und man hat Kirchen. Die allerdings mussten sich die frommen Arbeiter mit jahrelangem Drängen erst erstreiten. Die „Kirche der Mutter Gottes, der Königin von Polen“ hat eine elliptische Form, die in dem abgeschrägten Flachdach optisch besonders nachdrücklich zur Geltung kommt. Das in den 60er Jahren konzipierte Bauwerk hat eine große Glasfront nach Nordwesten und ein elegant geschwungenes Betonkleid. Überragt wird die „Arche des Herrn“, wie das Gebäude in Anspielung auf seine äußere Form auch genannt wird, von einem 70 Meter hohen stählernen Kreuz. Unter einem hölzernen Kreuz hatte der damalige Erzbischof von Krakau, Karol Wojtyla, bereits in den frühen 60er Jahren am selben Platz Messen im Freien abgehalten.
Als sich Jolanda und Karl am Ziel ihrer Stadtwanderung diesem modernen Kirchenbau nähern, dessen Architekt Wojciech Pierzyk sich ganz offenbar von Le Corbusiers berühmter Kapelle Notre Dame du Haut de Ronchamp beeinflussen ließ, hören sie aus dem Inneren Gesang. Sie treten an die Glasfront und lugen in den Sakralbau. Es ist Sonntagvormittag. Eine Messe wird gefeiert. Behutsam öffnen sie eine der Portaltüren. Das 1977, also noch in der sozialistischen Ära eingeweihte Gotteshaus ist voll besetzt. Die Gläubigen singen andächtig und doch mit Inbrunst. Diskret ziehen sich die beiden Nichtkatholiken zurück. Aber auch von außen ist dieser Bau für Polens Erste Dame, die Mutter Gottes, die auch am Revers von Solidarnocs-Führer Lech Wałesa nie fehlte, höchst staunenswert.
Die Fahrt nach Nowa Huta hat sich also gelohnt. Auf dem Rückweg vom Haus der Königin in die Stadt der Könige begegnet den beiden ein ehemaliger Mitstreiter Wałesas. Vom Plakat der Partei für Recht und Gerechtigkeit (PiS) lächelt Lech Kaczynski. Der konservative Politiker hat gerade Ende Oktober 2005 die Wahl zum Staatspräsidenten gewonnen und sich dabei nicht zuletzt auf das katholische Lager gestützt. Zwei Monate zuvor hatte die PiS mit dem Slogan „Polska solidarna vs Polska liberalna“ (Solidarisches Polen gegen liberales Polen) auch die Regierungsmehrheit errungen. Ein weiteres Plakat, das die beiden Deutschen durchs Fenster der Tram erblicken, klingt fast wie ein Kommentar darauf: „Nie dla idiotów.“
Aber das ist nur die polonisierte Version des europaweiten Media-Markt-Slogans „Ich bin doch nicht blöd“. Hier im wild wuchernden Gewerbegebiet zwischen Nowa Huta und dem historischen Krakau hat sich natürlich auch der deutsche Handelsriese breit gemacht.
Mit der Straßenbahn sind Jolanda und Karl wieder nach Krakau zurückgekehrt. Mit der Eisenbahn verlässt er es nun auf dem Weg nach Osten mit Nowa Huta am nördlichen Horizont. Mit im Abteil sitzen zwei polnische Damen und ihre Töchter. Neugierig befragen sie den ausländischen Mitreisenden. Die älteren Damen sprechen ein wenig Deutsch, ihre Töchter Englisch. Stolz sind sie auf ihr prächtiges Krakau und erfreuen sich an Karls Lob und Komplimenten für ihre Metropole. Als er vom Abendmahl des Vorabends berichtet, stöhnen sie: „Ja, das Restauracja Wierzynek, einfach großartig!“ Was er denn verspeist habe? „Knedliki!“ Sie verdrehen die Augen – vor Verzückung.