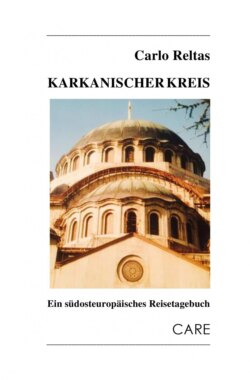Читать книгу Karkanischer Kreis - Carlo Reltas - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chişinǎu: Wohlleben in einem armen Land
ОглавлениеKarls Zimmer befindet sich im elften Stock. An der Rezeption dieser einstigen Luxusherberge, die noch den sozialistischen Plastik-Charme eines DDR-Intourist-Hotels ausstrahlt, hat er als Hotelpass einen Cosmos-Laufzettel für Camera (Rumänisch), Kamnata (Russisch), Zimmer No. 1114 erhalten. Aus seiner Kemenate schaut er nach Süden ins Bahnhofsviertel, die Innenstadt liegt jenseits seines Blickfelds. Südlich des Bahnhofs entdeckt er einen weitläufigen Park mit kleinen Seen. Den bestimmt er sogleich als Ort für sein Marathontraining am nächsten Morgen.
Doch zunächst erkundet er mit einem kleinen Rundgang die unmittelbare Umgebung. Einmal den C.-Negruzzi-Boulevard hinauf bis zum Denkmal für die Befreiung vom Faschismus, aber dann auch schon wieder zurück: Denn nach seiner über sechsstündigen Bahnfahrt von Odessa [die im Übrigen Jahre später wegen steigender Spannungen im Verhältnis zu Transnistrien auf direktem Wege gar nicht mehr möglich sein sollte] meldet sich der Hunger. Der Kekse ist er endgültig überdrüssig. In dem modernen Einkaufszentrum direkt neben dem Cosmos hat er eine Werbetafel für das „Domus Italia“ gesehen. Dorthin zieht es ihn zurück. Im „Haus Italien“ genießt er die Domus-Pizza, dazu zwei Gläschen moldawischen Pinot Grigio. Für eine geruhsame Nacht im Tiefschlaf ist gesorgt.
Der neue Tag beginnt nach dem Frühstück, wie geplant, mit einem Lauf im Park, einer Grünanlage mit dem schönen Namen Valea Trandafirilor, Rosental. Im Park tummeln sich Schulklassen und neben Karl auch andere Sportler, vor allem ein „Mauerhüpfer“, der einen beeindruckenden Elan an den jungen Tag legt. Der schwungvolle „Hüpfer“ scheint ein Trainingsprogramm für den Hochsprung oder Basketball zu absolvieren. Jedenfalls verharrt er kurz vor einem Mauerabsatz und springt immer wieder aus dem Stand mindestens 1,30 Meter bis zur Steinkante, um gleich anschließend wieder zurück auf den Boden zurückzufallen. Karl mit seinem Hang zu Metaphern wagt in Gedanken eine Parallele zur wirtschaftlichen Entwicklung des armen Landes zu ziehen.
Animiert von der Hartnäckigkeit des Hüpfers verlässt Karl das Rosental dort, wo der Dacia-Boulevard den Park quert. Er rennt die Ausfallstraße nach Südosten entlang. Der Botanische Garten am Stadtrand und das moderne Stadttor aus Hochhäusern ist sein ambitioniertes Ziel. Unterwegs kommt er am Zimbru-Stadion vorbei. Ein Plakat am Zaun elektrisiert ihn. Am nächsten Tag soll hier um 19.45 Uhr Zimbru Chişinǎu, der vielfache moldawische Fußballmeister, in einem Spiel der UEFA Europa League gegen Betis Sevilla antreten. „So ein Pech aber auch, da werde ich schon in Bukarest sein“, stöhnt Karl. Was der Fußballfan noch nicht weiß, die Stiere des FC Zimbru, auf dessen Wappen ein mächtiger Auerochse prangt, würden von den spanischen Toreros besiegt werden. Es sollte eine 0:2-Heimniederlage geben, obwohl die Auerochsen selber ein Tor erzielen – ein Eigentor.
Das nächste, noch größere Plakat am Rand des Dacia-Boulevards, das des Läufers Aufmerksamkeit erregt, zeigt einen riesigen Bogen. Er soll die Brücke zwischen der Republik Moldau und dem übernächsten Nachbarn Russland symbolisieren, zu dem die kleine Republik noch gehörte, als sie Teil der russisch dominierten Sowjetunion war. Noch heißt der Präsident Moldawiens Vladimir Vorinin. Er stammt aus einer ethnisch-rumänischen Familie, sein Stiefvater und Namensgeber jedoch war Russe. Der Kommunist Voronin ist um Ausgleich mit Transnistrien und um gute Beziehungen zu Moskau bemüht. Unter seinen pro-europäischen Nachfolgern sollte sich das ändern. Hinter der symbolischen Brücke zu Russland macht Karl die Biege. Dieser Weg scheint ihm dann doch zu weit. Um sich nicht zu verlaufen, schenkt er sich den geplanten Rundkurs und kehrt er zurück wie gekommen: Zimbru-Stadion, Rosental-Park, Bahnhof, Cosmos.
Nach dem Duschen und dem vorsorglichen Packen für die Bahnfahrt am späten Nachmittag begibt sich Karl auf die Suche nach dem Stadtzentrum. Und – siehe da! – es ist urbaner, als er nach dem flüchtigen Eindruck vom Vorabend aus dem Bahnhofsviertel dachte. Die zentrale Achse, der Bulevardul Ştefan cel Mare, benannt nach Stefan dem Großen, dem Fürsten von Moldau im 15. Jahrhundert, erinnert mit seiner Vitalität an den Boulevard Saint-Michel in Paris. Mehr noch! Der Stefans-Boulevard verbindet die Nonchalance der Jungakademiker vom Boul‘ Mich‘ mit der bemühten Eleganz des Ku’damm.
Zum Stefansboulevard ist Karl wie am Vorabend über die leichte Steigung der Negruzzi-Straße hinaufgegangen. Mit dem Namensgeber dieses kurzen Boulevards hat es seine besondere Bewandtnis. Der Rumäne Constantin Negruzzi war als junger Flüchtling aus Iaşi in Ostrumänien, der historischen Hauptstadt des einstigen Fürstentums Moldau, nach Chişinǎu gekommen. Seine Familie war vor den Kämpfen der Revolution von 1821, dem Aufstand gegen die osmanische Oberhoheit, in den unter Zaren-Herrschaft stehenden Teil Moldaus geflohen. Dieser gehörte damals zur russischen Provinz Bessarabien. Hier in Chişinǎu traf der 13-jährige Constantin einen jungen russischen Dichter, der zu Karls „guten Bekannten“ zählt. Denn praktisch in jeder russischsprachigen Stadt ist eine Straße nach ihm benannt. Zuletzt war er sogar seiner Gestalt in Form einer Bronzefigur begegnet, nämlich an seiner vorigen Reisestation Odessa. Der feurige Alexander Puschkin war wegen unbotmäßiger Spottgedichte vom Petersburger Hof verbannt worden und musste mehrere Jahre an verschiedenen Orten des Südens verbringen. Negruzzi war aufs Höchste beeindruckt. Die Begegnung mit dem nur neun Jahre älteren Puschkin inspirierte ihn dazu, sich selber verstärkt der Dichtkunst zu widmen. Er wurde zu einer der wichtigsten Figuren der rumänischen Nationalliteratur und auch der Politik. Er stieg bis zum Finanzminister auf.
Da, wo der Negruzzi- in den Stefansboulevard mündet, am Platz der Nationalen Einheit, markiert das Denkmal für den Sieg über den Faschismus den Beginn der Magistrale. Auf einer Verkehrsinsel gegenüber der Akademie der Wissenschaften erhebt sich eine hohe Betonstele. Davor steht eine eiserne Frauengestalt mit wehendem Gewand, die sich mit ausgebreitetem Arm schützend vor ein Kind stellt. Wie um einen Gegenpol zu schaffen, sollte 2010 nur knapp zwei Kilometer weiter vor dem Regierungsgebäude ein Mahnmal für die Opfer des Sowjetkommunismus errichtet werden. In diese Richtung flaniert Karl über den breiten Trottoir unter angenehmen Schatten spendenden Bäumen.
An den klassizistischen Bauten entlang des Boulevards prangen die Schriftzüge der neuen Zeit. In einem der schönen Gebäude residiert nun das Moldcell Center. Der Mobilfunkanbieter hat eine schwedische Mutter und einen türkischen Minderheitsgesellschafter. Die „Victoriabank“, eines der größten Finanzinstitute des wirtschaftlich schwächelnden Landes, wirbt hier ebenfalls – Neokapitalismus hinter Fassaden aus vorkommunistischer Ära.
Schließlich öffnet sich zur Rechten die Häuserflucht des Boulevards und gibt den Blick frei auf einen Park. In dessen Mitte steht die Kathedrale der Geburt des Herrn. Der Kuppelbau wurde in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts errichtet und ist symmetrisch angelegt. Alle vier Außenwände ziert ein Portal mit je sechs Säulen. Das Besondere an dem Kirchenkomplex: Der vierstufige Glockenturm ist der eigentlichen Kirche vorgelagert und davor wiederum erhebt sich am Boulevard ein kleiner Triumphbogen. Alle drei Bauten liegen auf einer Linie, die eine Verbindung zwischen russischer Staatskirche und Politik zieht. Mit dem Triumphbogen wurde 1840 der russische Sieg im russisch-türkischen Krieg von 1828/1829 gefeiert. Karl greift zur Kamera und lässt den Triumphbogen außer Acht, zumal er mit seinem kantigen Abschluss nicht zu den runden Formen von Kirche und Turm mit ihren Kuppeln passt. Im Vordergrund nimmt er die von Blüten überquellenden Blumenkübel ins Visier, im Mittelgrund die in der Sonne flanierenden Passanten – ein hübscher, friedlicher Anblick, das Wahrzeichen der Stadt ist ein Ort der Ruhe und Entspannung.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Boulevards vor dem Regierungsgebäude sollte es Mitte der Zehner Jahre des neuen Jahrtausends hingegen umso unruhiger und spannungsgeladener zugehen. Im Gefolge eines Bankenskandals – eine Milliarde Dollar waren 2014 auf mysteriöse Weise von den Konten dreier großer Banken verschwunden – sollten hier 2015 nahezu 100.000 Protestierende gegen die Regierung und insbesondere die Korruption in der moldawischen Machtelite demonstrieren.
Solche künftigen Massenansammlungen noch nicht ahnend, bannt Karl den langgestreckten, schlichten Regierungsbau und den leeren Platz davor auf seinen Film, bevor er kehrt macht und den Boulevard wieder hinaufzieht. Er betritt die Hauptpost und versorgt sich mit Briefmarken für die vorbereiteten Postkarten. Whatsapp sollte erst einige Jahre später gegründet werden, also bedient er sich neben E-Mail und SMS der guten alten Ansichtskarte, um den Lieben zuhause Chişinǎus Schokoladenseiten zu zeigen.
Unter den beliebtesten Postkartenmotiven der moldawischen Hauptstadt sticht das Rathaus hervor, ein Stadthaus in den Farben einer gelben Marzipantorte mit Verzierungen aus weißem Zuckerguss. Karl tritt aus der Post heraus und hat die Torte aus Steinen auf der anderen Straßenseite direkt vor Augen. Die Primaria Chisinaului, wie das langgestreckte, nur zweigeschossige Gebäude in der Landessprache heißt, legt sich L-förmig um die Ecke Stefansboulevard und Vlaicu-Pîrcălab-Straße. Die Hauptsteine sind gelb bis ocker. Die Ecksteine und -türmchen, die Portal- und Fensterbögen sowie die Simse sind alle in Weiß gehalten. An der Straßenecke krönt das Gebäude ein kleiner Uhrturm. Der 1901 vollendete Bau des russischen Architekten mit italo-schweizerischen Wurzeln Alexander Bernardazzi gilt als Beispiel italienischer Gotik, ein Rückgriff in die Architekturgeschichte also. [Anmerkung 2019: Über 100 Jahre später (2007) sollte hier mit dem zu jenem Zeitpunkt 28 Jahre alten Dorin Chirtoacǎ ein Modernisierer als Bürgermeister Einzug halten. Er wurde seitdem zweimal wiedergewählt. Als einer der wenigen in der moldawischen Machtelite hat er sich mit den Protesten gegen die Staatsregierung solidarisiert. Wegen Korruptionsvorwüfen wurde er 2018 aus dem Amt entlassen.]
Die Primaria, diese architektonische Idylle am lebensprallen Boulevard, weckt in Karl das Bedürfnis nach etwas Abkehr vom Großstadtgetriebe. Also geht er die Vlaicu-Pircălab-Straße hinunter zum Mühlental-Park. Der Parcul Valea Morii ist eine echte Oase. Nur wenige Spaziergänger und Angler vertreiben sich wie Karl diesen Mittwochnachmittag an dem großen See inmitten des Parks. Am gegenüberliegenden Ufer Wald so weit das Auge reicht! Das Blau des Sees und das Grün der Bäume bieten den Augen des Stadtwanderers eine willkommene Verschnaufpause. Doch dann meldet sich der Hunger und der Wunsch nach einem – wenn auch reichlich späten – Mittagsmahl.
Für den Rückweg zum Boulevard wählt Karl die parallel zur Pîrcălab verlaufende Strada Puschkin. Hier reiht sich ein Architekturdenkmal an das andere, alles Stadthäuser des gehobenen Bürgertums aus dem 19. Jahrhundert. Fast alle diese Privathäuser haben nur ein Geschoss unter den relativ flachen Schrägdächern, meint Karl zu erkennen. Doch der erste Schein trügt. Die Erdgeschosse ruhen auf Kellergeschossen, deren Oberlichter noch zur Straße hin sichtbar sind. „In diesen Souterrains lebte wohl das Dienstpersonal“, mutmaßt der deutsche Besucher. Besonders hat es Karl die Villa mit klassizistischen Elementen an der Ecke zur Şciusev-Straße angetan. Natursteine in zwei verschiedenen Farben, Beige und Hellbraun, sind hier in horizontalen Schichten aneinander gereiht, so dass Karl dem „bescheidenen Heim“ des Arztes Pavel Tverdohlebov, der hier 1872 einzog, den Namen „Gorgonzola-Haus“ verpasst.
Dass er schon in kulinarischen Kategorien denkt, hat wohl auch mit seinem Wunsch nach der nächsten Mahlzeit zu tun. Doch zunächst liegt eine weitere architektonische Köstlichkeit auf seinem Weg. Zurück am Boulevard geht er längs der zuckersüßen Primaria, überquert die Pîrcălab – und steht vor dem „Orgelsaal“. So profan der Name „Salu cu Orga“ sein mag, so sehr schwärmen die Kunstfreunde der Stadt von diesem 1901 vollendeten Bau. Eine „Perle“ sei dieses Nationale Zentrum der Kammermusik und die Orgel hervorragend. Karl kann das nicht überprüfen, denn die großen Plakate vor dem riesigen klassizistischen Portal verkünden, dass die Saisoneröffnung (Inaugurarea Stagiunii) erst in acht Tagen am 26. September stattfindet.
Vor Chişinǎus Orgelsaal
Vor den zwei Säulenpaaren, die den hohen Haupteingang beidseitig flankieren, hält je ein steinerner Löwe auf einem Sockel Wache. Die beiden Leone schauen majestätisch drein. Die vier mutmaßlichen Intellektuellen, die vor ihnen auf dem Trottoir zu einem Plausch stehen geblieben sind, unterhalten sich vergnügt. Die drei Männer becircen die einzige Dame in der Runde oder umgekehrt. Der etwa Vierzigjährige mit straffer Frisur über dem Haupt und einem buschigen Haarzopf im Nacken hat wohl gerade einen Scherz zum Besten gegeben, sein Nebenmann in Kurzhaarfrisur und mit Dreitagebart lacht der Circe in Cordjacke und wollenem Minirock mitten ins Gesicht. Lässig eine Umhängetasche auf der Schulter balancierend, kreuzt sie die schwarzbestrumpften Beine graziös. Der Vierte im Bunde, ein schon etwas älterer, graubärtiger Zeitgenosse, Typ Universitätsdozent, der im Unterschied zu den beiden anderen Charmeuren keine Jeans trägt, zieht bedächtig an seiner Zigarette. Wahrscheinlich freuen sie sich auf die Saisoneröffnung, unter deren Plakat sie stehen. „Schade, dass ich nicht dabei sein kann“, murmelt Südosteuropabummler Karl in den eigenen Bart.
Letztlich kann er der Versuchung nicht widerstehen, doch am Boulevard in einem Bistro mit Straßencafé sein spätes Mittagsmahl zu sich zu nehmen, obwohl sich ihm bei seinem ausgedehnten Spaziergang gediegene Alternativen geboten haben. Was gibt es Interessanteres in einer fremden Stadt, als aus einem Straßencafé den vorbeitreibenden Menschen und ihrer Geschäftigkeit zuzusehen – ob als Passanten auf dem breiten Trottoir, ob als Autofahrer oder als Fahrgäste in Sammeltaxis oder Trolley-Bussen? Am Straßenrand sendet ein moderner Leuchtkasten wechselnde Werbebotschaften an das Publikum auf dem Boulevard. „Incredibil!“ lautet die große Schlagzeile nur wenige Meter vor Karls Bistrostuhl.
Gar nicht „Unglaublich!“ ist es, dass der Kellner ein wenig Französisch spricht. Schließlich ist auch das Rumänische eine romanische Sprache. „Was bitte schön, ist denn eine Zeama-Suppe?“ fragt der Besucher aus Deutschland nach eingehendem Studium der Speisekarte. „Müssen sie unbedingt probieren. Das ist – so sagt man hier – die ‚Königin der moldauischen Küche‘. Wenn wir Moldauer am Vorabend etwas zu viel von unserem hervorragenden Wein getrunken haben, essen wir sie sogar zum Frühstück. Die Zeama ist nämlich ein ausgezeichnetes Mittel, um einen Kater los zu werden!“ „Oh, klingt interessant. Was steckt denn darin?“ „Nun das ist eine kräftige Hühnersuppe mit Nudeln und vor allem allen Arten von Gemüsen.“ Karl findet’s großartig. „Sie haben mich überzeugt. Ich habe zwar keinen Hangover von gestern. Aber nach meinem Lauftraining von heute Morgen und der Stadtwanderung kann ich wirklich eine Stärkung gebrauchen.“ Der Kellner ist zufrieden. „Das ist eine gute Wahl. Sie werden es nicht bereuen. Und was noch?“ fragt er. „Tja, den Hauptgang weiß ich schon. Aber was steht denn hier bei den Desserts? Torturi? Das klingt nach Folter“, meint der Skeptiker aus Berlin. „Ganz im Gegenteil, das sind süße kleine Törtchen!“ erklärt der Ober. Der allem Süßen zugeneigte Karl ist sofort einverstanden. „Nun denn, tortari hätte ich in Anlehnung ans italienische ,torta' für Torte zwar besser verstanden. Aber diese Folter lasse ich mir gefallen. Hauptsache süß. Also: Zeama, Boeuf Stroganoff, Torturi und einen trockenen moldawischen Weißwein.“ Der Ober quittiert die Bestellung begeistert („Excellent, Monsieur!“) und Karl ist voller Vorfreude.
Als er die Zeama löffelt, das Stroganoff-Rind kaut und sich die Torturi auf der Zunge zergehen lässt, ist sich der Transitreisende durchaus bewusst, dass dieses Wohlleben am Boulevard in Chişinǎu noch nicht einmal die halbe Wahrheit über die Moldau-Republik ist. In diesem Land mit einer der einkommensschwächsten Bevölkerungen Europas hat zwar 2009 eine liberale Regierung von den Voronin-Kommunisten das Ruder übernommen, aber nach wie vor ist Moldawien von Krisen geschüttelt. Die Protestbewegung hat zwar verhindern können, dass mit Vladimir Plahotniuc einer der am meisten in Korruptionsverdacht stehenden Politiker Regierungschef wurde, aber letztlich stellt seine Demokratische Partei seit Januar 2016 mit Pavel Filip doch den Ministerpräsidenten. Die Aktivisten von der Oppositionsplattform „Würde und Wahrheit“ haben ihren Frust möglicherweise mit dem guten moldawischen Wein hinuntergekippt. Der Kater danach? Kein Problem! Denn sie haben ja die Zeama-Suppe.