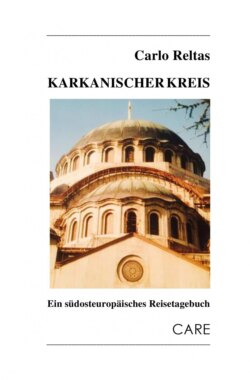Читать книгу Karkanischer Kreis - Carlo Reltas - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zwanzig Stunden bis Odessa
ОглавлениеPling! Kyivstar schaltet sich ein und meldet UMC ab. „Überall ist man ans UMS-Netz angeschlossen, auch in der tiefsten Ukraine“, stellt Karl mit Blick auf sein Mobiltelefon zufrieden fest. Er sitzt gemütlich an einem Tischchen auf seinem Fensterplatz im Schlafwagen-Coupé und schaut zurück auf seine wenigen Stunden in der Hauptstadt der Bukowina. Wie das nicht ferne Lemberg, das sein ukrainischer Freund Oleg hartnäckig „Löwenberg“ nannte, hatten die Österreicher die Stadt an der Pruth um die vorletzte Jahrhundertwende zu einem repräsentativen Außenposten des k. u. k. Reichs herausgeputzt. Während vor dem Schlafwagenfenster die Felder der ruralen Ukraine vorbeifliegen, schwelgt der Reisende immer noch in urbanen Bildern vor seinem inneren Auge.
Was für eine Stadt! Was für eine Geschichte! Innerhalb weniger Jahrzehnte Teil von fünf Staaten und Machtgebieten: Österreich-Ungarn bis zum Untergang des k. u. k. Reichs, Rumänien nach dem ersten Weltkrieg, deutsche Besatzung im zweiten Weltkrieg, Vereinnahmung durch die Sowjetunion nach dem Untergang des „Tausendjährigen Reichs“ und nach dem Ende des Kommunismus schließlich die unabhängige Ukraine. Hauptsächlich fünf Nationalitäten lebten bis zum Holocaust alles in allem friedlich zusammen. Jede von ihnen hatte ein „Nationalhaus“ in Czernowitz mit ausgeprägtem Vereinsleben: die autochthonen Ruthenen (Ukrainer) und die Rumänen, die Deutschen, die Juden und die Polen.
Paradoxer Weise erreichte die Literaturproduktion in deutscher Sprache ausgerechnet in der rumänisch dominierten Zeit ihren Höhepunkt. Der rumänische Germanist Andrei Corbea-Hoisie hält das für keinen Zufall. Die deutschen Juden verloren in jener Zeit ihre Macht in Wirtschaft, Handel und Verwaltung. Ihr kreatives Potential lebten sie verstärkt in der Kunst und insbesondere der Literatur aus. Paul Antschel, der sich als Autor Paul Celan nannte, und die Lyrikerin Rose Ausländer sind zwei der renommiertesten Protagonisten, die in jener Zeit mit dem Schreiben begannen.
Von Rose Ausländer stammt der Satz: „Der Jordan mündete damals in den Pruth.“ Von über 130.000 Einwohnern vor Beginn des Zweiten Weltkrieges sollen etwa ein Drittel Juden gewesen sein. Wenn sie nicht rechtzeitig emigrierten wie etwa Rose Ausländer und Paul Celan, fielen sie dem von Deutschen verübten Genozid zum Opfer.
Eine sehr multikulturelle Periode droht in Vergessenheit zu geraten. Selbst in Israel. In Ester Amranis deutsch-israelischem Film „Anderswo“ von 2015 halluziniert die sterbende Großmutter der zwischen Berlin und Tel Aviv hin- und hergerissenen Heldin Noa von Czernowitz. In einer alten Schmuckdose hatte die Enkelin vergilbte Familienfotos gefunden. Vorne lachende Menschen, hinten die Aufschrift „Czernowitz 1938“. Eine der Umstehenden am Sterbebett sagt: „Ach, das ist Omas Dorf in Polen, wo sie als Kind lebte.“ Das pulsierende Czernowitz mit Zeitungen in sechs Sprachen (Deutsch, Ukrainisch, Rumänisch sowie Polnisch, Jiddisch und Hebräisch) war alles andere als ein Dorf. Polnisch war es nie. Vor der langen österreichischen Ära gehörten die Stadt und die gesamte Bukowina zum Fürstentum Moldau.
Die Bukowina, zu Deutsch „Buchenland“, erhielt ihren Namen nach dem ukrainischen und russischen Wort „Buk“ für Buche. Doch Karls Bahnstrecke ans Schwarze Meer führt nicht durch das Buchenland. Sein Zug macht einen weiten Schwenk nach Norden, um an die Hauptstrecke von Lviv nach Odessa zu gelangen. Allein bis Ternopol, wo der Kurs endlich nach Südosten abknickt, benötigt der Zug laut Fahrplan über acht Stunden. Die ländliche Ukraine, einst die Kornkammer der Sowjetunion, hat Karl eingefangen. In der Kleinstadt mit dem schönen Namen Verenčanka, wo der Zug nach eineinhalb Stunden Fahrt und zuvor zwei weiteren Stationen eintrifft, watscheln zur Linken Gänse um die Häuser in Bahnhofsnähe. Zur Rechten ödet die wellige ukranische Steppe, als sich die Bahn aufreizend langsam wieder in Bewegung setzt.
Ein wenig wandelt sich die Szenerie. Vor Čertkov, wo Karls schweigsame, aber nicht unfreundliche mittelalte Mitreisende am frühen Abend aussteigt, präsentiert sich gepflegtes Ackerland bis zum Horizont, kein Strauch an den Feldrainen, am Himmelsrand ein paar Bäume, dann wieder Weiden, wo einige Pferde grasen. So war es schon zu Zeiten des Dschingis Khan-Enkels Batu Khan, dessen Reiterheer „Goldene Horde“ auf dem Zug nach Westen die Vorzüge dieser ausgedehnten Graslandschaft ausnutzte.
Doch Karl will in die entgegengesetze Richtung. Eine Stunde vor Mitternacht ist es endlich so weit. Sein Zug weicht in Ternopol vom Nordkurs ab und schwenkt nach Südosten, Richtung Čornoje More, wie das Schwarze Meer in der Landessprache heißt. Zunächst jedoch umfängt ihn das Dunkel der Nacht.
Auf dem Weg zum Waschraum entdeckt er ein schönes und sympathisches Detail der ukrainischen Staatsbahn: Die Decken der Coupé-Flure sind mit künstlichen Blumen geschmückt. Das Blattwerk rankt wie beim Erntedankfest, die Plastikblüten leuchten in immer währender Farbenpracht. Darunter sind goldene Vorhänge drapiert. Zu den Seiten sind sie elegant gerafft, so dass den Reisenden der Blick auf die Landschaft bleibt. Erst jetzt bei abendlicher Beleuchtung kommen die goldenen Reflexionen des Stoffes voll zur Geltung. Ein Hauch der Pracht orthodoxer Kirchen begleitet den Passagier somit sogar bei nächtlicher Überlandfahrt.
Als sich Karls Zug am nächsten Morgen dem Schwarzen Meer nähert, stellt sich endlich auch die Sonne ein, die in Černivci hinter Regenwolken und Schauern versteckt geblieben war. Ab Rosdilna, dem Eisenbahnknotenpunkt, wo es hinübergeht nach Moldawien, herrscht gleißendes Morgenlicht. „Ist das eine Verheißung schöner Spätsommertage am Čornoje More“, fragt sich Karl, als sein Zug um kurz vor 10 Uhr nach fast zwanzigstündiger Fahrt in Odessa-Glowna, den Hauptbahnhof der Schwarzmeer-Stadt einfährt.
Innerlich spricht Karl der ukrainischen Staatsbahn ein zweifaches Lob aus. Zum einen für das ihn erheiternde, aber dennoch ernsthafte Bemühen um Verschönerung seines Reise-Ambientes, das er trotz Kitsch-Alarms zu schätzen weiß. Zum anderen wird ihm erst am frühen Morgen richtig klar, dass er in seinem Coupé sicher wie in Abrahams Schoß geruht hat. Vor seiner offenen Abteiltür passiert nämlich der Soldat aus dem letzten Abteil des Waggons, der die geleerten Gläser seines Morgentees dem Schaffner im ersten Abteil bringt. Umgeschnallt hat er Pistole und Schlagstock. Also befand sich der junge Mann die ganze Zeit im Einsatz und nicht etwa auf einem Wochenendtrip an die See, wie Karl auf Grund seines sonst zivilen Aussehens beim Einsteigen in Černivci vermutet hatte. Eine lange Fahrt zwar, aber sicher!