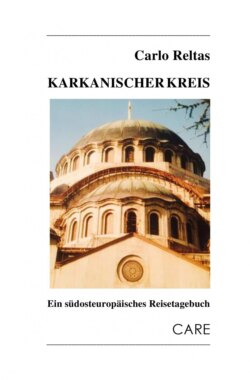Читать книгу Karkanischer Kreis - Carlo Reltas - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bukarest – verwundet und wunderlich
Оглавление„Aus Chişinǎu kommst du gerade? Welch ein Zufall! Da bin ich vor zwei Tagen auch noch gewesen.“ Jean-François ist ehrlich überrascht, dass sein Besucher auf diesem Wege nach Bukarest gelangt ist. „Worüber hast du denn aus Chişinǎu berichtet?“ fragt Karl den Bukarester Korrespondenten seiner Nachrichtenagentur. Sein erster Weg nach dem Auffrischen im Hotel hat ihn – wie so oft in fremden Hauptstädten – in das Büro seiner Firma geführt. Für den späten Vormittag hat er sich mit Jean-François verabredet.
„In zwei Wochen wird in Chişinǎu der Gipfel der Gemeinschaft der Unabhängigen Staaten (GUS), also zahlreicher ehemaliger Sowjetstaaten stattfinden. Gerade in Zusammenhang mit dem schon jahrelang schwelenden Konflikt um Transnistrien habe ich dort unter den beteiligten Parteien recherchiert, um einen fundierten Vorbericht für den Gipfel und den innermoldawischen Zankapfel schreiben zu können“, antwortet Jean-François. „Ich habe dort im Hotel Cosmos gewohnt, weil es nah am Bahnhof ist und ich nichts anderes kannte. Und du?“ will Karl wissen. „Tja, natürlich auch in diesem schon seit sowjetischer Zeit dort stehenden Kronleuchter-Kasten. Na sowas, um ein Haar hätten wir uns schon dort treffen können.“ „Stimmt“, sagt Karl, „ich bin exakt an jenem Dienstagnachmittag im Cosmos eingetroffen, als du bereits morgens nach Rumänien zurückgefahren warst. Und wie lebt es sich als Korrespondent in Bukarest?“ „Wie du siehst, haben wir unser Büro hier in einem schönen, ruhigen Viertel im Norden in der Nähe des Fernsehsenders und des Herăstrău-Parks, des größten Parks von Bukarest überhaupt. Hier ist es recht hübsch: Bäume und blühende Büsche am Straßenrand zwischen kleinen Villen. Aber lass uns um ein paar Ecken in ein Restaurant zum Mittagessen gehen. Dann erzähle ich dir mehr. Ich muss nur noch eine Meldung schreiben und in die Zentrale nach Paris schicken. Danach können wir los.“
Karl lässt sich unterdessen von der freundlichen einheimischen Korrespondentin Elisabeta, einer sogenannten Ortsmitarbeiterin, das Büro in dem ehemaligen großbürgerlichen Wohnhaus zeigen und von dem Techniker die Sendetechnik. Dann ist Jean-François auch schon fertig. Sie steigen in seinen Renault, um ein paar hundert Meter zu einem netten „Resto“ zu fahren, wo sie im Vorgarten unter Sonnenschirmen Platz nehmen. „Als Büroleiter bin ich ja auch für den Verkauf unserer Text- und Fotodienste an die hiesigen Medien zuständig“, hebt der Mittvierziger aus Strasbourg an. „Im Prinzip wollen sie alle die Dienste der internationalen Nachrichtenagentur aus Paris, und zwar auf Französisch, nicht auf Englisch. Rumänisch ist eben auch eine romanische Sprache.“ „Also hast du hier einen leichten Stand als Verkäufer unserer Dienste“, meint Karl verschmitzt, wohl wissend, dass die Realität nicht ganz so einfach ist. „Tja, aber die wollen alle nichts oder so gut wie gar nichts zahlen. Die hiesigen Medien sind knapp an Devisen. Natürlich, der staatliche Rundfunk und das rumänische Fernsehen sind unsere Abonnenten, aber die Zeitungen längst nicht alle. Und diejenigen, die einen Vertrag geschlossen haben, zahlen oft unregelmäßig. Ich komme mir oft vor wie ein Geldeintreiber“, klagt der Kollege. „Das größte Problem ist hier die Korruption, in der Wirtschaft wie in der Politik“, lautet das Urteil des Korrespondenten.
Bei allem Interesse an Politik und Wirtschaft ist Karl dennoch in erster Linie Tourist. Also fragt er Jean-François nach dessen Empfehlungen. „Nun, wenn du einen längeren Stadtbummel machen willst, dann mach‘ dich einfach auf den Weg über die Strada Roma nach Süden bis zum Athenäum. Praktisch gegenüber ist der ehemalige Königspalast, wo das Herz der Revolution gegen das Ceauşescu-Regime schlug.“ „Ach, da wo es die Massenaufmärsche vor dem Gebäude des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei gab?“ erinnert sich der Fernsehzuschauer Karl. Denn diese Revolution war wohl die erste, die weltweit live im Fernsehen übertragen wurde. „Genau“, bestätigt Jean-François. „Das ZK hatte seinen Sitz in einem Teil des ehemaligen Königspalastes. Von da nimmst du die Calea Victoriei, die Siegessstraße weiter nach Süden. Einen Abstecher zur russischen Kirche und zum Cismigiu-Park solltest du nicht vergessen. Schließlich überquerst du den Fluss und gelangst zu Ceauşescus architektonischer Hinterlassenschaft, dem ehemaligen Volkspalast, heute Parlamentspalast. Und bei der Rückkehr liegt die Altstadt mit dem Alten Fürstenhof und der Karawanserei ‚Hanul lui Manuc‘ praktisch vor deiner Nase. Also, bonne marche“, erteilt der Franzose dem Besucher aus Deutschland einen freundlichen „Marschbefehl“.
Nachdem sie sich mit belgischem Importbier nochmals zugeprostet haben, macht Karl sich tatsächlich auf seinen „langen Marsch“. Nach etwas mehr als einer halben Stunde zu Fuß steht er vor dem Athenäum. Die Pläne für das 41 Meter hohe Gebäude, das ursprünglich einen Zirkus mit Manege beherbergen sollte, stammen von dem französischen Architekten Albert Galleron. Dann sollte es als „Ateneul Român“ der Sitz der Literarischen Gesellschaft Rumäniens werden. Letztlich dient das 1885 bis 1888 errichtete Gebäude meist als Konzertsaal. Die ursprüngliche Bestimmung ist noch zu erahnen, denn der runde Zentralbau mit spitz zulaufender Kuppel erinnert an ein Zirkuszelt. Der neo-klassizistische Portikus mit ionischen Säulen wirkt majestätisch und passt zu dem Tempel klassischer Musik, zu dem das Athenäum letztlich geworden ist. Zeitweilig – in den Jahren 1919 und 1920 – tagte hier jedoch das rumänische Abgeordnetenhaus. Heute können in dem 16 Meter hohen Hauptsaal mit einem Durchmesser von 28,50 Metern 794 Konzertbesucher Platz nehmen und der Staatsphilharmonie lauschen.
Durch den kleinen Ateneul-Park geht Karl hinüber zur Victoria-Straße und dem Königspalast, der heute das Nationale Kunstmuseum beherbergt. Die Fläche davor heißt inzwischen mit Fug und Recht „Revolutionsplatz“. Denn hier haben sich im Dezember 1989 um die 100.000 Menschen versammelt, die erzürnt über den wirtschaftlichen Niedergang des Landes und ihre kärglichen Lebensverhältnise waren. Der „Conducator“ selber, der „Führer der Nation“ Nicolae Ceauşescu sprach zu ihnen über Lautsprecher. Zunächst schienen sich die Menchen noch beruhigen zu lassen. Doch dann mehrten sich die Buh-Rufe und das „Genie der Karpaten“, wie er sich nennen ließ, wurde niedergeschrien. Die Welt schaute dabei zu, denn diese historische Situation wurde live im Fernsehen übertragen und viele Länder rund um den Globus waren zugeschaltet. Während in den Straßen Bukarests der regimetreue Sicherheitsdienst „Securitate“ und die Armee aufeinander schossen – man hörte die Knallerei bei der Fernsehübertragung – wurde die Welt Zeuge, wie sich der Conducator und seine Frau per Hubschrauber vom Dach des Königspalasts, der als Sitz des Zentralkomitees sozusagen das Machtzentrum des Landes war, aus Bukarest absetzten. Ein paar Tage später wurde das Ehepaar, das auf dem Höhepunkt seiner Macht einen Personenkult stalinistischer Prägung um sich entfaltet hatte, von der Armee in den Karpaten dingfest gemacht. Die Offiziere machten im wahrsten Sinne des Wortes kurzen Prozess mit dem abgehalfterten Herrscherpaar. Unter dem Ausnahmerecht, das der Diktator erst wenige Tage zuvor selber in Kraft gesetzt hatte, wurden beide in einem Schnellverfahren zum Tode verurteilt und von einem Exekutionskommando aus Offizieren hingerichtet. Aus den Fenstern des Königspalasts sprachen inzwischen die Vertreter der „Nationalen Rettungsfront“ zu den Massen, allen voran Ion Ionescu, ein unter Ceauşescu in Ungnade gefallener KP-Funktionär, der zum ersten Staatspräsidenten der Nach-Ceauşescu-Ära werden sollte.
All das geht Karl durch den Kopf, als er ein gutes Dutzend Jahre später vor dem Palast steht, einem weiteren Beispiel für die Vorliebe der Rumänen für den neo-klassizistischen Stil, in dem sie noch im 20. Jahrhundert munter weiter bauten, wenn es um Orte der Macht und um staatliche Institutionen generell ging. Für König Carol II. wurde dieses Bauwerk erst 1937 fertig gestellt, nur drei Jahre vor seiner erzwungenen Abdankung.
Rumänien war 1918 nach Ende des 1. Weltkriegs einer der größten Kriegsgewinnler gewesen. Staatsfläche und Bevölkerung hatten sich quasi verdoppelt. Der Name der Hauptstraße, über die Karl weiter nach Süden wandert, war als „Calea Victoriei“ (Siegesstraße) Ausdruck der triumphalistischen Stimmung jener Zeit. Hier flanierte man, hier ging man ins Café. Dass König Carol die Gebietsgewinne durch die politische und militärische Entwicklung zu Beginn des 2. Weltkrieges zwischen den Fingern zerrannen und er die Verluste akzeptieren musste, führte zwangsläufig zu seiner Abdankung.
Der Glanz jener Tage ist verflossen. Der Kapitalismus der nachkommunistischen Ära zeigt seine ersten Resultate mit den Glasfronten neuer Bankgebäude. An der Kreuzung zum Königin-Elisabeta-Boulevard ragt hinter dem schön renovierten „Grand Hotel du Boulevard“ jedoch immer noch ein Hochhaus von monströser Hässlichkeit auf, dass es kaum zu fassen ist. Ein Drahtgerüst „krönt“ dieses Billigwohnhaus mit offenkundigen Anzeichen des Verfalls. Vor dem Offizierskasino gegenüber dem Hotel wirbt die im Umfeld des ehemaligen k. u. k. Reiches stark vertretene österreichische Biermarke Gösser mit grünen Sonnenschirmen zum Verweilen auf dem Platz.
Doch Karl folgt dem Rat Jean-François‘ und macht einen Abstecher von der Siegesstraße in Richtung Universität. Die russische Kirche möchte er in Augenschein nehmen. Die rötlich schimmernden Zwiebeltürme und die Ikonengemälde an der Fassade und über dem Portal zeugen von orthodoxer Frömmigkeit. Mit dem Heiligen Nikolai soll hier wohl kaum der große Conducator verehrt werden. Die hübsche Kirche liegt eingerahmt zwischen sehr schlichten Wohnbauten und bildet mit ihrem goldenen Bogen über dem Eingang einen ästhetischen Kontrast zu der farblosen Umgebung aus kommunistischer Zeit.
Nach diesem religiösen Abstecher von der Siegesstraße kehrt Karl dorthin zurück. Vom Platz mit Grand Hotel und dem pompösen Cercul Militar National, dem Nationalen Militärzirkel, wie das Offizierskasino mit vollem Namen heißt, schaut er nochmals die Calea Victoriei hoch und erblickt den Gegenpol zum Militär, an dem er auf dem Herweg achtlos vorbeigegangen war: Das Café Capşa, der Intellektuellentreff von Bukarest. In einem Gründerzeitbau an der Ecke zur Strada Edgar Quinet mit reich verzierter Fassade und einem von einer Haube gekrönten Eckturm residiert dieses berühmteste und traditionsreichste Kaffeehaus der Stadt, dessen Interieur den Besucher um Jahrzehnte in die Zeit vor den 1. Weltkrieg zurückversetzt.
Karl überquert die Victoriei und strebt der von Jean-François gepriesenen Oase der Ruhe im Großstadtgetriebe entgegen. Vom Südeingang am Königin-Elisabeta-Boulevard betritt er den Cismigiu-Park. Der interessanteste Platz in diesem grünen Herzen der Stadt findet sich an seiner Westflanke. Dort haben die Bukarester den großen Dichtern des Landes einen runden Platz eingerichtet, die Schriftsteller-Rotunde. Den prominentesten Platz nimmt natürlich der Nationaldichter schlechthin ein, Mihai Eminescu, der für die Rumänen mindestens so wichtig ist wie Goethe, Molière und Shakespeare zusammen. Zumindest wird er mit einer solchen Glorie umgeben, die alle Kollegen überstrahlt und jegliche Kritik als unbotmäßig erscheinen lässt. Hier allerdings steht er gleichberechtigt mit seiner weißen Büste auf einem weißen Marmor-Sockel neben elf anderen rumänischen Autoren. Immerhin bleibt ihm die magische Position Sieben vorbehalten. Das Ensemble der Rotunde hat durchaus etwas Magisches. Das „Dichter-Dutzend“ steht im Kreis zwischen hohen Bäumen. Auf der Innenseite dieses Kreises verläuft ein Rundweg für die Verehrer der literarischen Größen sowie natürlich jeden Erholungssuchenden und Gartenliehaber. Sodann folgt zur Innenseite der Rotunde ein Kreis von konisch gestutzen Eiben. Die etwa 2,50 Meter hohen Baumkegel sind bei einem Durchmesser von etwa 1,50 Meter so gesetzt, dass von der Gegenseite der Rotunde jeweils der Blick auf die Stelen und Dichterbüsten frei bleibt. In der Mitte der Rasenfläche des innersten Kreises steht eine große, runde steinerne Vase, aus der dann und wann eine Fontäne emporsteigt. „Ein quasi-religiöser Weiheort zur Würdigung der Dichterfürsten des Landes“, kommentiert Karl in seinem Reisejournal.
Ceauşescus Koloss
Der Stadtwanderer verlässt den Park nach Süden und nähert sich dem Bauwerk, mit dem sich der nach eigenem Ermessen „größte Sohn des Landes“ sein ganz eigenes Denkmal errichtet hat. Es ist jedoch eher ein Mahnmal des Größenwahns. Karl überquert den kleinen Karpatenfluss Dâmboviţa und wird vom Anblick des „Palasts des Volkes“ geradezu erschlagen. Auf einem Hügel türmt sich ein unendliches Steingebirge auf, das zweitgrößte Verwaltungsgebäude der Welt nach dem Pentagon in Washington, dem Verteidigungsministerium für die größte Militärmacht der Welt. Nachdem 1977 bereits ein Erdbeben zahlreiche Häuser der Altstadt zerstört hatte, ließ Ceauşescu ein ganzes Stadtviertel niederreißen, um Platz zu schaffen für sein pharaonisches Vorhaben. Die Stadt trägt noch heute an dieser Verwundung. Das neue Viertel der Macht mit dem dreistufigen Palast auf dem Hügel und dem vorgelagerten Boulevard der Einheit, aus dessen Mittelstreifen abends angestrahlte Wasserspiele hervorquellen, wirken noch immer wie ein Fremdkörper in der Stadt. Die obersten Etagen der Hochhäuser an dem Prachtboulevard der Einheit sind in grotesker Weise mit scheinbar römischen Rotunden versehen, ein architektonischer Versuch, das Rumänien der Neuzeit mit der großen Geschichte Roms zu verbinden.
Bereits zur Regierungszeit Ceauşescus haben die Bukarester sein Bauwerk als „Haus des Sieges über das Volk“ verspottet. Heute beherbergt der ebenfalls neo-klassizistische Mammutbau, der vom Einheitsboulevard wie eine „Burg der Macht“ wirkt, beide Kammern des rumänischen Parlaments, Abgeordnetenhaus und Senat. In die oberen Etagen ist eine internationale Zoll- und Polizeiorganisation eingezogen. An der Rückseite des nun Parlamentspalast geheißenen Gebäudes ist mittlerweile das Nationale Museum für Moderne Kunst beheimatet. So wird immerhin in der Nach-Ceauşescu-Ära der Name „Palast des Volkes“ ein Stück weit wahr.
Vom Ende der „Allee der Einheit“ mit ihren Wasserspielen in der Mitte und den Baumreihen zu beiden Seiten geht Karl über den „Einheitsplatz“ und die Dâmboviţa zurück in den nördlichen Teil der Altstadt und läuft direkt auf das älteste ganz erhaltene Bauwerk der Stadt zu, die im 16. Jahrhundert vom Fürsten „Mircea, der Hirte“ (Mircea Ciobanul) errichtete Alte Hofkirche des Heiligen Anton. Über der kleinen Kirche aus ockerfarbenen Steinen, zwischen denen rötliche Ornamentlinien verlaufen, erhebt sich ein ebenso gemauerter schmucker Haubenturm. Bevor er sich den nebenan stehenden Ruinen des Alten Fürstenhofes zuwendet, geht der Stadtwanderer wenige Schritte zurück und kehrt im berühmtesten und ältesten Lokal der Stadt ein, im „Hanul lui Manuc“ (Manucs Herberge). Der Grundriss des Gebäudekomplexes zeigt die Struktur einer klassischen Karawanserei. Rund um den mit Bäumen und Büschen begrünten Innenhof sind Herbergszimmer und Lagerräume angelegt. Treppen führen hoch zu einem Arkadengang im ersten Stock. Der durstige Karl lässt sich für eine Erfrischung im Hof an einem der zahlreichen Tische unter Sonnenschirmen nieder. An einer der Seiten des rechteckigen Innenhofes ist eine kleine Bühne aufgebaut. „Wer wird denn dort spielen und wann?“ fragt der Tourist den Ober, als dieser das einheimische Silva-Bier serviert. „Da wird heute Abend eine Folklore-Band auftreten“, lautet die Auskunft. Nun weiß Karl auch, wo er den Abend verbringen wird.
Für das Abendessen ist es jedoch noch ein wenig zu früh. Also dreht er eine Runde in der Altstadt. Als er erneut an der Antonskirche vorbeikommt, fallen ihm auch die charakteristischen wellenförmigen Ornamente am oberen Teil der Fassade und am Haubenturm auf. Das Schmuckstück aus dem 16. Jahrhundert ist nur 26 Meter lang und 8 Meter breit. Hier wurden bis 1842 alle Fürsten der Walachei gesalbt. Um sie herum entstand während der Zeit von Mircea dem Hirten der Stadtkern von Bukarest mit Häusern von Händlern und Handwerkern. Vom nebenan gelegenen Alten Fürstenhof (Curtea Veche) stehen nur noch Ruinen.
Derjenige, der den während der Türkenbelagerung zerstörten und später wiederaufgebauten Hof als Erster errichtet hatte, ist eine Berühmheit ganz besonderer Art. Karl ist froh, dass er seinem Geist im Schein der Abendsonne nicht begegnet. Vlad III., auch bekannt als Vlad Ţepeş (Vlad der Pfähler), hatte einen weiteren Beinamen: Drăculea (Sohn des Drachen). Der irische Schriftsteller Bram Stoker hat sich vermutlich von diesem grausamen Herrscher, der Hinrichtungen angeblich mit Vorliebe durch Pfählungen ausführen ließ, zu seinem Roman „Dracula“ inspirieren lassen.
Von Draculas Residenz sind nur noch Reste zu sehen. Eine einzelne gut erhaltene Säule ragt einsam in den Himmel. Von anderen Säulen sind nur die Füße aufgereiht. Auf dem alten Hof waren neue Gebäude errichtet worden. Archäologen mussten diesen Nukleus der Stadt erst wieder freilegen. Alte Mauern, Bogengänge und Kammern sind jetzt als Museum wieder zugänglich.
Über das Kopfsteinpflaster der schmalen Französischen Straße und noch engere Gassen zieht Karl vom Fürstenhof wieder in Richtung Siegesstraße (Calea Victoriei). In diesem alten urbanen Kern keimt in ihm eine Ahnung, welche Art Viertel der neue Drachensohn Ceauşescu seinem Volkspalast geopfert hat. Nicht Pfählung, sondern Kahlschlag und Ausradieren ganzer Nachbarschaften war eine seiner Methoden.
Ein Stück die Siegesstraße hinauf entdeckt Karl ein weiteres Kleinod, die Pasajul Macca-Villacrosse. Durch einen schmalen Eingang in der Geschäftszeile der Victoriei gelangt er in diese gabelförmige Passage aus dem 19. Jahrhundert. Im Bogen zieht sie sich in den Häuserblock hinein. Unter einem gelblichen Glasdach können die Stadtbummler in Geschäften einkaufen gehen, eines der zahlreichen Restaurants und Cafés oder eine Bar aufsuchen. Im ersten Stock haben die Architekten Wohnungen geschaffen. Erst darüber erhebt sich das eigentümlich gelb schimmernde Glasdach. Am Ende des Bogens gelangt der Bummler an den Gabelpunkt unter einer hohen Kuppel. Hier kann man diese Passage zur Strada Lipcani verlassen oder über die zweite Gabelzinke zurück zur Victoriei flanieren. Die Pasajul Macca-Villacrosse entstand nach dem Vorbild ähnlicher Passagen, wie sie im vorletzten Jahrhundert in mehreren Metropolen Westeuropas – etwa in Paris oder Mailand – gebaut worden waren.
Als die rechte Zeit für die Abendmahlzeit gekommen ist, stellt Karl sich wieder in „Hanuls Herberge“ ein. Zu deftigen Fleischspießen, scharf gewürzten Kartoffeln und erfrischendem Silva-Bier wird hier etwas serviert, was Karl noch mehr erfreut als alles Lukullische: rhythmische Musik. Die Folkloregruppe versetzt ihn mit ihrer rasanten Karpatenmusik in Hochstimmung. Der Meister am Hackbrett, das hier Ţambal wie Zimbel heißt, lässt die Klöppel so über die Saiten fliegen, dass der Zuhörer aus dem Staunen nicht herauskommt. Der Rhythmus wird schneller und schneller, plötzlich bricht das furiose Finale ab. Wie beim Jazz bekommen alle Instrumentalisten ihre Soli. Auch Flöte, die Knickhalslaute Cobsă und Violine kommen zum Einsatz. Und dann zeigen die Roma-Künstler in der Tat, was sie können.
Noch ganz aufgewühlt von der energiegeladenen, lebensprallen Musik tritt Karl zu vorgerückter Stunde den Heimweg ins Hotel an. Auf der nun weitgehend menschenleeren Victoriei kommt ihm ein selbstbewusster Halbwüchsiger entgegen, der ihn schon von weitem unverhohlen mustert und schnurstracks auf ihn zugeht. „Sind Sie Amerikaner“, fragt der etwa 16-jährige auf Englisch. „Nein? Franzose? Spanier?“ schickt er in der jeweiligen Sprache hinterher. Karl amüsiert sich über diesen forschen jungen Typen und gibt sich aufrichtig als Deutscher zu erkennen. Nun hat der Junior-Geschäftsmann ein Angebot zu unterbreiten. „Möchten Sie eine schöne Frau?“ fragt er frech. Trotz ablehnender Reaktion lässt er nicht locker: „Lieber einen Mann?“ Karl fragt sich, ob das ein Scherz sein soll oder ob er es mit einem veritablen Jung-Zuhälter zu tun hat. Mit „Nein, danke und gute Nacht“ beendet er das Gespräch. Der Jungunternehmer trollt sich – auf der Suche nach dem nächsten Opfer.
Am nächsten Morgen erinnert sich Karl daran, dass er am übernächsten Sonntag in Berlin den Marathon rennen will. Also schnürt er die Laufschuhe und trabt langsam los. Sein Ziel ist der Parlamentspalast. Am Vortag hat er ihn ja nur von der Nordseite und von der östlichen Vorderfront gesehen. Um das ganze Ausmaß dieses Wahnsinnsgebäudes zu erkennen, dessen Zehntausende Glühlampen wegen Jahreskosten von 1,7 Millionen Euro seit 2008 gegen Energiesparlampen ausgetauscht wurden, muss man es ganz umrunden. Das tut der Langläufer an diesem Morgen und ist letztlich gelangweilt von den immer wieder sich wiederholenden Elementen dieses Steingebirges.
Was Ceauşescu neben seiner Großmannssucht und dem damit gepaarten Personenkult zum Verhängnis wurde, waren neben dem allgemeinwirtschaftlichen Niedergang des Landes insbesondere auch seine radikalen Pläne zur Umgestaltung der Landwirtschaft. Die „Systematisierung“ der Agrarproduktion sah die zwangsweise Zusammenlegung tausender Dörfer und die Umwandlung in agro-industrielle Komplexe vor. Hätte er sein Vorhaben komplett umsetzen können, wären um die 8.000 Dörfer zerstört worden. Die sogenannte „Systematisierung“ hieß deshalb bei den Rumänen „Dorfzerstörungsprogramm“. Das konnte nicht gut gehen. Denn dieses weitgehend agrarische Land ist geprägt von dörflicher Kultur. Und die Rumänen lieben diese kulturellen Wurzeln. Eines der meistbesuchten Museen der Hauptstadt ist deshalb auch das Dorfmuseum, das Muzeul Satului im Herăstrău-Park im Norden der Stadt.
Dorf-Idylle in der Hauptstadt
Einer Empfehlung seines französischen Kollegen folgend, wählt Karl das Satului-Museum als letzte Station seines Aufenthalts in der Zwei-Millionen-Stadt. In der Metropole das Landleben zu erkunden – das hat schon etwas Künstliches. Alles ist idyllisch arrangiert, die irdenen Krüge, die bunten Schalen und Tässchen, die Tiegel und Pfannen in den eineinhalbstöckigen, weißgestrichenen, kleinen Bauernhäusern. Manche sind reetgedeckt, andere mit hölzernen Schindeln. Eine Dorfkirche mit einem Wehrturm gibt es auch. Über dem Quadrat der Brüstung auf mittlerer Höhe, von dem aus die Dörfler nach möglichen Angreifern Ausschau halten können und sie sogar beschießen könnten, ist eine schräg nach oben laufende Haube aufgeständert, auf der wiederum ein Spitzturm mit Kreuz dann doch den religiösen Charakter des Gotteshauses betont. Der Park mit vielen Grünflächen – darunter auch Weiden – muss natürlich bewirtschaftet werden. So tuckert durch das historische Ambiente eine kleine Traktormaschine mit Hänger, um die Heuballen an die Sammelstelle zu bringen – ein klein wenig neue Technik in einem historischen Ambiente, das Ceauşescu „systematisch“ in industrielle Agro-Moderne transformieren wollte.
Das Dorfmuseum ist in den 1930er Jahren errichtet worden, in der Ära von Groß-Rumänien. Als Wahrzeichen dieser Epoche des nationalen Stolzes prangt am Südrand des Parks mitten auf einem Verkehrsknotenpunkt ein veritabler Triumph-Bogen, fast eine Kopie des Pariser „Arc de Triomphe“. Sechs Straßen laufen auf diesem Piaţa Victoriei zusammen, etwas weniger als bei dem Pariser Vorbild Place de l’Etoile.
Der Wunsch nach Größe ist also nicht erst seit Ceauşescu ein rumänisches Charakteristikum. Diese Stadt, der 1977 zunächst ein Erdbeben, dann in den 1980er Jahren ein größenwahnsinniger „Conducator“ Wunden zugefügt hat, ist auf berührende Art wundersam. Verwunderlich ist auch, dass etwas mehr als ein Dutzend Jahre nach dem Ende der kommunistischen Ära noch manche Wunde sichtbar ist. Der „steile Zahn“ von Hochhaus, der wie ein rostiger Nagel hinter dem prachtvollen „Grand Hotel du Boulevard“ in den Himmel ragt, erscheint wie ein Symbol des (noch) nicht überwundenen Verfalls – verwundete, wunderliche Stadt.