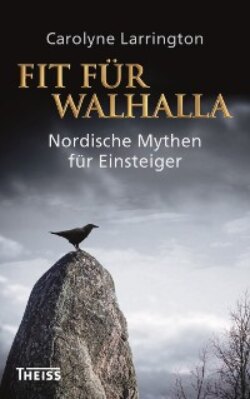Читать книгу Fit für Walhalla - Carolyne Larrington - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Snorri Sturluson und die cleveren Migranten aus Asien
ОглавлениеDoch eine andere, weitverbreitete Theorie war die, welche Snorri Sturluson in dem nachfolgenden Zitat vorträgt: Die sogenannten Götter seien tatsächlich herausragende Menschen gewesen, in diesem Fall Einwanderer aus Troja – ein Konzept, das als Euhemerismus bekannt ist.
Óðinn [Odin] war ein Mann, der durch seine Weisheit und seine vielen Begabungen hervortrat. Seine Frau hieß Frigida und wir nennen sie Frigg. Óðinn war prophetisch begabt, wie auch seine Frau, und so entdeckte er, dass er im Norden der Welt einmal äußerst berühmt werde und höhere Ehren als alle Könige genießen werde. Deswegen brannte er darauf, aus der Türkei wegzuziehen, und brachte eine große Menge Volks mit, Jung und Alt, Männer und Frauen, und mit sich nahmen sie viele kostbare Güter. Doch wohin sie auf dem Kontinent auch kamen: so viel Herrliches sagte man über sie, dass sie eher wie Götter als wie Menschen erschienen.
Snorri Sturluson, Prolog zur Prosa-Edda (um 1230)
Für Snorri Sturluson, den isländischen Gelehrten, Politiker, Dichter und Häuptling des 13. Jahrhunderts, der uns das umfangreichste und systematische Werk über die nordische Götterwelt hinterlassen hat, war der Gedanke bestechend, dass die nordischen Götter – man nannte sie die Æsir – Menschen gewesen sein mussten. Als Nachkommen der Verlierer des Trojanischen Krieges entschieden sie sich, nach Norden zu wandern, und brachten den Eingeborenen des Germanengebiets und Skandinaviens ihre überlegene Technik und Weisheit. Die Kultur der Neuankömmlinge verdrängte die der Alteingesessenen; diese übernahmen die Sprache der Zugereisten und spätere Generationen begannen, die erste Einwanderergeneration als Götter zu verehren.
Snorri Sturluson, der isländische Gelehrte
Snorri Sturluson (1179–1241) gehörte zu einer bedeutenden isländischen Familie und wurde tief in die politischen Turbulenzen in Island und Norwegen hineingezogen. Er verfasste eine als Prosa-Edda bekannte Abhandlung zur Dichtkunst, die aus vier Teilen besteht: einem Langgedicht namens Háttatal („Liste der Versmaße“), das verschiedene Vers- und Strophenformen vorführt, zweitens der Skáldskaparmál („Die Sprache der Dichtung“), aus einer Erklärung der als Kennings bekannten Metaphern (dazu S. 19), einem Prolog und schließlich aus einem als Gylfaginning („Gylfis Täuschung“) bekannten Teil. Snorri wurde von Handlangern des norwegischen Königs in einem Keller seines Heimathofs Reykjaholt auf Island ermordet; seine letzten Worte waren: „Nicht schlagen!“
Die Statue von Snorri Sturluson, des isländischen Gelehrten, Politikers und Dichters aus dem 13. Jahrhundert, in seiner Heimat, dem isländischen Ort Reykjaholt.
Um in seiner Edda zu erklären, wie die traditionelle nordische Dichtung funktionierte, brauchte Snorri eine ganze Menge mythologisches Hintergrundwissen, also schuf er einen erzählerischen Rahmen, der klarstellte, dass zwar heutzutage niemand die heidnischen Götter anbeten konnte – schließlich waren sie bloß ein gerissener Stamm nahöstlicher Migranten –, dass aber die Geschichten, die sich um sie rankten, so tiefsinnig wie unterhaltsam waren. Deshalb stellte Snorri seiner Abhandlung über die Dichtkunst eine Sage um König Gylfi von Schweden voran, der gleich zweimal betört wurde: zuerst von der Göttin Gefjun, wie in Kapitel 1 nachzulesen ist, und dann noch einmal, als Gylfi zu spät begriff, dass er betrogen war, und nach Ásgarðr aufbrach, wo, wie er wusste, die Æsir lebten. Gylfi hatte die Absicht, mehr über diese Betrüger herauszufinden; er erhielt Zutritt zur Königshalle und traf dort drei Gestalten namens Hár, Jafnhár und Þriði („Hoch“, „Ebensohoch“ und „Dritter“). In einem langen Frage-und-Antwort-Spiel fand Gylfi eine ganze Menge über die Götter heraus, über die Erschaffung der Welt und der Menschen, über das Ende der Welt (ragnarök), wenn sich einst Götter und Riesen bekriegen würden, und schließlich darüber, wie die Welt neu geschaffen werden sollte. Und dann, nachdem sie Gylfi geraten hatten, sein neues Wissen gut anzuwenden, verschwanden Hár und seine beiden Kollegen, die mächtige Halle und die eindrucksvolle Festung alle zusammen. Gylfi kehrte heim und berichtete anderen, was er herausgefunden hatte.
Snorri schrieb noch einen zweiten wichtigen Text zu den nordischen Göttern: die Ynglinga saga („Saga von den Ynglingen“), den ersten Teil seiner Geschichte der Könige von Norwegen, der auch unter seinen ersten Worten als die Heimskringla („Erdscheibe“) bekannt ist. Hier verwendete er dieselbe euhemeristische Erklärung für die Æsir wie in seiner Edda, fügte aber weitere Details über ihre Kräfte hinzu und stellte klar, dass sie die Ahnen der Könige Schwedens und Norwegens seien. So rationalisierend und systematisierend Snorris mythologische Schriften verfahren, sie gewähren uns einen unschätzbaren Einblick in ältere Erzählungen über die nordischen Götter und Helden. Dennoch, wenn wir Snorris Werke lesen, müssen wir uns immer vor Augen halten, dass er als mittelalterlicher Christ schreibt und Teile seines Materials entsprechend umformt. So führt er das Konzept einer vorzeitlichen Flut ein, die alle Frostriesen außer einem ertränkt, eine Erfindung vor dem Hintergrund der biblischen Flut, die Noah überlebt, und der dort erwähnten Auslöschung der Riesen. Nirgendwo sonst in der erhaltenen nordischen Überlieferung finden sich Belege für diese Geschichte. Zwar muss Snorri erheblich mehr über nordische Mythen gewusst haben als wir, doch manchmal gibt es auch etwas, das er nicht restlos versteht, und dann erfindet er etwas. Außerdem haben wir den Verdacht, dass Snorri mehr Geschichten kennt, als er uns wissen lässt – so vielleicht Óðinns Opfer „seiner selbst an sich selbst“ an der großen Weltesche Yggdrasill (siehe Kapitel 1). Dieser Mythos vom erhängten Opfergott konkurrierte wahrscheinlich zu unangenehm mit der Erzählung von der Kreuzigung Christi, als dass ein guter Christ ihn leichten Herzens hätte berichten können.
König Gylfi trifft auf Hár, Jafnhár und Þriði. Abbildung aus einer isländischen Handschrift des 18. Jahrhunderts.
Der Codex Regius, eine Handschrift von ca. 1270; hier einige Verse aus der Völuspá (der „Weissagung der Seherin“).