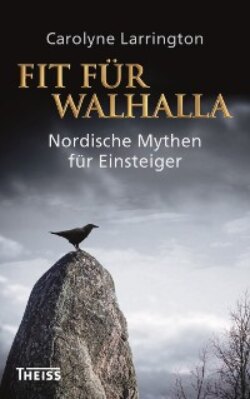Читать книгу Fit für Walhalla - Carolyne Larrington - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zwei Formen der nordischen Dichtung
ОглавлениеWas genau das Wort „Edda“ bedeutet, weiß niemand so genau; diesen Titel hat Snorris Abhandlung in einem der frühesten Manuskripte. Eine mögliche Bedeutung ist „Großmutter“; sie verweist vielleicht auf die Vorstellung, dass mythologisches Wissen alt ist und eng mit Frauen verknüpft. Im Island des 14. Jahrhunderts verwendete man das Wort so, dass es etwas wie „Dichtkunst“ bedeutete. Die altnordische Dichtkunst tritt in zwei Varianten auf. Die eine Sorte ist ausgefeiltes Kunsthandwerk; man kennt sie als Skaldendichtung und sie verwendet ein rätselfreudiges Metaphernsystem, das als Kenning geläufig ist. Eine Kenning der einfachsten Form kann zum Beispiel ein zusammengesetztes Wort sein, etwa „Gedankenschmied“ für „Dichter“ oder „Albenstrahl“ [„Elfenstrahl“] für „Sonne“. Doch viele Kennings sind viel komplizierter und verrätselter; ihre Entzifferung verlangt Kenntnisse in der Mythologie. So müssen wir, wenn wir verstehen wollen, wer wohl der farmr arma Gunnlaðar sein mag (die „Last auf Gunnlöðs Armen“), vorab wissen, dass der Gott Óðinn einmal Grund hatte, die Riesentochter Gunnlöð zu verführen, um den Met der Dichtkunst für Götter und Menschen zu gewinnen (siehe Kapitel 3). Wenn Óðinn auf diese Art beschrieben wird statt zum Beispiel als „der gehängte Gott“, erzeugt das Assoziationen zum Gott als Verführer, als einem, der Göttern und Menschen unentbehrliche Kulturschätze verschafft, und eben nicht als die Figur des Leidenden, der sich selbst an den Weltenbaum hängt, um die Kenntnis der Runen zu erlangen; ein Opfer durch Erhängen zu bringen, ist anscheinend die Óðinn wohlgefälligste Art. Nur ganz wenige mythologische Erzählungen, insbesondere einige Abenteuer von Þórr (Thor), sind in Skaldenversen aufgezeichnet; der Hauptbezug von Mythos und Legende zu dieser Gedichtform besteht darin, dass sie den Metaphern des Kenning-Systems zugrunde liegen.
Die zweite Gattung altnordischer Dichtung nennt man eddische Dichtung. Ihre schlichtere, auf Alliterationen beruhende Form teilt sie mit der frühen Poesie der verwandten germanischen Sprachen Altenglisch und Althochdeutsch. Den Begriff „eddisch“ hat man dieser Gedichtform deshalb beigelegt, weil viele der in ihr abgefassten Geschichten die Basis für Snorris mythologischen Bericht in seiner Edda bilden. Ein Großteil der erhaltenen Dichtung in diesem Versmaß bildet den Inhalt einer einzigen Handschrift, die offiziell als GKS 2365 4to bekannt ist; heute liegt dieser Codex im Handschrifteninstitut von Reykjavík, in der Stofnun Árna Magnússonar. 1662 schenkte ein isländischer Bischof, Brynjólfur Sveinsson, das Manuskript dem König von Dänemark, weshalb es als Codex Regius, als Codex des Königs, bekannt geworden ist. Geschrieben wurde der Codex zwar um 1270 in Island, doch viele Gedichte und ein Großteil der in ihnen enthaltenen Informationen waren Snorri, der um die vierzig Jahre früher schrieb, bereits bekannt. Es ist wahrscheinlich, dass es einige ältere geschriebene Sammlungen mit mythologischer Dichtung und Heldendichtung gab, auf die sich Snorri stützte. Fast alle in diesem Buch zitierten Gedichte stammen aus dieser Sammlung, allerdings gibt es außer den im Codex Regius enthaltenen mythologischen eddischen Gedichten noch einige andere. Dazu zählen Baldrs Draumar („Baldrs Träume“), die den Tod des Gottes Baldr ankündigen, das Hyndluljód („Hyndlas Lied“), worin zahlreiche mythologische Details vermittelt werden, wenn eine Riesin die Ahnen eines Lieblingshelden der Göttin Freyja aufzählt, und die Rigsþula („Rígrs Liste“), die berichtet, wie es zur Entstehung der verschiedenen Gesellschaftsschichten kam. Andere Gedichte im eddischen Stil, die vielfach Geschichten über alte skandinavische Helden erzählen, finden sich in Prosageschichten (Sagas) über Helden der Wikingerzeit; diese kennt man als fornaldarsögur („Sagas der Vorväterzeit“).
Rekonstruierter mittelalterlicher Bauernhof im südisländischen Stöng.
Was man sich in Island erzählte
Saxos Behauptungen, die Isländer erinnerten sich an die Überlieferung der Heldenzeit und gäben sie weiter, werden durch die Tatsache bestätigt, dass unsere beiden Hauptquellen zu den nordischen Mythen und Legenden, die Prosa- und die Lieder-Edda, auf eben dieser Insel im Nordatlantik entstanden sind. Island war im 9. Jahrhundert überwiegend von Norwegen aus besiedelt worden. Der Gründungsmythos der Isländer behauptet, sie stammten von freigeborenen Edlen ab, die sich die Tyrannei König Haraldr Schönhaars nicht gefallen lassen wollten und deshalb auswanderten. Weitere Skandinavier zogen aus den angloskandinavischen Kolonien auf den Britischen Inseln in die neue Siedlung um, und aus den keltisch bewohnten Regionen importierte man Sklaven. Auf den Langschiffen der Siedler müssen auch alte Geschichten aus der skandinavischen Heimat nach Island gelangt sein, die man sich in den kleinen rasengedeckten Bauernhäusern dann ins Gedächtnis rief und vortrug, wenn sich die Hausgemeinschaften während der langen dunklen Winternächte einigelten, und so wurde Island jahrhundertelang ein Hort des Wissens über die heidnische Vergangenheit.