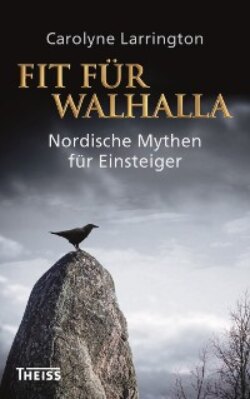Читать книгу Fit für Walhalla - Carolyne Larrington - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Orte und Gegenstände
ОглавлениеAuf die verlorenen Schätze dieses ‚Sparstrumpfes‘ deuten frühe Verweise auf vorchristliche Religionsformen, archäologische Funde und – im Einzugsbereich der altnordischen Kultur besonders wichtig – Steinskulpturen hin. Zwar scheinen viele Rituale der nordischen Religion im Freien stattgefunden zu haben, aber Tempel baute man trotzdem. Ein Bericht aus den 1070ern, verfasst durch den Gelehrten Adam von Bremen, erwähnt den großen Tempel von Uppsala in Zentralschweden. Schweden bekehrte sich um einiges später als Norwegen und Island zum Christentum, und Uppsala war ein Zentrum für alle möglichen Aktivitäten: Politik und Verwaltung, Religion und Recht. Im Tempel von Uppsala thronten, so berichtet uns Adam, Statuen von Thor, Wotan und Frikko (Þórr, Óðinn und Freyr). In der Mitte saß Þórr, die beiden anderen Götter waren links und rechts neben ihm aufgestellt. Nahe beim Tempel stand ein immergrüner Baum und unter ihm befand sich ein Brunnen, in dem man Menschenopfer darbrachte (man ertränkte die Menschen). Menschen und Tiere gleichermaßen opferte man durch Erhängen an dem Baum: Hunde, Pferde und Männer baumelten hier nebeneinander. Wie schon erwähnt, unterstreichen mit Óðinn verknüpfte Mythen die Bedeutung des Hängens als Hauptform des Opfertodes.
Bild des großen Tempels von Uppsala. Im Brunnen sieht man einen geopferten Mann. Aus Beschreibung der nördlichen Völker von Olaus Magnus (1555).
Auch archäologische Funde vertiefen unser Verständnis der nordischen Mythenwelt und vermitteln uns einen Eindruck, wie die in diesen Geschichten erwähnten Waffen, Schilde, Häuser und Schiffe wohl ausgesehen haben. Solche Gegenstände erweitern die Nachbildung der Welten von Göttern und Helden in unseren Köpfen. Einige Grabbeigaben legen nahe, dass manche Männer und Frauen Magie ausübten und in ihren Ritualen geheimnisvolle Objekte verwendeten. Beschreibungen von Schiffsbegräbnissen in mythischen Texten deuten an, dass man Totenboote in Brand steckte oder aufs Meer hinaustreiben ließ. Eine derartige Zeremonie kann so oder so keine archäologischen Spuren hinterlassen haben; gleichwohl beweist das Oseberg-Schiffsgrab, dass man Schiffe tatsächlich als würdige Ruhestätte für die Leiber hochgestellter Männer und Frauen ansah.
Besonders wichtig für eine Bestätigung und Vertiefung der Mythen und Legenden des Nordens sind die wikingerzeitlichen Steinskulpturen – reliefverzierte Bildstelen oder gemeißelte dreidimensionale Darstellungen übernatürlicher oder heroischer Figuren. Erhalten sind sie hauptsächlich auf Inseln, Außenposten der Wikingerdiaspora, wie der Isle of Man oder der Insel Gotland in der Ostsee zwischen Schweden und Finnland, die lange ein Knotenpunkt für Handel und Reisen in den nördlichen Meeren war. Auf Gotland gibt es 475 erhaltene Bildsteine mit gemeißelten Abbildungen komplexer Szenen. Dank der eigenwilligen Details konnte man Óðinn auf seinem Pferd Sleipnir (siehe Kapitel 1), Szenen aus der Legende von Völundr dem Schmied (siehe Kapitel 2) und der Sigurðr-Legende identifizieren (siehe Kapitel 4).
Das Oseberg-Schiffsgrab
Als ein Bauer 1902 in der südnorwegischen Landschaft Vestfold auf seinen Feldern einen Hügel aufgrub, entdeckte er darin Teile eines Schiffs. Im Sommer darauf legten Archäologen der Universität Oslo die Fundstelle frei und deckten ein riesiges Schiff von 21,5 Metern Länge und 5 Metern Breite auf, das reich mit Schnitzereien verziert war. Gebaut worden war es um etwa 820 aus Eichenholz und es konnte von dreißig Ruderern fortbewegt werden. 834 hatte man das Schiff an Land gezogen und als Grab für zwei Frauen von offensichtlich hohem Status verwendet. Eine war zwischen 70 und 80 Jahren alt, die andere wahrscheinlich um die 50; zusammen lagen sie auf einem Bett in einer prächtig geschmückten Hütte, die man hinter den Schiffsmast gebaut hatte. Diese Grabkammer war mit kunstvollen Wandteppichen ausgehangen und enthielt zahlreiche Besitzstücke: Möbel, Kleider, Schuhe, Kämme, Schlitten und ein geschmackvoll verzierter Eimer standen und lagen rund um die Frauen. Auch die Skelette von 15 Pferden, sechs Hunden und zwei kleinen Kühen fanden sich hier. Im Mittelalter hatte man den Hügel aufgebrochen und all die kostbaren Metallobjekte geraubt, die zweifellos einmal vorhanden gewesen waren, doch die Qualität der noch verbliebenen großen, schweren Gegenstände legt nahe, dass es sich bei der älteren Frau gut um eine Königin gehandelt haben kann. Das Oseberg-Schiff und zwei ähnliche Fahrzeuge können Sie im Wikingerschiffe-Museum in Oslo besichtigen.
Das Oseberg-Schiff aus dem 9. Jahrhundert, ausgestellt im Wikingerschiffe-Museum im norwegischen Oslo.
Der Reliefstein aus Austers in Hangvar auf Gotland.
Ein früher Bildstein aus Gotland
Ein faszinierendes Steinbild stammt aus Austers in der Gemeinde Hangvar auf Götland und entstand zwischen 400 und 600 n. Chr. Es zeigt ein vielbeiniges Ungeheuer zusammen mit einer Menschenfigur, die vielleicht ihre Hand ins Maul der Bestie legt oder dieses zumindest am Unterkiefer packt. Man hat diese Szene mit der Geschichte von Týr verglichen, der seine Hand an den kosmischen Wolf Fenrir verlor, aber es braucht schon einige Fantasie, um dieses merkwürdige, tausendfüßlerartige Wesen als Darstellung jenes Tieres anzusehen, das am Weltende Óðinn verschlingen wird.
Manchmal – wie im Fall von Óðinns achtbeinigem Pferd oder den Bildern des Gottes Þórr, wie er mit einem Ochsenkopf als Köder nach der Miðgarðschlange angelt – erscheint ein so spezielles Detail, dass es sich nur als Teil eines ganz bestimmten nordischen Mythos erklären lässt. Dadurch können wir noch bekannte Mythen und Legenden mit Steinskulpturen in der ganzen Wikingerwelt verknüpfen. In jeder einzelnen Gemeinschaft ging die örtliche Überlieferung in ererbte Geschichten ein – nirgends auf verblüffendere Art als auf der Isle of Man, wo man nordische Legenden auf christliche Kreuze meißelte und dadurch in Dialoge mit dem Christentum treten ließ. Motive aus der Geschichte um Sigurðr den Drachentöter konnten an den Kampf zwischen dem Erzengel Michael und dem Drachen in der Johannes-Offenbarung erinnern. Óðinns Tod, der Moment, als er bei der ragnarök vom Wolf Fenrir verschlungen wird, erscheint auf dem Schaft eines als Thorwald’s Cross bekannten Kreuzes (nach dem Bildhauer, der es in Runen signiert hat) aus Kirk Andreas auf Man (siehe Frontispiz). Dieses Bild erzeugt einen mächtigen Kontrast zu Christus, der – anders als der Allvater – nach seinem Tod wieder auferstehen wird. Die Geschichte von Sigurðr erscheint im Bild auch auf Steinen und Kleinobjekten, die vom Wolgagebiet in Russland bis zum berühmten Ramsund-Stein in Schweden verstreut sind (siehe S. 151f.). In späteren Kapiteln werden wir sehen, wie sich die Bilder in die Schriftquellen einfügen.
Mehr und mehr werden neue Funde von Metallobjekten, die oft winzig kleine Figuren darstellen, als Bilder der nordischen Gottheiten angesprochen. Zu ihnen zählen eine kürzlich ausgegrabene Darstellung Óðinns aus Lejre in Dänemark – der Gott sitzt auf dem Thron mit seinen beiden Raben auf der Rückenlehne – und ein faszinierendes Stück mit einer bewaffneten Frauengestalt (einer Walküre), das im dänischen Hårby zutage kam. Sie haben nun ihren Platz neben dem wohlbekannten Bildnis Þórrs aus Eyrarland auf Island (siehe S. 111) und der kleinen Statue mit dem riesigen Phallus aus Rällinge in Schweden, die man für gewöhnlich als Freyr identifiziert. Das Wechselspiel zwischen Archäologie, Mythos und Legende ist dynamisch; Neuentdeckungen geben unserem hypothesenreichen Wissensstand auch weiterhin neue Richtungen und gestalten ihn um.
Þórr und der Riese Hymir angeln und benutzen einen Ochsenkopf als Köder (Kapitel 5). Bild auf dem Kreuz von Gosforth im nordenglischen Cumbria, (wahrscheinlich) aus dem 10. Jahrhundert.
‚Óðinn‘ aus Lejre in Dänemark. Zwei Raben rahmen die Figur, die Frauenkleider trägt.