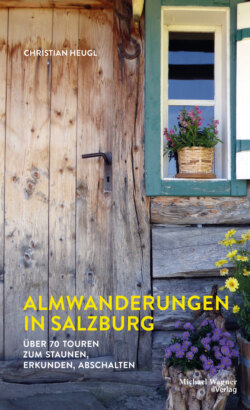Читать книгу Almwanderungen in Salzburg - Christian Heugl - Страница 10
Geschichte der Almen
ОглавлениеDie Ursprünge der heimischen Almwirtschaft gehen rund 4000 Jahre bis in die Bronzezeit zurück. Die Ureinwohner sicherten ihre wirtschaftlichen Erfolge aus der Kupfergewinnung mit einer intakten Versorgungsgrundlage ab, die ihnen das Almwesen bot. Beispiele dieser Verbindung aus bronzezeitlichem Bergbau und den frühesten Almen in Salzburg liefern der Mitterberg in Mühlbach am Hochkönig oder der Bergbau im Oberpinzgau, etwa in Uttendorf (Viertalalm), wo sogar ein ganzes Keltendorf rekonstruiert wurde. Ein praktischer Nebenaspekt des hohen Holzbedarfs für den Bergbau waren die dadurch entstandenen Rodungsflächen, die dann für Weidezwecke und Ackerbau verwendet wurden. Am Dürrnberg bei Hallein, ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. ein Zentrum der Salzgewinnung unter keltischer Führung, lässt sich dieser Zusammenhang auch heute noch gut erkennen.
Auch die römischen Besiedler, die ab Christi Geburt in unser Land kamen und dann knapp 500 Jahre bis zum Beginn der Völkerwanderung blieben, erkannten in dieser klimatisch günstigen Zeit den Wert der Almen und machten sich die fruchtbaren Hochlagen zunutze. Einige romanische Gebietsnamen, wie etwa die Gugelanalm, oder die Oberhellwengalm in der Tauglregion im Gemeindegebiet von St. Koloman (Tennengau), erinnern noch heute an die ursprünglichen Besitzer. Ebenso ist der in einigen alpinen Regionen gebräuchliche Begriff Kaser („casa“ = Haus, Hütte) auf die römischen Vorfahren zurückzuführen. Aus dem romanischen „senior“, also dem Ältesten, der dem Almbetrieb vorstand, ist das eingedeutschte Wort Senner geworden und das Butterfass „cuppa“ veränderte sich umgangssprachlich zum Kübel.
Die 4000 Jahre andauernde Entwicklungsgeschichte der Salzburger Almen verlief allerdings nicht in einer gleichmäßigen Kurve. Die hauptsächliche Schuld an den vielen Rückschlägen trug das Wetter. Neben den klimatisch bevorzugten Zeiten kam es immer wieder zu Kälteeinbrüchen und Gletschervorstößen. Das Hochmittelalter brachte, zumindest für die Land- und Almwirtschaft, wieder ein besseres Klima. Die stark zunehmende Bevölkerung wich in immer höhere Lagen aus und konnte so zur eigenen Versorgungssicherheit beitragen. Im 12. Jahrhundert wurde die uns heute geläufige Form der Almwirtschaft eingeleitet. Es entstanden Gemeinschaftsalmen in der Art, wie sie auch heute noch üblich sind: Mehrere Bauern teilen sich die Nutzung und profitieren von einer gemeinsamen Infrastruktur. Aus den alten Urkunden und Urbaren (Steuerbüchern) lassen sich dazu viele interessante Details herauslesen. In diesen Schriftstücken wurden die erlaubten Auftriebszahlen an Rindern und Schafen sowie die jährlich fälligen Abgaben, meist in Form von Käselaiben, genau festgehalten. Die erste, noch weiter zurückreichende urkundliche und namentliche Erwähnung von Almen und Hochweiden in Salzburg verdanken wir den „ Breves Notitiae“, einem frühen Güterverzeichnis des Erzbistums Salzburg aus der Zeit um 800.
Was diese Alm wohl alles erzählen könnte?
Die Blütezeit der Almwirtschaft dauerte bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Der damals erlangte Höchststand an Almen wurde bis zum heutigen Tag nie wieder erreicht.
Die sogenannte „Kleine Eiszeit“ zwischen 1550 und 1870 führte zu einer allmählichen Veränderung in der Landwirtschaft. Höhepunkt dieser unwirtlichen Phase war das Jahr 1816, das als Jahr ohne Sommer in die Geschichte einging. Hauptursache für den Temperaturabfall war ein Vulkanausbruch in Indonesien, der dazu führte, dass sich eine Schicht aus Asche und Schwefeldioxid in der Erdatmosphäre verteilte und so die Sonneneinstrahlung erheblich einschränkte. Die nördliche Hemisphäre war davon besonders betroffen. So berichtet die Ortschronik von Thalgau von massiven Schneefällen im Juli. Viele Almen und Mühlen wurden in der Folge vorübergehend oder gänzlich aufgelassen. Almauftrieb und -abtrieb glichen durch die kaum vorhersehbaren Wetterextreme einem Lotteriespiel. Die vorherrschende Futterknappheit bedingte gleichzeitig eine wichtige Entwicklung. Die Erfindung der Draisine, einer Vorläuferin des heutigen Fahrrads, wird mit dem verstärkten Ausfall von Reitpferden in Verbindung gebracht.
Aber nicht nur das Klima machte den Almbauern zu schaffen. Waldverordnungen, die das Weiderecht auf den Almen einschränkten, brachten weitere Verschlechterungen. Eine staatliche Kommission stellte dazu im Jahr 1887 fest: "Die Almweide ist ein wichtiges Fundament des Nationalvermögens und Volkswohlstandes. Es sind daher unverzüglich Bestimmungen über Schutz, Pflege und Förderung der Almwirtschaft zu erlassen." Gesetze zum Schutze der Almen wurden im Jahr 1909 verabschiedet, denen in den Hungerjahren nach dem 1. Weltkrieg weitere folgten. Längst wurde die besondere Bedeutung der Almen in Friedens-, aber vor allem in Krisenzeiten erkannt. Die verordneten Arbeitserleichterungen auf der Alm hatten daher auch das vorrangige Ziel, die Lebensmittelversorgung der Not leidenden Bevölkerung zu verbessern. Die Arbeitsbedingungen waren dennoch mühsam, weil vor allem Maschinen und Transportmöglichkeiten fehlten.
Die wichtigste Person auf der Alm war zu dieser Zeit die Sennerin, ihr zur Seite stand der Hüterbub. Er musste Hilfsdienste in allen Bereichen leisten. Ein solcher „Hiata“ schildert den Tagesablauf auf der Loferer Alm im Jahr 1952: „Zwischen 3 und 4 Uhr in der Früh sind wir aufgestanden und haben die Kühe in den Stall getrieben und bei Kerzenlicht gemolken und danach den Rahm mit der Zentrifuge von der Milch getrennt. Später haben wir die Viecher ausgetrieben und den Stall geputzt. Am Vormittag wurde mit dem Rührkübel Butter geschleudert, nach der Mittagszeit wurde Käse gemacht, danach das Vieh gesucht und die Kälber ‚gesalzen‘. Um 4 Uhr wurde das zweite Mal gemolken. Manchmal sind wir am Abend noch zusammengesessen, meist sind wir aber schon beim Essen eingeschlafen.“
Interessanterweise kam es erst um 1952 zu einer ersten bundesweiten Almerhebung in Österreich. Demnach entfielen rund 17.000 km² oder etwas mehr als 20 % der Staatsfläche auf Almen, aber bereits in den wenigen Jahrzehnten bis 1986 gingen schon wieder über 2500 km² der Almfläche verloren. Ein Gebiet in der Größe Vorarlbergs stand nicht mehr als wertvoller Almboden zur Verfügung, sondern wurde großteils wieder zu Wald. So erhalten auch die oft sonderbar anmutenden Almnamen mitten im dichten Wald ihre Erklärung.
Durch verschiedene Förderungsmaßnahmen und auch durch die immer bessere Erreichbarkeit konnte das Almsterben zwar in der letzten Vergangenheit abgefedert werden, aber die Herausforderungen für die Almbauern sind in Zeiten des Klimawandels und der großen Beutegreifer (z. B. Wolf, Bär, Luchs, ...) nicht kleiner geworden.