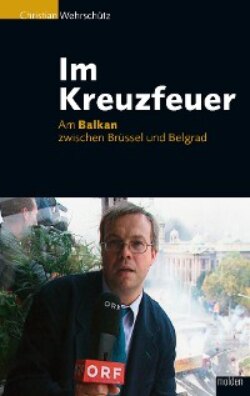Читать книгу Im Kreuzfeuer - Christian Wehrschütz - Страница 14
Der Weg nach Lipovac – Kroatiens serbische Hauptstadt
ОглавлениеNur Bares bringt Wahres:
Mein „Lieblingsdorf“ an der kroatisch-serbischen Grenze
Der 14. Februar 2000 war ein schöner Tag und für mich gleichzeitig der Beginn einer Reise nach Belgrad und durch die „Schluchten des Balkan“, die bis heute andauert. Meinen vorläufigen Entsendevertrag als interimistischer Büroleiter in Belgrad hatte ich bereits im Herbst 1999 unterschrieben, und dann bei der jugoslawischen Botschaft in Wien um das Visum angesucht. Das bange Warten auf das grüne Licht aus Belgrad endete ausgerechnet am 23. Dezember. Die Botschaft rief an und teilte mit, dass mir das Visum erteilt werde. Für mich war diese Nachricht ein wirklich schönes Weihnachtsgeschenk. Auslandskorrespondent zu werden war stets mein Ziel gewesen, und nun stand diesem meinem journalistischen Traumberuf nichts mehr entgegen. Einziger wirklicher Wermutstropfen war, dass ich allein fahren musste. Die politische Lage in Serbien unter Slobodan Milošević war einfach zu unsicher, um die Familie mitnehmen zu können. Außerdem dachte niemand von uns im Traum daran, dass der Balkan zu meiner beruflichen Schicksalsregion werden und der Aufenthalt so lang dauern würde.
Auf die Herausforderungen für die Familie war ich weniger vorbereitet als auf die beruflichen Herausforderungen. Daher verliefen die privaten und beruflichen Vorbereitungen ohne große Aufregung. Als der Tag der Abreise da war, frühstückten meine Töchter Michaela, Immanuela, meine Frau Elisabeth und ich noch gemeinsam und feierten Michaelas 18. Geburtstag. Dann fuhr ich ins ORF-Zentrum am Küniglberg, holte 40.000 DM und den Transporter mit zwei Extrakanistern und fuhr gegen 11 Uhr los – Belgrad entgegen.
Das Geld brauchte ich aus demselben Grund wie die Kanister. Serbien war wegen der Politik seines Autokraten Slobodan Milošević nach langen Jahren des Zauderns und Zögerns von der UNO mit spürbaren Sanktionen belegt worden. Sie ließen sich zwar umgehen, wurden auch umgangen – das machte viele Zwischenhändler und Schmuggler enorm reich –, ruinierten aber langsam das Land und erschwerten das Alltagsleben massiv. Wegen der Sanktionen gab es in Serbien nur eine einzige westliche Bank, aber trotzdem keinen direkten, regulären internationalen Zahlungsverkehr mit dem Westen. Also brauchte ich Geld, denn in Serbien galt die Devise: „Nur Bares ist Wahres“ – und das war nicht der Dinar, sondern die Deutsche Mark, mit der ich zu rechnen lernte wie mit dem Schilling. Hätte ich all das Geld, das ich in den ersten zwei Jahren meines Mandats in meinen Hosentaschen nach Belgrad schmuggelte, vom ORF auf einmal bekommen, wer weiß, ob ich nicht schwach geworden wäre und mich abgesetzt hätte, scherzte ich oft mit meinem Drehteam.
Die Kanister brauchte ich, weil auch ein Öl-Embargo galt, und weil ich nicht sofort auf geschmuggelten und gepanschten Treibstoff angewiesen sein wollte. Wie ich sofort nach meiner Ankunft feststellen sollte, boten Händler diesen minderwertigen Treibstoff auf den Straßen in allen möglichen Ein- und Zwei-Liter-Flaschen an. Diese Tatsache verleitete meine ältere Tochter Michaela bei ihrem ersten Besuch zur verblüfften Frage: „Warum verkauft man in Serbien am Straßenrand Coca Cola in Zwei-Liter-Flaschen?“
Der erste Besuch meiner drei Damen fand erst im Mai statt, nachdem die internationale Gemeinschaft das Flugverbot nach Serbien aufgehoben hatte. Am Flughafen in Belgrad holte ich meine sichtlich nervöse Familie ab. Nach einem kurzen Aufenthalt in meiner Wohnung fuhren wir sofort auf den Kalemegdan – eine Parkanlage auf dem ehemaligen Glacis der Festung von Belgrad – und tafelten in einem Restaurant mit einem wunderbaren Ausblick über die Mündung von Donau und Save. Dabei schwand die Nervosität, die nicht zuletzt Freunde der Familie geweckt hatten. Belgrad und Serbien hatten das Image eines Kriegsgebiets, in dem überall Gefahren lauerten. An seinem schlechten Image ist Serbien leider weitgehend selbst schuld, doch die Realität entsprach auch damals nur teilweise dem Bild, das viele internationale Journalisten gezeichnet hatten. Am folgenden Tag besuchte ich dann noch mit meinen Töchtern den größten McDonald’s im Stadtzentrum. Damit konnte ich meinen Töchtern ein wenig „westliche Normalität“ vermitteln, trotz aller großen Mangel- und Verfallserscheinungen, die Belgrad und Serbien damals von der Müllabfuhr bis zur Stromversorgung gekennzeichnet haben.
Das Auto brauchte ich, weil es wegen der Sanktionen keinen Flugverkehr zwischen Wien und Belgrad gab; wie hätte ich sonst Kanister und Gepäck transportieren und das Geld nach Serbien schmuggeln sollen? Das Fahrzeug bereitete mir ein beträchtliches Unbehagen. Entgegen meiner Bitten und Ratschläge hatte mir mein fürsorgliches Unternehmen einen fast nagelneuen Mercedes-Transporter gegeben, der nur 2.000 Kilometer auf dem Tacho hatte. Für alle Autodiebe, die es damals in Serbien in noch weit größerer Zahl gab als heute, war dieses Fahrzeug ein Objekt der ständigen Begierde erster Ordnung. Was ich mit diesem Auto, das ich in Serbien praktisch nie fahren würde, in den kommenden Monaten noch erleben sollte, wusste ich bei der Anreise allerdings noch nicht.
Als Reiseroute nach Belgrad wählte ich den Weg über Graz, und zwar aus zwei Gründen: Erstens wollte ich noch kurz meine Eltern besuchen, die in Graz wohnen. Zweitens waren die Straßen in Slowenien und Kroatien besser als in Ungarn, obwohl auch der Ausbau der Autobahnen in den beiden ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken noch sehr zu wünschen übrig ließ. Trotzdem gab es ausgebaute Autobahnteilstücke, vor allem von Agram Richtung serbische Grenze und dann durchgehend auf serbischer Seite bis nach Belgrad. Diese Autobahn war noch unter Tito gebaut worden und trug ursprünglich den Namen „Brüderlichkeit und Einigkeit“ (Bratstvo i Jedinstvo), von der im ehemaligen Jugoslawien nichts mehr übrig geblieben war. Andererseits gab es von der ungarischen Grenze bis Belgrad nur eine Bundesstraße und eine Halbautobahn. Diese Straßen galten als sehr unfallreich, und daher wollte ich die für mich völlig unbekannte Strecke in der Dämmerung oder gar am Abend vermeiden. Erwartet wurde ich zwischen 18 und 20 Uhr in einem Hotel in Belgrad und zwar von unserem damaligen Produzenten; seine Mobilnummer hatte ich dabei, und er war zu diesem Zeitpunkt mein einziger Ansprechpartner in Serbien.
Die Fahrt bis Agram verlief problemlos. Doch je weiter ich auf der Autobahn gegen Serbien fuhr, desto unsicherer wurde ich; auf der gesamten Strecke gab es kein einziges Hinweisschild nach Belgrad. Dafür wiederholten sich Straßenschilder mit der Aufschrift „Lipovac“. Diesen Ort konnte ich auf der Straßenkarte nicht finden. Schließlich endete die Autobahn bei Slavonski Brod und mündete in eine Art Bundesstraße, die rechts und links immer dichter von Wäldern gesäumt wurde. Hin und wieder gab es Warnschilder vor Minen entlang der Straße, auf der ich völlig allein unterwegs war. Langsam begann es auch zu dämmern, und mir wurde etwas mulmig zumute. Ich drehte um, fuhr einige Kilometer wieder Richtung Agram, doch nirgends fand ich eine Menschenseele, die ich nach dem Weg hätte fragen können. Schließlich drehte ich wiederum um und beschloss, so lang zu fahren, bis ich auf einen Hinweis stoßen würde, der über Lipovac hinausreichte. Schließlich kam ich zum Grenzübergang Bajakovo/Batrovci zwischen Kroatien und Serbien, vom Reiseziel Belgrad war ich also nur etwas mehr als einhundert Kilometer entfernt. Der Übergang war – von Zöllnern und Polizisten abgesehen – ebenfalls völlig leer. Die Beamten auf serbischer Seite waren von meinem Erscheinen deutlich überrascht. Die Überprüfung meines Visums auf serbischer Seite dauerte fast eine Dreiviertelstunde. Dann durfte ich passieren; 90 Minuten später war ich in Belgrad, und meine Arbeit als Korrespondent in einem Land ohne moderne technische Infrastruktur konnte beginnen.
Büro und Wohnung befanden sich in einer Villa im Nobelbezirk Senjak. Die Telefonzentrale des Bezirks soll zu diesem Zeitpunkt noch aus den 1930ern gestammt haben. Der Zugang zum Internet war ein Glückspiel und für jeden komplexeren Radio-Beitrag musste einen Tag im Voraus ein Studio bei Radio Belgrad angemietet werden. Außerdem lag die Villa viel zu weit weg vom Zentrum, um als Journalist wirklich rasch reagieren zu können. Ich musste daher ein neues Büro mit einer ISDN-Leitung und eine andere Wohnung suchen, mit einem Wort: Den ORF in Belgrad musste ich gänzlich restrukturieren. Ich begann mit dem Aufräumen, weil das Büro seit dem NATO-Krieg im März 1999 praktisch verwaist war. Alle Mietverträge auf Deutsch und Serbisch zu verhandeln war auch eine sprachliche Herausforderung. Doch dank meiner fließenden Russisch- und Ukrainisch-Kenntnisse machte ich auch beim Lernen der serbischen Sprache rasch Fortschritte und mein Jus-Studium half mir bei den Verhandlungen obendrein. In Serbien habe ich mit einem Serben nie ein Interview in englischer oder deutscher Sprache geführt; obwohl ich zu Beginn meine Gesprächspartner sprachlich an ihre serbischen Gastarbeiter in Österreich erinnert haben muss, freuten sie sich sehr über mein Bemühen. Fremdsprachen lernt man nur durch ständiges Üben, Scheu vor Fehlern erschwert die Fortschritte, und scheu bin ich in meinem Leben wirklich nie gewesen.
Bis zum Frühsommer waren Wohnung und Büro bezogen. Wir kamen bei der privaten Nachrichtenagentur BETA als Untermieter im Stadtzentrum unter, die eine der wenigen ISDN-Leitungen in Belgrad ihr Eigen nennen konnte. So waren wir endlich für eine westlichen Standards entsprechende Berichterstattung gerüstet. Als in Belgrad und Serbien die Revolution ausbrach, hätte ich wohl kaum die Aufständischen bitten können, mit dem Umsturz einen Tag zu warten, bis wir entsprechende Leitungen für eine Berichterstattung bestellt hätten. Letzten Endes berichteten wir für Radio und Fernsehen eine Woche lang praktisch rund um die Uhr; mehr als drei Stunden Schlaf pro Tag gab es nicht.
Mein Lieblingsdorf
Wegen meiner Erlebnisse bei der Einreise wurde Lipovac zu meinem „Lieblingsdorf“ am Balkan. Denn auch in späteren Jahren stellten sich meine Erlebnisse keinesfalls als Einzelfall oder als Dummheit eines Greenhorns heraus. Probleme mit der kroatischen Art der Beschilderung hatten auch andere Reisende. Mehrmals wurden wir auf kroatischen Raststationen wegen unseres Belgrader Autokennzeichens gefragt, ob dies auch der richtige Weg in die serbische Hauptstadt sei. An den Verkehrsschildern auf kroatischer Seite hat sich in den vergangenen neun Jahren nur wenig geändert. Zwar sind die megalomanischen Aufschriften „Lipovac“ verschwunden, doch jahrelang gab es im Raum Agram nur Richtungstafeln mit der Aufschrift:
„Budapest, Ljubljana, Maribor, Lipovac“. Statt Lipovac steht nun „Slavonski Brod“, doch das erste Verkehrsschild mit der Aufschrift Belgrad findet man erst etwa sechzig Kilometer vor der Staatsgrenze. Fairerweise muss ich hinzufügen, dass die Orientierung nun weit leichter ist, weil Kroatien die Autobahn bis zur Grenze ausgebaut hat.
Lipovac ist aber nicht nur ein Symbol für die Beharrlichkeit der kroatischen Bürokratie und Straßenverwaltung. Es steht auch für das „herzliche“ Verhältnis zwischen Kroatien und Serbien. Außerdem ist der Ort ein hervorragendes Beispiel für die wechselvolle Geschichte der gesamten Region. Lipovac hat 1.200 Einwohner und gehört mit einigen weiteren Dörfern zur Gemeinde Nijemci, die insgesamt 6.000 Einwohner zählt. Nijemci wiederum liegt in der Gespannschaft Vukovar-Syrmien (Vukovarsko-srijemska županija), denn die 20 politischen Bezirke Kroatiens tragen den Namen Gespannschaft.
Grenzort ist Lipovac erst seit 1945, wobei es nach dem Zweiten Weltkrieg „nur“ an der neu gezogenen administrativen Grenze zwischen Serbien und Kroatien lag. Im völkerrechtlichen Sinn besteht diese Grenze erst seit 1991, seit dem Zerfall Jugoslawiens. Seit damals ist auch die historische Region Srem (kroatisch Srijem) völlig geteilt, und zwar in einen westlichen (kroatischen) und einen östlichen (serbischen) Teil. Während der österreichisch-ungarischen Monarchie lag Lipovac jedoch im Herzen der Region Srem/ Srijem, die bis vor die Tore Belgrads reichte.1) Lipovac trug damals auch den Namen Lipowatz, waren doch etwa ein Drittel der Bewohner Deutsche („Donauschwaben“). Hinzu kamen noch Tschechen, Slowaken und Ruthenen. Nach 1945 wurde die deutsche Volksgruppe vertrieben. Ihre Spuren finden sich nur noch in den Namen der heutigen Bewohner. So heißt der amtierende Langzeitbürgermeister Ivica Klein.2) Er war maßgeblich am Wiederaufbau der Gemeinde nach dem Abzug der serbischen Truppen beteiligt. In die Hand der Serben fiel Lipovac am 17. November 1991 und wurde Teil der sogenannten serbischen Krajina, einem staatsähnlichen Gebilde auf kroatischem Boden, das bis zur Rückeroberung durch kroatische Truppen im Jahr 1995 bestand. Klein erzählt, dass damals den gut gerüsteten serbischen Verbänden nur 300 leichtbewaffnete Kroaten gegenüber gestanden seien. Praktisch alle kroatischen Einwohner flohen.
Interessant war die Region wegen der in der Nähe liegenden Ölvorkommen. Sie soll der serbische Milizen-Führer und mutmaßliche Kriegsverbrecher Željko Ražnatović, genannt Arkan, ausgebeutet und damit gutes Geld gemacht haben. Arkan und seine Tiger-Milizen erledigten die „Drecksarbeit“, also Mord, Vertreibung, Plünderung, für die reguläre Truppen nicht herangezogen werden sollten. Denn der Krieg im ehemaligen Jugoslawien war auch ein Raubkrieg. Gestohlen wurde alles was nicht niet- und nagelfest war, und Häuser wurden bis auf die Grundmauern demontiert und demoliert, ein Umstand, vom dem ich mich noch Jahre später immer wieder selbst überzeugen konnte. So wurden aus den Häusern in der Gemeinde Nijemci auch die Kupferdrähte herausgerissen, erzählt Klein. Bekanntestes Beispiel dieses Plünderungsfeldzuges unter dem Banner nationalistischen Heldenmutes ist Arkan selbst. 1952 in Slowenien geboren, soll Ražnatović in den 1970er Jahren Morde und Raubüberfälle in mehreren Staaten Europas begangen haben. Außerdem soll Arkan in Schutzgelderpressungen und illegales Glücksspiel verwickelt gewesen sein. 1995 heiratete Arkan Svetlana Veličković, genannt „Ceca“, die serbische Ikone des Turbo-Folks. Dabei handelt es sich um eine Musikrichtung, die Elemente der Volksmusik, des Schlagers, des Rocks, Pops und Technos miteinander verbindet und vor allem in Serbien sehr beliebt ist. Die Trauung bezeichneten serbische Medien als die Hochzeit des Jahres, und auch Arkan war als Person durchaus populär, auch ein Zeichen für das Maß des Zusammenbruchs des moralischen Wertesystems im damaligen Serbien. Arkan wurde am 15. Jänner 2000 in der Halle eines Belgrader Hotels erschossen. Die Hintergründe und Auftraggeber der Tat sind bis heute ungeklärt, obwohl die mutmaßlichen Attentäter in Belgrad mehrmals vor Gericht gestanden sind.
Klar ist jedenfalls, dass Arkan auch im kroatischen Vukovar im Einsatz war. Vukovar fiel Ende November 1991 in die Hände der damals nominell noch bestehenden Jugoslawischen Volksarmee. Die Stadt wurde weitgehend zerstört, massive Kriegsverbrechen folgten. Lipovac liegt nicht weit von Vukovar entfernt und soll noch schlimmer ausgesehen haben, erzählt Bürgermeister Ivica Klein. Entdeckt wurde auch ein Grab mit mehr als 20 Leichen, zehn Bewohner aus der Gemeinde werden noch immer vermisst. Klein kehrte das erste Mal am 15. Mai 1996 in seine Heimatgemeinde zurück; damals habe es nicht einmal genügend Raum zur Unterbringung der Entminungsteams gegeben. Doch bereits im November setze die erste Rückkehrer-Welle ein. Anfang Dezember besuchte Staatspräsident Franjo Tuđman die Gemeinde. Doch natürlich kamen nicht alle Vertriebenen oder Flüchtlinge zurück. So verlor die Gespannschaft Vukovar-Syrmien zwischen 1991 und 2001 mehr als zehn Prozent ihrer Einwohner. Trotzdem wurde beim Wiederaufbau viel geleistet. 13 Jahre nach dem Krieg sind keine direkten Schäden mehr zu bemerken; waren bei Kriegsende mehr als 50 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche minenverseucht, sind es nun weniger als fünf Prozent. Für Lipovac ist das sehr wichtig, weil dort Getreide und Viehzucht zur Haupteinnahmequelle zählen, und der Ort vor allem den ländlichen Tourismus entwickeln will. Denn in der Umgebung von Lipovac lässt es sich gut Wandern und Jagen, etwa im Wald von Spaeva, der einer der größten erhaltenen Steineichenwälder Europas sein soll. Fischen kann man an den nahegelegenen Flüssen Spaeva und am Bosut.
Im Gegensatz zur Donau ist die kroatisch-serbische Grenze bei Lipovac bereits demarkiert, und auch ein kleiner Grenzverkehr wurde eingerichtet. In der Gemeinde leben 12 Prozent Serben. Trotzdem zeigen Lipovac und die historische Region Srem/Srijem, in welch großem Ausmaß die blutige Geschichte des 20. Jahrhunderts aus multiethnischen Gebieten ethnisch weitgehend homogene Territorien gemacht hat. Dabei geht es nicht nur um den Zweiten Weltkrieg oder den blutigen Zerfall Jugoslawiens, sondern natürlich auch um andere Faktoren wie etwa die zwischen 1945 und 1948 staatlich betriebene Zuwanderung aus anderen Teilrepubliken. In nicht wenigen Fällen erhielten dabei sogenannte „Kolonisten“ Land und Häuser, die vertriebenen Deutschen gehört hatten. Wie sehr sich die nationale Zusammensetzung der historischen Region geändert hat, zeigen Volkszählungen. So lebten 1910 in Srem/Sriejm 414.234 Einwohner; Knapp 46 Prozent waren Serben, 24 Prozent Kroaten und 30 Prozent andere Volksgruppen (Deutsche, Ungarn usw.). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden allein im östlichen, serbischen Teil knapp 29.000 neue Bewohner angesiedelt. Obwohl die Region bis 1991 nur administrativ geteilt war, erfolgte im kroatischen Teil eine „Kroatisierung“ und im serbischen Teil eine „Serbisierung“ der Region. Diese ethnische Homogenisierung wurde durch den Krieg im ehemaligen Jugoslawien noch drastisch verstärkt. So lebten 1948 im westlichen Teil 70 Prozent Kroaten und 20 Prozent Serben; 2001 waren es 78 Prozent Kroaten und 15 Prozent Serben. Praktisch am Verschwinden waren die Minderheiten; so sank der Anteil der Ungarn von 4,4 auf 1,0 Prozent. Noch drastischer ist das Bild im östlichen, also serbischen Teil: Von 1948 bis zur Volkszählung 2002 stieg der Anteil der Serben von 72 auf 85 Prozent, währen der Anteil der Kroaten von 13,0 auf 2,6 Prozent sank. Was die übrigen Minderheiten betrifft, so sind sie auch im serbischen Teil der Provinz am Verschwinden.3)
All das wusste ich natürlich nicht, als ich im Februar 2000 froh war, mit dem Mercedes-Transporter endlich die kroatisch-serbische Grenze bei Lipovac erreicht zu haben. Heute sehe ich die Chance, dass unter dem Dach der EU diese Grenze dereinst verschwinden und Srem/Srijem wieder zu einer Europa-Region zusammenwachsen könnte. Doch dazu muss Serbien erst EU-reif werden, und dieser Prozess wird noch einige Jahre dauern, obwohl bei gutem Willen auf beiden Seiten, eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit natürlich bereits heute beginnen könnte. Diese Perspektive sieht auch Bürgermeister Ivica Klein in Lipovac; seine Gemeinde hat auf den Straßenschildern an der Autobahn bereits weitgehend der Bezeichnung Slavonski Brod Platz machen müssen. Vielleicht wird die kroatische Straßenverwaltung dereinst auch bereit sein, im Großraum Agram ein Schild mit der Aufschrift „Belgrad“ zu montieren, wenn sich die bilateralen Beziehungen mit Serbien noch weiter normalisiert haben werden.
Darüber und über meine Anreise denke ich oft nach, wenn ich mit unserem langjährigen Fahrer Vlada die Grenze passiere. Das ORF-Büro in Belgrad hat übrigens kein eigenes Auto, weil alle Drehteams ohnedies ihre eigenen Fahrzeuge haben. Taxis und Fahrer sind noch immer weit billiger und sicherer als Kauf und Instandhaltung eines eigenen Autos. Dieses Fahrzeug müsste zudem auf bewachten Parkplätzen stehen, und obendrein gibt es weder vor der Wohnung noch vor dem Büro einen solchen. Außerdem hatten Ausländer zunächst eine weit höhere Maut als Inländer zu bezahlen. Den Mercedes-Transporter haben wir bereits 2000, wenige Monate nach dem Ende des Flugembargos, nach Wien zurückgebracht. In Belgrad nutzte ich ihn aus der begründeten Angst vor Diebstählen nur einmal, und das hätte für mich leicht fatale Folgen haben können. Ich war zur Villa gefahren, in der auch das alte Büro untergebracht war, um die Übersiedlung vorzubereiten. An der abschüssigen Straße, die im Winter ein Alptraum für jeden Fahrer ist, gab es keine Parkplätze. Daher stand der Transporter direkt neben der Hausmauer, und man konnte nur über den Beifahrersitz einsteigen. Als ich an diesem Tag meine Arbeit beendet hatte, ins Auto einstieg und starten wollte, merkte ich, dass jemand versucht hatte das Startschloss zu manipulieren. Die Diebe hatten zwar professionell die Tür geöffnet, waren aber an der Sicherung des Fahrzeuges gescheitert; dabei hatten sie Schloss und Zündung beschädigt. Mir wurde heiß und kalt bei dem Gedanken, was hätte geschehen können, hätte ich die Gauner überrascht, als einer von ihnen noch im Auto saß. Ohne entsprechenden Fluchtweg hätte der versuchte Diebstahl für mich letale Folgen haben können. Sofort verständigte ich mein Drehteam und die Polizei. Nach der Aufnahme aller Daten brachten wir das Auto mit Mühe in Gang, fuhren zum Hotel auf den bewachten Parkplatz und dann zur Mercedes-Niederlassung in Belgrad, einer Firma, die auch in der Zeit der Krise gute Geschäfte in Serbien machte. Der Ersatzteil war nicht auf Lager und es dauerte Wochen, bis er in Belgrad eintraf. Nach der Reparatur und meiner Übersiedlung in die neue Wohnung stand das Auto wochenlang auf dem Parkplatz der österreichischen Botschaft in Belgrad, die uns damals diese Amtshilfe gewährte. Im Sommer brachte ich dann das Auto nach Wien zurück, allerdings über Ungarn und nicht über Lipovac. Dass die Diebe nie gefunden wurden, versteht sich von selbst.