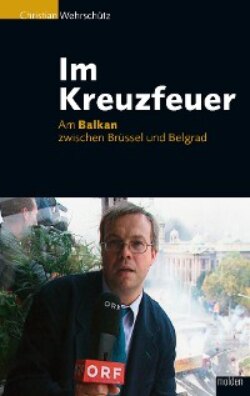Читать книгу Im Kreuzfeuer - Christian Wehrschütz - Страница 17
Josip Broz Tito: Der „gute“ Diktator und seine Nachwirkungen
ОглавлениеTito lebt in der Erinnerung der älteren Generation fort: Im Tito-Mausoleum
Das Haus der Blumen (Kuća cveća) liegt neben einer stark befahrenen Straße auf einer Anhöhe im Belgrader Nobelbezirk Dedinje. An der Straße bin ich oft vorbeigefahren, ohne Titos letzte Ruhestätte zu beachten, denn im Alltagsleben der Serben und in der Tagespolitik spielt der Schöpfer des zweiten Jugoslawien keine Rolle mehr. Doch 2005, zu Titos 25. Todestag, drehten wir einen Beitrag über sein verblichenes Erbe, und so stiegen mein Drehteam und ich die Stufen hinauf, die zum Mausoleum führen. Zunächst galt es, sich bei den beiden Männern auszuweisen, die in einem Wächterhäuschen auf halber Höhe zum Mausoleum unsere Personalien kontrollierten. Der Marschall und jugoslawische Diktator Josip Broz Tito (1892–1980) liebte Blumen, und zu seinen Lebzeiten habe es in dem Anwesen noch viel mehr davon gegeben, versichern die Wachebeamten im „Museum für Jugoslawische Geschichte“, wie das Haus nun heißt. Die Formalitäten sind rasch erledigt, und wir steigen die restlichen Stufen zu Titos letztem Wohnsitz hinauf; vor uns steht im Gras eine große, eherne Figur, die den Marschall in Schrittbewegung und grübelnder Pose zeigt, rechts führt der Weg hinein zum Mausoleum. Vor allem am 4. Mai, an Titos Todestag, ist es der Wallfahrtsort für alle „Jugo-Nostalgiker“, denn im Wintergarten des Hauses der Blumen hat Tito in einem massiven Sarg aus weißem Marmor mit Blick über Belgrad seine letzte Ruhestätte gefunden. Die Besucher kommen aus allen Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawien; vereinzelt haben sie nicht nur ihre Kinder, sondern sogar ihre Enkel mitgebracht, tragen alte Uniformen und Orden. Gemeinsam ist ihnen nicht nur die Trauer um Tito und seinen zerfallenen Staat, sondern auch die Liebe zur Verschwörungstheorie, die den Westen für das blutige Ende des Tito-Staates verantwortlich macht.
Titos Staatsbegräbnis am 8. Mai markierte wohl das bedeutendste Stelldichein der Weltspitze des Jahres 1980 und vielleicht auch eines der höchstrangig besetzten Staatsbegräbnisse des 20. Jahrhunderts. Der sowjetische Diktator Leonid Breschnew war ebenso anwesend, wie der Vizepräsident der USA, Walter Mondale, denn das blockfreie Jugoslawien genoss in der Zeit des Kalten Krieges Bedeutung und Ansehen wie niemals zuvor und auch niemals wieder danach. Wie sehr das Bewusstsein für diese Bedeutung gerade in Serbien verloren gegangen ist, symbolisiert vielleicht recht eindrucksvoll das Schicksal seiner Witwe Jovanka Broz. Jahrelang lebte sie in einer Wohnung in Belgrad ohne nennenswerte staatliche Zuwendung, völlig zurückgezogen und fast wie eine Gefangene. Erst im Sommer 2009 erhielt sie Pass und Personalausweis vom serbischen Innenminister Ivica Dačić. Verschwunden sind in Belgrad und in Serbien praktisch auch alle Straßenbezeichnungen, die an Tito erinnern. Zu finden sind sie bezeichnenderweise noch im albanisch dominierten Preševo-Tal in Südserbien, wo in der gleichnamigen Stadt die Hauptstraße noch immer Titos Namen trägt. Das Straßenschild ist zweisprachig auf Serbisch und Albanisch: Ulica Maršala Tita/Rruga Mareshali Tito.
Ausgestellt sind im Haus der Blumen der Schreibtisch des Diktators, einige seiner Uniformen und die Stafetten, die Pioniere durch das ehemalige Jugoslawien trugen und schließlich Tito übergaben. Dieser Stafettenlauf der Jugend durch das ehemalige Jugoslawien sollte die Einheit des Landes symbolisieren, war aber auch Teil des Personenkults, der um Tito betrieben wurde. Der Stafettenlauf fand von 1945 bis 1987 statt, überdauerte also Titos Tod um sieben Jahre und wurde erst drei Jahre vor Beginn des blutigen Zerfalls des Vielvölkerstaates abgeschafft. Er bestand aus den Teilrepubliken Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Mazedonien und den zwei autonomen Provinzen Kosovo und Vojvodina. Zu den interessantesten Exponaten zählt das „Gästebuch“, in das sich die Besucher von Titos letzter Ruhestätte noch immer eintragen können. Etwa 150.000 Personen kommen jährlich an Titos Grab, sagen mir die Wachebeamten. Viele tragen sich auch in das dicke Buch ein, das praktisch nur Lobeshymnen auf Tito enthält. Lesen kann man da etwa folgende Texte: „Sei gegrüßt, Genosse Tito“; „Du bleibst für immer in meinem Herzen, denn ich habe Dir 15 Monate (in den Streitkräften) gedient“; „vielen Dank für meine schönste Kindheit und Jugend“ oder „teurer Tito, so lange Du gelebt hast, war alles schön. Nach Dir war nichts mehr von Wert“.
All diese Einträge können jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass fast 30 Jahre nach Titos Tod vom Schöpfer der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien in der Tagespolitik der Nachfolgestaaten kaum mehr etwas übrig geblieben ist. Denn die Losung „Brüderlichkeit und Einigkeit“ ging in den Zerfallskriegen am Balkan unter, und Umfragen belegen die großen Vorbehalte, die die Völker gegeneinander hegen – die organisierte Kriminalität ausgenommen. Um diese Vorbehalte zu erkennen, bedarf es nur eines offenen Auges, etwa bei sportlichen Wettkämpfen wie dem Spiel zwischen der kroatischen und der türkischen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Wien. In der Stadt Mostar in Bosnien-Herzegowina, hielten die Kroaten für das kroatische Team, die muslimischen Bosniaken jedoch für die Türkei. Um Ausschreitungen zu verhindern, war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz, trotzdem kam es zu Zusammenstößen. Vor dem Krieg soll Mostar die Stadt mit der größten Zahl gemischter Ehen zwischen Kroaten, Bosniaken und Serben gewesen sein. Während der kroatische und der bosniakische Stadtteil nur mühsam zusammenwachsen, sind die Serben seit dem Krieg aus Mostar praktisch verschwunden. Die Lage in Mostar und der Zerfall Jugoslawiens sind das Ergebnis des Scheiterns von Titos Nachfolger an der wirtschaftlichen und politischen Transformation eines kommunistischen Einparteienstaates, der durch die Person Titos, durch den Partisanenmythos, durch die Armee und von außen durch die Blockkonfrontation zusammengehalten wurde. Der Fall der Berliner Mauer und die Implosion der Sowjetunion ließen somit die Bedeutung Jugoslawiens schwinden; die Welt stand zunächst im Bann ganz anderer Ereignisse, denn auch der erste US-Krieg gegen den Irak fiel in die Zeit des jugoslawischen Dramas, das Europa offensichtlich völlig unvorbereitet traf, obwohl Streitkräfte und Geheimdienste immer wieder Szenarien durchgespielt hatten, wie es nach Titos Tod weitergehen könnte. Trotzdem dürfte die blutige Form des Zerfalls keineswegs zwangsläufig gewesen sein, doch sein Ereignis war so gravierend, dass es Titos Erbe im Bewusstsein der Masse der Bevölkerung unter sich begrub. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch der Zahn der Zeit, denn fast 30 ereignisreiche Jahre haben neue Generationen heranwachsen lassen, die mit ganz anderen Problemen des täglichen Lebens konfrontiert sind als mit Tito und seinem Wirken.
Trotzdem lebt in der älteren Generation noch die Erinnerung an den Roten Pass fort, der den Jugoslawen ein visafreies Reisen in praktisch alle Staaten der Welt ermöglichte. Diese Tatsache spielt vor allem in den Nachfolgestaaten eine Rolle, die wie Serbien noch bis Ende 2009 von der „Papierologie“ der Visaerteilung betroffen sind. Diese Prozedur wird von den Betroffenen als persönliche Erniedrigung empfunden. Viele erinnern sich auch noch an die recht guten Gehälter, die mit relativ wenig Arbeit verdient wurden. Die Nostalgie steigt natürlich mit dem Grad der wirtschaftlichen und sozialen Probleme in den Nachfolgestaaten und dürfte damit in Slowenien und Kroatien am geringsten sein, obwohl keine Umfragedaten zu diesem Thema bekannt sind. Viele Einzelgespräche, die ich etwa in Serbien führen konnte, vermitteln den Eindruck, dass die Erfolge und Misserfolge der aktuellen Regierungen weniger an der Ära des serbischen Autokraten Slobodan Milošević, sondern viel mehr am Lebensstandard im Tito-Jugoslawien gemessen werden. Dieser Blickwinkel macht es freilich jeder Regierung schwer, erfolgreich zu sein, zumal der Kommunismus in Jugoslawien von der breiten Bevölkerung – anders als in vielen Staaten Osteuropas – nicht als gescheitertes Experiment empfunden wird.
Je stärker der Tito-Kult verblasste, je mehr der Partisanen-Mythos aus Geschichts- und Schulbüchern verschwand, desto stärker traten die dunklen Seiten Titos und seines Regimes zum Vorschein, die in der Zeit des Kommunismus unterdrückt, verschwiegen und natürlich auch weder gelehrt noch unterrichtet wurden. In diesem Zusammenhang geht es nicht so sehr um die Vertreibungsverbrechen an den etwa 500.000 Deutschen, die nach dem Ersten Weltkrieg die größte Minderheit im Königreich Jugoslawien bildeten. Vielmehr geht es um die Verbrechen, die kommunistische Partisanen während des Zweiten Weltkriegs und als neue Machthaber in der Zeit danach verübten.
Das Symbol für diese Verbrechen ist die Gemeinde Bleiburg in Kärnten; dort erinnert ein Denkmal an jene Kroaten, die von den Briten nach Kriegsende an die Partisanen ausgeliefert wurden. Die meisten von ihnen wurden in Slowenien ermordet, doch zu den Opfern zählten natürlich nicht nur Kroaten, sondern auch Montenegriner, Serben, slowenische Domobranzen, Angehörige der deutschen Minderheit, Soldaten der Deutschen Wehrmacht, Kärntner, die aus Südkärnten verschleppt wurden, sowie einfache slowenische Bürger, die Gegner der Kommunisten waren. Welches „Schlachthaus“ das kleine Slowenien damals war, zeigt der Umstand, dass slowenische Historiker bisher etwa 570 Massengräber entdeckt haben; die meisten stammen aus der Zeit unmittelbar nach Kriegsende. Wie viele Opfer in diesen Massengräbern verscharrt wurden, steht noch nicht fest, doch schätzt die Wissenschaft, dass es etwa 100.000 sein könnten; einigermaßen gesicherte Angaben liegen nur zu den slowenischen Opfern vor. Nach Angaben von Historikern in Laibach,1) hatte Slowenien während des Zweiten Weltkriegs (1941–1945) 80.000 Opfer zu verzeichnen; 14.500 Slowenen wurden nach Kriegsende ermordet; davon waren 13.000 Soldaten (Domobranzen), der Rest waren Zivilisten. Die Zahl der während des Kriegs in Slowenien ermordeten Personen war somit niedriger als in den ersten Monaten danach.
Zu den Staatsfeinden, die Tito und seine siegreichen Kommunisten während des Kriegs und nach ihrem Sieg ermordeten und bekämpften, zählten auch die Kirchen; sie waren die einzigen Kräfte, die außerhalb der Kommunistischen Partei noch über eine Organisation und über ein geistiges Gegenkonzept verfügten. In Slowenien dokumentierte diesen Kampf im Herbst 2007 eine Ausstellung im Museum für Zeitgeschichte in Laibach unter dem Titel „Der Kampf gegen Glaube und Kirche 1945 bis 1961“. Gestaltet hat die Ausstellung die Historikerin Tamara Griesser Pečar. Nach ihrer Darstellung kamen während des Kriegs 47 Geistliche auf slowenischem Boden um, 46 wurden von den Kommunisten/Partisanen ermordet. Bei Kriegsende gab es etwa eintausend Geistliche in Slowenien; mehr als 400 Prozesse fanden gegen sie statt, mehr als 300 Geistliche wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Nach dem Verbot des Religionsunterrichts an den Schulen im Jahr 1952 griff die Staatsmacht auch zu anderen Mitteln, um die Kirche zu schwächen. So wurden 1.411 Bestrafungen gegen Geistliche ausgesprochen, darunter sehr oft hohe Geldstrafen. Doch auch Kirchen, Friedhöfe und andere kirchliche Objekte wurden zerstört. 2005 schrieb Tamara Griesser Pečar auch ein Buch mit dem Titel „Die Kirche auf der Anklagebank“,2) das bisher jedoch nur in slowenischer Sprache vorliegt.
Doch der Kampf der kommunistischen Partisanen richtete sich natürlich nicht nur gegen die katholische, sondern auch gegen die serbisch-orthodoxe Kirche. Zwischen April 1941 und Mai 1945 wurden nach einem Bericht der Heiligen Erzsynode3) 481 orthodoxe Geistliche ermordet; davon 84 von den deutschen Besatzungsmächten, 171 von den kroatischen Ustaša und 150 von den Partisanen. Nach dem offiziellen Kriegsende verloren weitere 63 Priester ihr Leben, 62 davon durch Partisanen. Von den insgesamt 544 Opfern gehen somit 213 auf das Konto der Partisanen.
Diese Darstellung hat nicht den Zweck, die Geschichte Jugoslawiens während des Zweiten Weltkriegs in Kurzform zu skizzieren. Daher habe ich an dieser Stelle nur zwei Beispiele aus Slowenien und Serbien gewählt, um zu zeigen, in welchem Ausmaß das Tito-Regime auf dem Weg zur Macht und in den ersten Jahren danach blutbefleckte Hände hatte – ein Umstand, der auch in der westlichen Geschichtsschreibung bis heute viel zu kurz kommt; der Kampf der Partisanen war eben nicht nur ein Kampf gegen die Besatzer, sondern hatte auch den Charakter eines Bürgerkriegs. Für die weitere Geschichte des Balkans und den Zerfall Jugoslawiens sollte dieser Umstand eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen, auf die ich in einem anderen Kapitel noch eingehen werde. Ich möchte hier jedoch aufzeigen, dass das kommunistische Jugoslawien sehr wohl von Beginn an und auch im Lauf seines mehr als 40-jährigen Bestehens seine Opfer und Gegner hatte, für die die Lebensgeschichte vieler Dissidenten ein Beispiel bildet.
Diese Gegner ändern nichts daran, dass sich zweifellos die Mehrheit der Bevölkerung mit Tito und seinem eigenständigen Weg identifizieren konnte, zumal nach der Absetzung von Aleksandar Ranković als jugoslawischer Innenminister und Chef des Sicherheitsapparats im Jahr 1966 auch eine deutliche Mäßigung des Regimes einsetzte. Außerdem erreichte die Bevölkerung einen Lebensstandard, der weit über jenem lag, der in den entwickeltsten Ländern des Ostblocks herrschte. Erreicht wurde dieser Standard nicht zuletzt durch den Tourismus, durch den ständigen Geldstrom der Gastarbeiter sowie durch die außenpolitische Schaukelpolitik zwischen Ost und West, die Tito nach dem Bruch mit Stalin 1948 auch westliche Hilfe bescherte.
Hinzu kommt das große internationale Ansehen, das Jugoslawien unter Tito genoss, dessen Dissidenten – mit Ausnahme vielleicht von Milovan Đilas – in der westlichen Presse nie jene „Popularität“ erreichten oder gar gegen das Tito-Regime in Stellung gebracht wurden, wie das bei der Sowjetunion der Fall war. Hinzu kommt, dass in seiner reiferen Phase natürlich auch der Kommunismus jugoslawischer Prägung nicht mit dem sowjetischen Totalitarismus gleichgesetzt werden darf.
Diese Differenzierung ist jedoch für die Opfer der Verfolgungen in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und für deren Hinterbliebene ebenso wenig ein Trost wie für jene Personen, die später als politische Gegner verfolgt oder schikaniert wurden. Denn eine juristische Aufarbeitung dieser Taten oder gar eine Entschädigung der Opfer ist bisher praktisch nicht erfolgt, obwohl es etwa in Slowenien oder Serbien zu Rehabilitierungen von Personen kam, die nach 1945 von der kommunistischen Justiz und vom Staatssicherheitsdienst verfolgt wurden. Diese Verfolgung erstreckte sich auch auf die Diaspora, ein Kapitel, mit dem sich westliche Historiker bisher in viel zu geringem Ausmaß befasst haben.
Stützen konnten sich Tito und sein Regime zweifellos auch auf das Image des (Mit-)Siegers im Zweiten Weltkrieg, das den Teilrepubliken Slowenien und Kroatien nicht unerhebliche Gebietsgewinne einbrachte. Hinzu kam der Rückhalt in den neu gebildeten, beziehungsweise wieder erstandenen Teilrepubliken Mazedonien und Montenegro. In der Zeit des Königreichs Jugoslawien wurde Mazedonien als Südserbien bezeichnet, während Montenegro nach dem Anschluss an Serbien nach dem Ende des Ersten Weltkriegs als Staat von der Landkarte überhaupt verschwunden war. Unter Tito kehrte Montenegro als Teilrepublik des kommunistischen Jugoslawien wieder auf die Landkarte zurück und erhielt seine Institutionen, nicht aber seine autokephale Kirche zurück. Diese Autokephalie wurde mit Hilfe der Kommunisten in Mazedonien in den 1960er Jahren aus der Taufe gehoben, doch die mazedonische Orthodoxie ist auch mehr als 40 Jahre später von der serbischen Orthodoxie nicht anerkannt worden; daher ist der Kirchenstreit noch immer ungelöst.
Die Nachfolgestaaten
Ihre heutigen Grenzen – und in gewisser Weise ihre Existenz – verdanken die meisten Nachfolgestaaten, also Slowenien, Kroatien, Mazedonien, Montenegro und der Kosovo dem kommunistischen Jugoslawien. Das sind historische Faktoren, die natürlich die Bewertung Titos beeinflussen und einer Enttitoisierung Grenzen setzen. Das zeigt das Beispiel Slowenien sehr deutlich. Dort setzte mit dem Sieg der konservativen Koalition unter Ministerpräsident Janes Janša im Herbst 2004, in zeitgeschichtlicher, innenpolitischer und gesellschaftlicher Hinsicht die Enttitoisierung ein, wie viele zeitgeschichtliche Ausstellungen4) in Slowenien belegen. Unter „Enttitoisierung“ werden dabei nicht nur die Demokratisierung, sondern auch die umfassende Transformation des Gesellschafts- und Parteiensystems sowie der vom Kommunismus geprägten Mentalität der Bevölkerung verstanden. So wird etwa privates Unternehmertum und Wohlstand oft mit Bereicherung und Korruption assoziiert, also negativ gesehen, und auch das Arbeitsrecht in so manchen Nachfolgestaaten Jugoslawiens weist durchaus noch kommunistische Züge auf.
Entscheidend für die Frage von Kontinuität und Diskontinuität ist nicht zuletzt das Schicksal der Nachfolgeparteien des Bundes der Kommunisten in den ehemaligen Teilrepubliken. Die Transformation zu Sozialistischen und Sozialdemokratischen Parteien weist hier große regionale Unterschiede auf; der Erfolg der Transformation sowie die politischen Fähigkeiten der handelnden Personen entschieden dabei auch über Verlust oder Erhaltung der Macht. Am erfolgreichsten war dabei Montenegro. Symbol dafür ist der 1962 in Nikšić geborene Milo Đukanović. 1979 wurde er Mitglied des Zentralkomitees des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens, und mit 29 Jahren – mit Unterstützung des serbischen Autokraten Slobodan Milošević – jüngster Ministerpräsident in Europa. Dieses Amt übte er bis 1998 aus; anschließend war er bis 2002 Präsident Montenegros und von 2003 bis 2006 wiederum Ministerpräsident, ein Amt, das Đukanović kurzfristig abgab, um in diese Funktion im Februar 2008 zurückzukehren.
Ebenso eindrucksvolle Beispiele für große persönliche Kontinuität gepaart mit politischer Diskontinuität sowie für den Wandel vom kommunistischen Saulus zum nationalistischen Paulus finden sich auch in Slowenien und Kroatien in Milan Kučan und Franjo Tuđman. Der 1941 geborene Milan Kučan wurde 1986 Vorsitzender des Bundes der Kommunisten Sloweniens, und von 1991 bis 2002 war er Präsident des unabhängigen slowenischen Staates. Zwar konnten sich in Slowenien die Post-Kommunisten (ZLSD) nach der Unabhängigkeit nicht als führende Kraft behaupten; doch abgesehen von einem kurzen politischen konservativ-katholischen Zwischenspiel in den Jahren 1990 bis 1992 und von Juni bis November 2000, kamen zwar die Post-Kommunisten nicht wieder an die Macht; trotzdem gelang keine konservative Wende, denn die Linke konnte sich in Form der 1994 gegründeten Liberaldemokratischen Partei bis zu den Wahlen im Herbst 2004 an der Macht halten, und in deren Koalitionsregierungen waren bis auf ein Kabinett die Post-Kommunisten ständig vertreten. Der Machtwechsel erfolgte erst, nachdem Slowenien mit dem Beitritt zu EU und NATO endgültig in den euroatlantischen Gemeinschaften angekommen war.
Noch tiefer als in Slowenien reicht in Kroatien die persönliche Biografie des Symbols der Unabhängigkeitsbewegung in die kommunistische Ära zurück. Der 1922 geborene Franjo Tuđman war aktiver Teilnehmer an der „antifaschistischen Partisanenbewegung“ und General der Jugoslawischen Volksarmee, ehe er sich in den 1970er Jahren zum Regimegegner und kroatischen Nationalisten wandelte. Nach 1987 warb er massiv bei der Diaspora um Unterstützung für die Unabhängigkeit und gründete 1989 in Kroatien die HDZ, die „Kroatische Demokratische Gemeinschaft“. Diese Partei stellte eine völlig neue politische Kraft dar; ihr Aufstieg dürfte vor allem dem Umstand zu verdanken sein, dass es die kroatischen Kommunisten nicht verstanden, sich an die Spitze der Unabhängigkeitsbewegung zu stellen. Die HDZ siegte bei den ersten Wahlen in Kroatien, bei denen Parteienpluralismus herrschte. In weiterer Folge führte Tuđman Kroatien durch Krise wie Krieg und verhalf seinem Land zum Sieg über die serbische Okkupation der von Serben bewohnten Teile Kroatiens. Durch seine nationalistische Politik brachte er Kroatien aber auch in die außenpolitische Isolation. Zum Machtwechsel kam es erst unmittelbar nach Tuđmans Tod, und eine Mitte-Links-Koalition unter Führung der Sozialdemokraten begann erste Reformen. Sie erreichte auch eine Verbesserung der Beziehungen zum Westen, nicht zuletzt durch eine Zusammenarbeit mit dem Haager Tribunal. Doch diese Koalition verlor die Parlamentswahl im Herbst 2003 und unter Ivo Sanader kehrte eine erneuerte national-konservative HDZ als stärkste Partei in einer Mitte-Rechts-Regierung an die Macht zurück. Sanaders größte politische Leistung ist es, die HDZ transformiert und auf einen klaren euroatlantischen Kurs gebracht zu haben. Größter Erfolg in dieser Hinsicht war 2009 die Aufnahme Kroatiens in die NATO, während der Beitritt zur EU vor allem wegen des Grenzstreits mit Slowenien noch einige Jahre auf sich warten lassen könnte.
Wie die Beispiele Slowenien und Kroatien zeigen, lässt sich eine dauerhafte Stabilisierung im ehemaligen Jugoslawien unter anderem nur erreichen, wenn zwei Grundvoraussetzungen gegeben sind: Die eine ist ein politischer Konsens über die zentralen außenpolitischen Ziele als Grundlage für eine konsistente Reformpolitik; die zweite Grundvoraussetzung ist die erfolgreiche Transformation des Parteiensystems. Das gilt sowohl für nationalistische Parteien, die im Zuge des Zerfalls des alten Jugoslawien entstanden sind, aber natürlich auch für die kommunistischen Parteien in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien. Während Slowenien und Kroatien Beispiele für eine erfolgreiche Transformation dieser beiden Parteientypen sind, bildet Serbien das Gegenbeispiel, weil in diesem Land bisher weder die Transformation der Sozialistischen Partei (SPS) noch der ultranationalistischen Serbischen Radikalen Partei (SRS) als abgeschlossen bezeichnet werden kann. Der Einfluss der SRS geht seit 2008 durch die Abspaltung des gemäßigten Flügels allerdings zurück. Trotzdem hat in Serbien auf vielen Gebieten vielleicht die umfassendste Abkehr von Tito stattgefunden.
Serbien war neben Montenegro der älteste Staat im ehemaligen Jugoslawien. Doch – wie bereits erwähnt – verlor Montenegro seine staatliche Existenz nach dem Ersten Weltkrieg durch den Anschluss an Serbien und sogar der Name verschwand; dagegen waren Serbien und seine Dynastie der Karađorđević die führende Macht im Königreich Jugoslawien. Die Monarchie war in der serbischen Bevölkerung tief verankert, die Kommunisten waren schwach, und nach der Niederlage gegen das Deutsche Reich im April 1941 waren die königstreuen Četniks als Widerstandsbewegung gegen die Besatzungsmächte in Serbien wohl zunächst weit stärker als die Tito-Partisanen. Auf diesen Umstand verweist auch Hermann Neubacher5), der als Sonderbeauftragter des Reichsaußenministeriums ab 1943 auch für Serbien zuständig war:
„Serbien war, als ich meine Mission antrat, eine der schwächsten Positionen des Balkan-Kommunismus. Der überwiegend agrarische Charakter des Landes (über 80 Prozent bäuerliche Bevölkerung) verwies den Kommunismus auf die wenigen Industriegebiete und auf die Hauptstadt Belgrad, wo die Universität ein Hauptstützpunkt der KP geworden war. Das Bauerntum dieses Landes war patriarchalisch, gegen Neuerungen zutiefst mißtrauisch, durch Jahrhunderte türkischer Hörigkeit zum verschlagenen, hartnäckigen Widerstand bis zur Meisterschaft erzogen. Ich sah in diesem serbischen Bauerntum eine der stärksten Positionen gegen die Bolschewisierung des Balkans und stellte daher die Beendigung der bisherigen Sündenbock-Politik Serbien gegenüber in den Mittelpunkt meiner politischen Planung. Das bedeutet aber – und daraus möge man die Schlüsselstellung der Serben auf dem Balkan ermessen – nicht weniger als eine weitgehende Revision der deutschen Politik im Südostraume.“
Unabhängig davon, ob diese Einschätzung in der zweiten Hälfte des Kriegs noch zutreffend war oder nicht, konnte der Oberösterreicher Neubacher beim Oberösterreicher Hitler in Berlin diese Neuorientierung der Serben-Politik nicht durchsetzen; trotzdem wurde Neubachers Ansatz von den kommunistischen Partisanen offensichtlich als Bedrohung empfunden. So heißt es in der Anklageschrift des Militärprokurators beim Belgrader Kreisgericht von 1951 gegen Neubacher:6)
„Die Grundlinie Neubachers bestand darin, zwecks Schwächung der Partisanenbewegung die Politik eines Groß-Serbien mit Hilfe Nedićs wieder aufleben zu lassen, die Verräter Draža Mihailović und Ljotić zur Mitarbeit zu gewinnen und gegenüber Serbien eine Politik der Durchführung der Sühnemaßnahmen auf eine neue Art zur Anwendung zu bringen … Bei dieser Gelegenheit änderte er die alten Bestimmungen über die Durchführung der Sühnemaßnahmen, die politisch fehlerhaft und schädlich für die Interessen des faschistischen Deutschland waren.“
35 Jahre später sollte dieses Thema noch eine Rolle spielen, und zwar im berühmten „Memorandum der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste“ aus dem Jahr 1985. Über die Vertretung von Serben in der kommunistischen Führung während des Zweiten Weltkriegs heißt es in dem Memorandum7):
„Während des Krieges war Serbien bei der Verabschiedung von Beschlüssen, welche die zukünftigen zwischennationalen Beziehungen und die jugoslawische Gesellschaftsordnung bestimmen sollten, nicht vollkommen gleichberechtigt beteiligt. Der Antifaschistische Rat Serbiens wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 gegründet, also später als in den anderen Teilrepubliken, die Kommunistische Partei Serbiens sogar erst nach Kriegsende.“
Das Gefühl, wirtschaftliches und politisches Opfer im kommunistischen Jugoslawien gewesen zu sein, zieht sich durch das gesamte Memorandum und die gesamte Schrift. Schwaches Serbien und starkes Jugoslawien – dieses (vermeintliche) Credo Titos spiegelt auch die kommunistische Verfassung aus dem Jahr 1974 wieder. Sie sah sechs Teilrepubliken (Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Mazedonien und Serbien) und zwei autonome Provinzen (Kosovo und Vojvodina) vor. Diese Gliederung empfanden Teile der intellektuellen Elite Serbiens offensichtlich als Ungerechtigkeit, wie die Publikation8) der Serbischen Akademie der Wissenschaften zeigt:
„Obwohl Serbien nach Größe und Einwohnerzahl die größte der Teilrepubliken ist, verlor es mit der Verfassung aus dem Jahre 1974 wichtige Attribute der Staatlichkeit. Die Gefahr der Desintegration bedrohte nicht nur Jugoslawien, sondern auch Serbien. Die beiden autonomen Provinzen Serbiens, ausgestattet mit den realen Rechten der Teilrepubliken, schränkten Serbien bei der Verabschiedung von selbständigen und für das Funktionieren der Republik wirksamen Beschlüssen ein. Die Provinzen bildeten sogar Koalitionen mit den restlichen Teilrepubliken, weshalb Serbien regelmäßig auf Bundesebene in der Minderheit war. Dieses eigenartige Phänomen lässt sich leicht deuten, wenn man den ausschlaggebenden Einfluss von Tito, dem Kroaten, und Kardelj, dem Slowenen, auf die Zusammensetzung des Führungskaders in den Provinzen bedenkt.“
Als diese Bewertung 1996 in deutscher Sprache gedruckt wurde, war es bereits fast zehn Jahre her, dass Slobodan Milošević bei der berühmten „Achten Sitzung“ des Zentralkomitees der serbischen Kommunisten im September 1987 seinen Mentor Ivan Stambolić entmachtet hatte. Als Aufstiegshilfe diente Milošević die Kosovo-Frage, dessen Autonomie er ebenso beseitigte wie die der Vojvodina. Unter Milošević wurde das Mehrparteiensystem in Serbien eingeführt, und aus den Kommunisten wurde im Juli 1990 die Sozialistische Partei Serbiens. Doch der einsetzende Parteienpluralismus führte nicht zu umfassender Demokratisierung, sondern zu einer Welle des serbischen Nationalismus und zum blutigen Zerfall des Tito-Staates, eine Entwicklung für die Milošević und sein System zweifellos die Hauptverantwortung, aber keineswegs die Alleinverantwortung tragen.
„Rest-Jugoslawien“
Zehn Jahre später, am 5. Oktober 2000 stürzte Milošević; er wurde am 28. Juni 2001 an das Haager Tribunal ausgeliefert – dem Veitstag, also dem Tag der Schlacht am Amselfeld (1389), dem Tag der Ermordung von Franz Ferdinand in Sarajevo (1914), dem Tag des Ausschlusses der Kommunistischen Partei Jugoslawiens aus der Komintern (1948) und nicht zuletzt am selben Tag, an dem 1989 Milošević am Amselfeld zum 600. Jahrestag der Schlacht eigentlich eine recht banale Rede gehalten hatte. Doch von dem versprochenen „himmlischen Serbien“ blieb nach Kriegen, zehntausenden Toten, hunderttausenden Flüchtlingen und Vertriebenen sowie Krisen nur ein weitgehend ruiniertes Land übrig. Die endgültige Auflösung des Tito-Staates war damit aber noch nicht erreicht, denn noch bestand die Bundesrepublik Jugoslawien, gebildet von den ungleichen „Brüdern“ Serbien und Montenegro; ungeklärt war auch der Status des Kosovos, der nach dem NATO-Krieg des Jahres 1999 unter UNO-Verwaltung stand.
Doch die Beseitigung „Rest-Jugoslawiens“ erwies sie als zähe Angelegenheit, obwohl an den Tito-Staat in Belgrad nur mehr Straßennamen erinnerten und erinnern (Sarajevo Straße, Zagreber Straße). Die EU war mehrheitlich gegen die Auflösung des „Rests“, Serbien leistete hinhaltenden Widerstand, und Montenegro war in der Frage der Unabhängigkeit tief gespalten. Zunächst verschwand daher der Staatsname und zwar im Februar 2003 mit der Bildung des Staatenbundes Serbien und Montenegro. Dieser „Untote“ vegetierte drei Jahre dahin, ehe er mit dem Unabhängigkeitsreferendum in Montenegro im Mai 2006 zur Fußnote der Geschichte wurde. Doch weder die Loslösung Montenegros noch die Unabhängigkeitserklärung des Kosovos im Februar 2008 musste Milošević erleben, denn er starb im März 2006 in seiner Zelle in Den Haag.
Der Tod ihres Vorsitzenden bedeutete vor allem für die SPS eine wichtige Zäsur. Denn nach Miloševićs Sturz stürzten auch seine Sozialisten in eine tiefe Krise, und bei den folgenden Parlamentswahlen in Serbien konnte die Fünf-Prozent-Hürde immer nur knapp gemeistert werden. Milošević hatte den Begriff „sozialistisch“ zutiefst diskreditiert, und seine Frau Mira Marković hatte mit ihrer Phantompartei der „Jugoslawischen Linken“ (JUL) ebenfalls ihr Scherflein dazu beigetragen. Die JUL gebärdete sich als kommunistische Bewegung, doch vor der Parteizentrale parkten die deutschen Luxusautos ihrer Spitzenfunktionäre, weil die Partei vorwiegend aus Personen bestand, die im Milošević-System zu Macht und Reichtum gekommen waren, während die Serben zunehmend verarmten. Serbien fehlte in den Jahren der beginnenden Transition eine starke sozialdemokratische/ sozialistische Partei, die für die Armen, Arbeitslosen und für die Opfer der Reformen eintrat. Dieses Vakuum füllte in immer stärkerem Ausmaß die ultranationalistische Radikale Partei (SRS) aus, die Miloševićs Koalitionspartner gewesen war.
Miloševićs eigene Partei wurde dagegen zunächst immer mehr zu einer Randerscheinung. Ihre Wählerschaft ist ziemlich alt und lebt in der Provinz und zwar in kleinen Städten. Diese Wähler sind keine Nationalisten, sondern „Milošević-Nostalgiker“, wobei Milošević zu Beginn seines Aufstiegs von nicht wenigen für einen neuen Tito gehalten wurde. Zu den Wählern der SPS zählen daher viele alte Kommunisten und pensionierte Offiziere niedriger Dienstgrade. Die Existenz der Sozialisten war damit eindeutig bedroht, daher gab es bereits zu Lebzeiten von Milošević zaghafte Ansätze für einen Transformationsversuch; als solcher ist die Unterstützung der Minderheitsregierung des nationalkonservativen Ministerpräsidenten Vojislav Koštunica zu werten (Kabinett Koštunica I, Februar 2004 bis Mai 2007). Letzterer kann wohl als politischer Träger der Enttitoisierung in Serbien bezeichnet werden, die mit nationalistischen, großserbischen Vorzeichen unter Slobodan Milošević begann. Diese Neuinterpretation der Geschichte, die Serbien praktisch nur als Opfer Titos sah, führte auch zu einer völligen Abkehr von der antifaschistischen Traditionslinie, die das alte Jugoslawien in die Reihe der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs gestellt hatte. Diese geistige Abkehr zeigte sich auch in der Tagespolitik; daher fehlten unter Koštunica mehrmals Vertreter Serbiens bei Feiern anlässlich des Sieges über Deutschland oder aus Anlass der Befreiung eines Konzentrationslagers. Folgerichtig fällt in die Zeit des Kabinetts Koštunica I auch ein weiterer Schritt der Enttitoisierung Serbiens. So wurden per Gesetz die ehemaligen Četniks den Partisanen in sozialrechtlicher Hinsicht gleichgestellt.
Doch richtig beginnen konnte die Transformation der Sozialistischen Partei Serbiens (SPS) erst nach Miloševićs Tod. Die Anrede „Genosse“ tauchte in den Wahlkämpfen wieder auf, und Arme, Pensionisten sowie „soziale Gerechtigkeit“ wurden als Zielgruppen und Themen entdeckt. Die SPS will nun eine moderne Linkspartei sein und in die Sozialistische Internationale aufgenommen werden. Wie groß die Chancen für eine rasche Aufnahme sind, ist offen, denn vor allem in den sozialdemokratischen Parteien des ehemaligen Jugoslawien regt sich massiver Widerstand. Mittelfristig ist die Aufnahme wohl wahrscheinlich, weil die Sozialisten gemeinsam mit den pro-europäischen Kräften in Serbien nun eine Regierung gebildet haben. Dieses Kabinett hat zum ersten Mal die berechtigte Chance, volle vier Jahre zu halten, und Serbien nahe an die EU heranzuführen.
Die europäische Perspektive und die Chance der SPS nun international „salonfähig“ zu werden dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Sozialisten bisher jede Bereitschaft vermissen ließen, mit der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit zu beginnen. Im Gegenteil: Im Wahlkampf für die Parlamentswahl im Frühsommer 2008, wurde Milošević weiter als Werbeträger jedenfalls für die eigenen Funktionäre eingesetzt. Nicht zu erwarten ist eine Vergangenheitsbewältigung – sollte sie nicht von außen eingefordert werden – auch wegen der personellen Kontinuität der Führung. So war der SPS-Vorsitzende, der 1966 geborene Ivica Dačić, von 1992 bis 2000 Pressesprecher der Milošević-Sozialisten, und die sozialistische Parlamentspräsidentin war unter Milošević in führenden Parteifunktionen tätig. Prüfstein für den Grad der sozialistischen Transformationsbereitschaft in der Tagespolitik wird nicht die weitere Zusammenarbeit mit dem Haager Tribunal sein, die Serbien auf dem Weg Richtung EU zum Abschluss bringen muss, weil nur mehr zwei mutmaßliche Kriegsverbrecher zu verhaften sind. Vielmehr geht es um die Frage, wie die SPS die Milošević-Erblast aufarbeitet; ein umfassender Bruch mit der Ära Milošević wird jedoch sehr schwierig sein und viel Zeit brauchen.
Doch für seine dauerhafte Stabilisierung bedarf Serbien entweder der Transformation oder der Marginalisierung der Serbischen Radikalen Partei (SRS), deren Vorsitzender Vojislav Šešelj sich seit Februar 2003 wegen des Vorwurfs der Kriegsverbrechen vor dem Haager Tribunal verantworten muss. Im Herbst 2008 kam es zum Bruch zwischen Šešelj und seinem langjährigen Weggefährten und Stellvertreter Tomislav Nikolić. Auslöser war die gegensätzliche Haltung zur EU-Integration Serbiens. Nikolić folgte ein beträchtlicher Teil des Parlamentsklubs der SRS, wobei nun diese „Dissidenten“ die SNS, die Serbische Fortschrittspartei, gründeten; sie will eine nationalkonservative Kraft sein. Hat die SNS Erfolg – und darauf deuten Lokalwahlen in einigen serbischen Gemeinden hin – könnte das die Transformation des serbischen Parteiensystems beschleunigen und damit dem Land größere Stabilität verleihen. Erst wenn die SRS zu einer Randerscheinung und aus der SNS eine serbische HDZ geworden sein wird, kann dieser Prozess als abgeschlossen betrachtet werden. Doch sowohl im Fall der kroatischen HDZ als auch im Fall der serbischen Sozialisten konnte die Reform dieser Parteien erst nach dem Tod ihrer „Überväter“ Franjo Tuđman und Slobodan Milošević durchgeführt werden. Erleichtert wurde die Transformation der HDZ noch durch den Umstand, dass Franjo Tuđman „rechtzeitig“ starb und so einer möglichen Anklage durch das Haager Tribunal entging.
Verzögert und belastet wurden und werden die (partei-)politischen Transformationen durch die ungeklärte nationale Frage. Zwar kann die Dissolution des Tito-Staats seit der Unabhängigkeitserklärung des Kosovos im Februar 2008 als formal beendet betrachtet werden, doch hat sich Serbien mit dem Verlust des Kosovos bisher nicht abgefunden. Zwar ist es durchaus wahrscheinlich, dass dieser Prozess in praktischer Hinsicht mit einer pro-europäischen Regierung einhergehen wird, gesichert ist dieser Trend jedoch nicht. Bis zur Erkenntnis, dass das serbische Volk nach dem Scheitern der Politik von Slobodan Milošević nur unter dem Dach der EU wieder ohne Grenzen wird leben können, ist der Weg noch weit. Obwohl Serbien neben Montenegro der einzige Staat im ehemaligen Jugoslawien ist, der auf eine lange Staatlichkeit zurückblicken kann, muss Serbien in gewisser Hinsicht als Staat wider Willen bezeichnet werden, während in Montenegro die Nationsbildung erst im Gang ist. Denn so sehr Serbien die Hauptverantwortung für den Zerfall des ehemaligen Jugoslawien trägt, so sehr fühlten sich viele Serben von den anderen Teilrepubliken verraten, weil sie den gemeinsamen Staat verließen. Belgrad benahm sich in dieser Hinsicht ähnlich einem Ehepartner, der den anderen schlecht behandelt und dann enttäuscht ist, weil sich der scheiden lässt. So war der erste Akt, mit dem Serbien die eigene Staatlichkeit aus eigenen Stücken beschritt die Verabschiedung seiner eigenen Verfassung; doch dieses Referendum fand erst Ende Oktober 2006 und damit sechs Jahre nach dem Sturz von Slobodan Milošević statt. Während Serbien mit dem Bau eines viel kleineren „Hauses“ beschäftigt ist, geht es bei Montenegro, Bosnien, dem Kosovo und Mazedonien noch immer um die Nationsbildung. All diese Republiken erhielten ebenso wie Slowenien und Kroatien unter Tito ihre heutigen Grenzen, doch nur in den national weitgehend homogenen Staaten Slowenien und Kroatien steht die Nation außer Streit.9) In Montenegro existiert eine beträchtliche Volksgruppe, die sich als serbisch betrachtet, und der Kosovo ist als Ergebnis des Kriegs nun national weitgehend homogen, doch lehnen die Serben im von ihnen kompakt besiedelten Norden die Unabhängigkeit strikt ab. In Bosnien leben Kroaten, Bosniaken und Serben seit dem Krieg nebeneinander, und noch kann nicht einmal von Verfassungspatriotismus gesprochen werden. Mazedonien wiederum stand durch den Aufstand der Albaner 2001 am Rande des Zerfalls, ein Prozess, der neuerlich einsetzen könnte, wenn die euroatlantische Integration durch den Namensstreit mit Griechenland noch viele Jahre auf sich warten lässt.
Sowohl das Königreich Jugoslawien als auch das kommunistische, von Tito geschaffene Jugoslawien sind in letzter Konsequenz an der ungelösten Nationalitätenfrage gescheitert, obwohl natürlich auch die Auseinandersetzung der Großmächte eine Rolle spielte, die ebenfalls auf dem Balkan ausgetragen wurde. Doch die Hauptkräfte des Zerfalls sind in den beiden Jugoslawien selbst zu suchen und zwar nicht zuletzt in den großen wirtschaftlichen, kulturellen und historischen (Entwicklungs-)Unterschieden. Sie beschreibt der serbische Dichter und Schriftsteller Jovan Dučić10) so:
„Für die Kroaten war der Jugoslawismus eine großserbische Falle, eine politische Perversität, eine balkanische Verschwörung gegen die katholische Kirche, das kroatische Staatsrecht, die westliche Kultur und gegen das Verständnis über Ordnung und Gesetzlichkeit. Die Gesetzlichkeit, wie sie das kroatische Volk, obwohl oft gedemütigt, in der Habsburger Monarchie kannte, stellte dennoch eine der mustergültigsten Verwaltungen und eine beispielhafte Justiz in Europa dar. Um einen jugoslawischen Staat zu bilden, musste man auch ein jugoslawisches Volk schaffen, und eine jugoslawische Sprache haben … Doch die Sprache nannten die einen Serbisch, die anderen Kroatisch. Wenn man noch die wechselseitige, jahrhundertelange Unduldsamkeit, den religiösen Unterschied, die kulturelle Mentalität berücksichtigt, dann konnte eine derartige Nivellierung und Vermischung nicht für durchführbar erachtet werden in einer derart unerwarteten staatlichen Verbindung, die niemals und durch nichts vorbereitet oder gar vorhergesehen war.“
Diese Darstellung trifft für die Schaffung des „Staates der Südslawen“ nach dem Ersten Weltkrieg mit großer Sicherheit zu. Trotzdem, und aller wechselseitigen Gräueltaten während und nach dem Zweiten Weltkrieg zum Trotz, sind die staatsbildenden Völker des ehemaligen Jugoslawien Nachbarn, lebten mehr als 70 Jahre in einem Staat und weisen zum Teil eine große sprachliche Nähe auf. Diese Vorteile haben slowenische und in weiterer Folge auch kroatische Firmen erkannt, die in immer stärkerem Ausmaß im ehemaligen Jugoslawien investieren. Diese Investitionen werden wohl keine Einbahnstraße bleiben, wenn auch die anderen Staaten größere Reformerfolge vorweisen können. Daraus wird kein neues Jugoslawien entstehen, denn diese Idee ist ebenso tot wie Tito. Seine abschließende historische Bewertung durch „seine“ ehemaligen Völker steht zwangsweise noch; zu groß sind die Probleme des Alltags, zu gering ist der historische Abstand, und Tito und sein Staat sind derzeit offensichtlich kaum Gegenstand seriöser historischer Forschung. Offen bleibt daher, wie die massenhaften Verbrechen dereinst bewertet werden, die Titos Kommunisten während des Zweiten Weltkriegs und danach begangen haben. Dabei geht es nicht um die Frage der Verbrechen an sich, sondern darum in welchem Ausmaß sie das Bild des erfolgreichen Staatsmanns prägen werden, der den „Jugoslawen“ in den 1970er Jahren ein hohes Maß an Wohlstand aber auch an relativer Freiheit beschert hat. Sicher ist, dass Tito und seine Nachfolger mit ihrem Konzept gescheitert sind, und damit einen weiteren Beweis dafür geliefert haben, dass sich mit Zwang auf Dauer kein Staat zusammenhalten lässt. Historisch betrachtet erwies sich auch Jugoslawien als eine der vielen Fehlkonstruktionen, die die Westmächte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zu verantworten haben. Möglich sind jedoch Zusammenwachsen und Aussöhnung unter dem Dach von EU und NATO; auf diese Weise könnte auch die Nationalitätenfrage endgültig gelöst oder weitgehend bedeutungslos werden, die dem Balkan am Ende des 20. Jahrhunderts zum zweiten Mal binnen 50 Jahren einen Bürgerkrieg und einen Sezessionskrieg bescherte und das ehemalige Jugoslawien hoffentlich zum letzen Mal zum Kriegsschauplatz werden ließ.