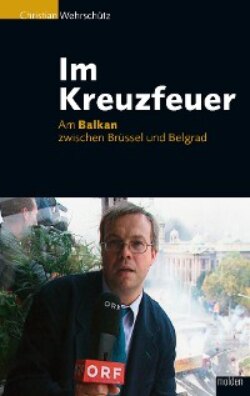Читать книгу Im Kreuzfeuer - Christian Wehrschütz - Страница 20
„Točno – Tačno“
Оглавление„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“
Ludwig Wittgenstein „Tractatus logico-philosophicus“
Sitzung der bosnischen Wahlkommission vor einem „dreisprachigen“ Plakat
Mitte Juni 2008 fand in Brdo bei Krainburg/Kranj in Slowenien das Gipfeltreffen zwischen der EU und den USA statt. Eine bunte Schar von Journalisten bevölkerte das Pressezentrum, und die EBU, die European Broadcasting Union, war gemeinsam mit dem slowenischen Staatsfernsehen für die technische Abwicklung zuständig. Das betraf den Schnitt der Beiträge aber auch die Liveeinstiege, bei denen der Journalist als Analytiker oder Kommentator selbst zu sehen ist. Für diese Direktübertragung waren zwei nebeneinanderliegende Kamerapositionen aufgebaut. Das EBU-Team und daher auch der Kameramann kamen aus Serbien, aus Kostengründen und natürlich auch wegen der geografischen Nähe zu Slowenien. Meinen Liveeinstieg wickelte ich zeitgleich mit einem deutschen Kollegen ab. Bis zum Beginn der Sendung unterhielt ich mich mit dem Kameramann; das hörte auch mein Nachbar, der seine Sendeleitung darüber folgendermaßen aufklärte: „Ich bin nicht allein hier; neben mir steht der Kollege des ORF, der sich gerade auf Slowenisch mit dem Kameramann unterhält.“ Doch es war nicht Slowenisch, sondern Serbisch, denn der serbische Kameramann war des Slowenischen gar nicht mächtig.
Das Unvermögen, Serbisch von Slowenisch zu unterscheiden, sei dem Kollegen nachgesehen, kam er doch aus Brüssel und nur zur Berichterstattung nach Brdo. Doch diese Unkenntnis ist kein Einzelfall, sondern eines von vielen Beispielen, wie gering das Wissen von vielen Journalisten, aber auch von Politikern und erst recht aller „Nicht-Balkanesen“ war und ist, die über das Schicksal des ehemaligen Jugoslawien zu berichten oder zu bestimmen hatten und haben. Unkenntnis (und Desinteresse) der Entscheidungsträger ist für mich daher auch einer der Gründe, warum es zum blutigen Zerfall des Tito-Staates kam. So erzählte mir vor vielen Jahren ein ehemaliger österreichischer Spitzenpolitiker über ein Gespräch, das er Anfang der 1990er Jahre mit einem belgischen Kollegen in Brüssel führte. Etwa eine Stunde lang bemühte sich der Österreicher, dem Belgier die verworrene Lage zu erklären, um schließlich mit dem Satz konfrontiert zu werden: „Ich verstehe den Konflikt immer noch nicht, denn die sprechen doch eh alle Jugoslawisch!“ „So wie Sie hier Belgisch“, lautete die ironische Antwort des Österreichers.
„Jugoslawisch“ hat es im Vielvölkerstaat Jugoslawien nie gegeben, wohl aber eine Sprachenpolitik, die versuchte, der nationalen Vielfalt Rechnung zu tragen und gleichzeitig die Einheit des Landes zu stärken. So lernten die Slowenen Slowenisch, die Mazedonier Mazedonisch, beides Sprachen, die sich doch recht deutlich voneinander und vom „Serbokroatischen“ oder „Kroatoserbischen“ unterscheiden, das in Serbien, Kroatien, Bosnien und Montenegro gesprochen wird. Serbokroatisch, das zur Gruppe der sogenannten südslawischen Sprachen gehört, war denn auch die Verkehrssprache im alten Jugoslawien. Diese „Lingua franca“ wirkt heute noch nach; beobachten lässt sich das bei Treffen zwischen Slowenen und Mazedoniern der älteren Generation, die sich dann des Serbokroatischen und nicht des Englischen bedienen. Doch auch diese Verkehrssprache hatte ihre Besonderheiten. Zunächst wurde sie mit zwei Alphabeten geschrieben. Die Kroaten bedienten und bedienen sich des lateinischen Alphabets, die Serben lernten und lernen in den Grundschulen aber auch das kyrillische Alphabet, und offizielle staatliche Publikationen wie zum Beispiel Gesetze werden in Serbien in kyrillischer Schrift gedruckt.
Serbokroatisch – Kroatoserbisch?
Dieses kyrillische Alphabet ist übrigens in seiner Entstehungsgeschichte zutiefst mit Österreich verbunden, denn der Vater der serbischen Schriftsprache, Vuk Karadžić (1787–1864), war mit einer Österreicherin verheiratet und verbrachte den Großteil seines Lebens in Wien, wo er auch starb. Erst 1897 wurden seine sterblichen Überreste nach Belgrad überführt und dort beigesetzt. Auch die erste serbische Grammatik wurde in Wien gedruckt.
Der zweite große Unterschied liegt in der Schreibweise, die sich auch auf die Aussprache auswirkt. So sprechen die Kroaten die ijekavische und die Serben die ekavische Variante; die Kroaten sagen daher rijeka (Fluss) oder svijet (Welt), die Serben jedoch reka und svet. Der dritte Unterschied besteht in historisch gewachsenen Ausdrucksweisen und beim Serbischen im großen Einfluss türkischer Wörter, die in die Sprache eingegangen sind. So sagen die Kroaten točno (genau), kruh (Brot), sretno (froh), die Serben sagen tačno, hleb und srečno. Doch die Serben sagen auch komšija (das türkische Wort für Nachbar), die Kroaten sagen susjed, ein Wort, das auch in anderen slawischen Sprachen vorkommt. In einem Lehrbuch der serbokroatischen Sprache1) ist der jeweils andere Ausdruck in Klammern angeführt. Über die serbokroatische Sprache heißt es in der Einleitung:
„Im Lauf der Geschichte haben sich Zagreb und Belgrad zu politischen, Kultur- und Literaturzentren entwickelt, denen zwei Varianten der Schriftsprache entsprechen. Der Hauptunterschied ist lautlicher Art und besteht in der Verwendung der ije- bzw. e-Mundart; daneben gibt es gewisse Unterschiede im Wortschatz, an die man sich an Ort und Stelle leicht gewöhnt.“
Das ist völlig richtig, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Doch es muss auch die Bereitschaft dazu vorhanden sein; denn einem Kroaten fällt es eben (unangenehm) auf, wenn man statt „dobar tek“ (Mahlzeit) „prijatno“ sagt. Für den Ausländer sind diese Unterschiede meistens nicht fassbar, und auch der Anfänger hat noch im wahrsten Sinn des Wortes kein Ohr dafür. Als ich in der Oberstufe meiner Gymnasialzeit in Graz einige Zeit das Freifach „Serbokroatisch“ besuchte, erzählte ich freudig einem Kroaten, dass ich nun Serbokroatisch lerne. Die Antwort fiel für mich verblüffend aus: „Diese Sprache gibt es nicht. Es gibt nur Serbisch oder Kroatisch.“ Das Gleiche hätte ich wohl auch von einem Serben hören können. Trotzdem kann ich Serbisch, Kroatisch, Bosnisch und Montenegrinisch im Grunde nur als eine Sprache begreifen – alle Linguisten mögen mir verzeihen – denn ich habe nur „Serbisch“ gelernt, kann mich aber überall verständigen und die Zeitungen all dieser Länder lesen. Unbestritten ist jedoch, dass jeder Staat und jedes Volk seine Sprache so nennen kann, wie das von der Mehrheit der Bevölkerung gewollt wird. Doch ich bin Journalist, nicht Linguist, und in dieser Darstellung geht es nicht um Linguistik, sondern um die praktischen und politischen Aspekte der Sprachenfrage.
Zur Illustration soll hier ein Witz, der unter Belgrader Taxifahrern kursiert, herhalten: Ein Kroate fährt in Belgrad mit dem Taxi, will schließlich zahlen und fragt nach dem Preis: „Tri hiljade Dinara (Dreitausend Dinar) antwortet der Taxifahrer. „Koliko je to u tjsucima“ (Wie viele Tausend sind das?), fragt der Fahrgast, das kroatische Wort für Tausend verwendend. „Šest tjsuca“ (Sechstausend), antwortet der Fahrer.
Dabei muss bereits jetzt betont werden, dass die Sprachenfrage weit mehr ist als eine Marotte, die in den betroffenen Staaten auch für tagespolitisches Kleingeld verwendet wird. (So wurde etwa der kroatische Staatsgründer Franjo Tuđman in Kroatien dafür kritisiert, dass er bei einem offiziellen Anlass statt sretno (froh, glücklich) srečno gesagt hatte.) Vielmehr sind damit auch Kosten verbunden, die der europäische Steuerzahler bereits jetzt mitzutragen hat und die noch größer werden dürften, sollten Kroatien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Serbien dereinst alle EU-Mitglieder sein. Doch zunächst zur historischen Entwicklung. War die politische Führung mit ihrer Sprachenpolitik im ehemaligen Jugoslawien bestrebt, die vorhandenen Unterschiede einzuebnen, so setzte mit und nach dem Zerfall des gemeinsamen Staates der gegenläufige Trend ein. Trennung war angesagt, und Kroatien soll seine Linguisten sogar zu den burgenländischen Kroaten entsandt haben, um zu den Wurzeln der kroatischen Sprache zurückkehren zu können. Völlig beseitigt wurde natürlich der Unterricht der kyrillischen Schrift, mit Ausnahme in jenen Schulen, die die serbische Minderheit in Kroatien besucht. Je weiter die Kriegszeit zurückliegt, je mehr sich die kroatische Nation festigt und je mehr die „Angst“ vor einem neuen Jugoslawien schwindet, desto ungezwungener wird auch der Sprachgebrauch werden, jedenfalls im täglichen Leben. Trotzdem lässt sich in der Bürokratie und beim Protokoll noch immer für Verwirrung sorgen, wenn man als Ausländer mit „Serbisch“ auftritt. So war vor einigen Jahren Bundeskanzler Wolfgang Schüssel auf Besuch in Agram/Zagreb. Am Abend gab es einen Empfang, zu dem Journalisten jedoch nicht zugelassen waren, doch der Bundeskanzler wollte mich sprechen. Beim Eingang teilte ich den Sicherheitsbeamten mit, ich sei der Korrespondent des ORF, und der Bundeskanzler wollte mich sprechen. Nach einigem Hin und Her gelang es einem Vertreter der österreichischen Botschaft, mich ins Gebäude zu bringen. Auf dem Weg zum Kanzler erzählt mir der Diplomat, ein kroatischer Protokollbeamter sei ganz ungläubig gekommen und habe gesagt: „Draußen steht ein Journalist, der behauptet, der Bundeskanzler wolle in sprechen; er behauptet Österreicher zu sein, doch er spricht Serbisch.“
Solche Anekdoten bereichern das journalistische Leben; doch wie katastrophal die Folgen einer verfehlten Sprachenpolitik für ein Land sein können, zeigt das Beispiel von Bosnien und Herzegowina. Dort gibt es drei offizielle Sprachen: Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Bereits die Bezeichnung „Bosnisch“ wird in Bosnien von Kroaten und Serben als eine Art der sprachlichen Hegemonie abgelehnt. Für diese beiden Volksgruppen ist aber „Bosniakisch“ annehmbar als Bezeichnung der Sprache, die die Bosniaken, die Muslime in Bosnien, sprechen. Doch abgesehen von der Bezeichnung hat auch die Existenz der drei sogenannten Sprachen der drei konstitutiven Völker dieses Staates mit etwa vier Millionen Einwohnern praktische Folgen. Offizielle Texte werden in drei Sprachen und zwei Alphabete (Latein und Kyrillisch) übersetzt, obwohl man Unterschiede oft mit der Lupe suchen muss. Dessen sind sich natürlich auch Politiker, Bürokraten und Juristen aller drei Volksgruppen bewusst; sie haben daher ihr Möglichstes getan, um künstlich Unterschiede zu schaffen. Ein Beispiel dafür ist das eingangs abgedruckte Plakat, auf dem Bosnisch, Serbisch und Kroatisch „Wahlkommission“ zu lesen steht; das Bosnische unterscheidet sich vom Serbischen nur durch die Schrift, vom Kroatischen aber dadurch, dass für das Wort Kommission ein eigenes kroatisches Wort verwendet wird. Das wirkt sich natürlich bei der Rechtsterminologie besonders negativ aus, weil es die Bildung eines einheitlichen Rechtsraumes zusätzlich erschwert. Zum Tragen kommt diese Sprachenpolitik auch bei internationalen Verträgen, wie das Beispiel des Doppelbesteuerungsabkommens zeigt, das Bosnien und Herzegowina mit Österreich 2008 unterzeichnet hat. Das Papier wurde in fünf Sprachen unterfertigt: Deutsch, Englisch, Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Die Fama berichtet, dass eine Sachbearbeiterin in Österreich in Sarajevo nachgefragt haben soll, ob nicht irrtümlich zweimal dieselbe Fassung (Bosnisch/Kroatisch) nach Wien übermittelt wurde. Eine Überprüfung ergab nur minimale sprachliche Unterschiede zwischen beiden Texten. Vereinbart wird in derartigen Fällen, dass zur Vertragsauslegung das Dokument in englischer Sprache herangezogen wird. Das Beispiel des Doppelbesteuerungsabkommens lässt erahnen, in welchem Ausmaß sinnlos Papier produziert wird, denn was für Österreich gilt, wird wohl auch für die Rechtstexte der EU gelten. Deren gemeinsamer Rechtsbestand umfasst etwa hunderttausend Seiten. Dabei zeigt gerade die EU-Annäherung, dass Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro von der gemeinsamen Sprache profitieren können. Der Rechtsbestand wurde bereits ins Kroatische übersetzt, und Serbien und Montenegro möchten davon auch Gebrauch machen; doch bisher soll es nicht zur Weitergabe der Übersetzungen gekommen sein, denn dann könnte in der EU wohl jemand auf die Idee kommen, die Sprachen der vier Beitrittswerber als eine Sprache zu begreifen. Im Sand verlaufen sind bisher auch alle zaghaften Initiativen in Brüssel, diese vier Staaten auf dem Weg Richtung EU zu einer gemeinsamen Sprache zu bewegen. Doch was im Fall Österreichs und Deutschlands möglich ist, sollte erst recht für das ehemalige Jugoslawien durchsetzbar sein, um Kosten zu sparen und die Effizienz in Brüssel und auf dem Balkan ein wenig zu steigern.
Die Sprachentrennung macht jedenfalls das ohnehin komplizierte und kaum regierbare bosnische Staatswesen nicht nur noch teurer. Sie erschwert auch das Zusammenwachsen der drei Volksgruppen, die im Grund genommen nur miteinander leben, weil es die USA und die europäischen Mittelmächte am Ende des Bosnien-Krieges 1995 so wollten. Wie mühsam dieses Zusammenwachsen auch noch mehr als zehn Jahre nach Kriegsende ist, zeigt der Schulunterricht. Zwar gehen Bosniaken, Kroaten und Serben in gemischten Gebieten nun wieder in dieselbe Schule, doch das Gemeinsame beschränkt sich oft auf das Gebäude und die Pausen. Denn gelehrt werden natürlich die drei Sprachen, und auch die Lehrpläne sind in politisch besonders sensiblen Fächern ebenso getrennt wie die Schulbücher. Was die Sprachen betrifft, wäre das etwa so, als würde für deutsche Schüler, die in Österreich in die Schule gehen, und für Österreicher, die Schulen in Deutschland besuchen, ein eigener Sprachunterricht bestehen. In Bosnien trägt somit das Bildungswesen zur fortgesetzten Trennung der Volksgruppen bei, anstelle verbindend und integrierend zu wirken. Viele „Internationale“ in Bosnien sind sich dieses äußerst fragwürdigen Zustands natürlich bewusst; daher kursierte unter ihnen auch folgender Witz: „Was ist eine Sprache? Ein Dialekt, der eine Armee hinter sich hat.“
Wie zutreffend dieser Witz ist, zeigt das Beispiel Montenegro, obwohl dort die Streitkräfte erst aufgebaut werden. Neben Serbien war Montenegro der einzige Staat, der vor dem Zerfall des alten Jugoslawien bereits auf dessen Territorium bestanden hatte. Sein bedeutendster Politiker und geistlicher Führer war Petar II., Petrović Njegoš, der von 1830 bis 1851 Montenegro als „Fürstbischof“ regierte. Sein Werk Der Bergkranz, dessen Erstausgabe 1847 in Wien gedruckt wurde, zählt zu den bedeutendsten Werken der serbischen Literatur.
Obwohl im Ersten Weltkrieg auf der Seite der Westmächte, wurde Montenegro nach 1918 an Serbien angeschlossen und verschwand von der Landkarte. Nach 1945 wurde Montenegro eine Teilrepublik des kommunistischen Jugoslawien. Die Bindungen zwischen Montenegro und Serbien waren so stark, dass Montenegro als einzige Teilrepublik auch nach dem blutigen Zerfall des alten Jugoslawien bei Serbien verblieb. Je mehr der Stern von Slobodan Milošević verblasste, desto stärker wurde auch der Widerstand in Montenegro, und 1998 kam es zum Bruch. Milo Đukanović, seit 1991 Ministerpräsident, setzte sich im innerparteilichen Machtkampf gegen die Milošević-Anhänger durch und siegte auch mit hauchdünner Mehrheit bei der Präsidentenwahl 1998. Damit begann die schrittweise politische Abspaltung, von der Einführung der Deutschen Mark als eigener Währung, die später durch den Euro ersetzt wurde, bis zur Übernahme der Kontrolle an den Grenzen; auch die staatlich betriebene Rückbesinnung auf die eigene Geschichte setzte ein. Dazu zählte die Herausgabe eigener Schulbücher, die bis dahin aus Serbien gekommen waren. An den Grenzen kam es zur Aufstellung von Schildern mit der Aufschrift Republik Montenegro, obwohl die Republik als Staat international noch gar nicht anerkannt war.
Trotz all dieser Maßnahmen zur Nationsbildung war Montenegro in der Frage der Loslösung von Serbien tief gespalten, weil sich etwa 30 Prozent der Bevölkerung als Teil der serbischen Nation begreifen. Daher kam es nach dem Ende der Ära Milošević in Serbien zunächst zur Bildung des Staatenbundes Serbien und Montenegro, einer Fehlgeburt, die drei Jahre dahinvegetierte und 2006 aufgelöst wurde. Denn acht Jahre nach dem Bruch zwischen Milošević und Đukanović Ende Mai 2006 stimmten schließlich beim Unabhängigkeitsreferendum 55,5 Prozent der Bevölkerung für die Selbständigkeit. Die 55-Prozent-Hürde, die die Europäische Union für die Anerkennung der Unabhängigkeit vorgegebenen hatte, wurde damit knapp übersprungen. 88 Jahre nach dem Anschluss erstand Montenegro wieder als selbständiger Staat. Dieser brauchte auch eine neue Verfassung, die schließlich im Oktober 2007 vom Parlament in Podgorica verabschiedet wurde. Zu den umstrittensten Artikeln zählt die Festlegung der Staatssprache, die bis zu diesem Zeitpunkt die serbische Sprache war. Schließlich fanden die Unabhängigkeitsbefürworter mit Vertretern der gemäßigten proserbischen Opposition einen Kompromiss, und Artikel 13 (Sprache und Schrift) der Verfassung lautet nun wie folgt:
„Die Amtssprache in Montenegro ist die montenegrinische Sprache. Das kyrillische und lateinische Alphabet sind gleichberechtigt. In amtlichem Gebrauch sind auch die serbische, bosnische, die albanische und die kroatische Sprache.“
Montenegro setzte damit einen weiteren Schritt zur Nationsbildung; je erfolgreicher dieser Staat auf dem Weg Richtung EU und NATO vor allem im Verhältnis zu Serbien sein wird, desto rascher wird das Bekenntnis zur montenegrinischen Nation wachsen. Dabei definiert sich Montenegro nicht als ethnisches Gemeinwesen, sondern als „Staat seiner Bürger“ (Artikel 1 der Verfassung), nicht zuletzt auch deshalb, um das ethnische Gleichgewicht zwischen den Volksgruppen nicht zu gefährden. Denn etwa fünf Prozent der Bevölkerung sind Albaner und sieben Prozent sind Bosniaken.
Die Einführung der montenegrinischen Staatssprache, die sich im täglichen Gebrauch de facto vom Serbischen noch weniger unterscheidet als das Kroatische, mag auf den ersten Blick skurril anmuten; doch gerade aus österreichischer Sicht ist Hochmut fehl am Platz. Denn nur wenige Monate, nachdem das Tausendjährige Reich des Oberösterreichers Adolf Hitler untergegangen war, ersetzte das österreichische Staatsamt für Unterricht im September 1945 das Lehrfach Deutsch durch den Begriff „Unterrichtssprache“. Diese Sprache wurde im Volksmund später „Hurdestanisch“ genannt, und zwar nach Unterrichtsminister Felix Hurdes, (1901–1974). Erst im Jahr 1955 kehrte das österreichische Unterrichtswesen dann endgültig zum Lehrfach Deutsch zurück. Über diese Sprachenpolitik hat Johann Georg Reißmüller in der FAZ vor einigen Jahren einen ausgezeichneten Artikel verfasst.2) Auch dieser Beitrag zeigt, dass Nationsbildungsprozesse durchaus ähnliche Muster aufweisen; das gilt auch für Montenegro und Österreich, die sich beide aus der „Konkursmasse“ eines größeren Staates verabschiedet haben. Im Fall Österreichs begünstigten die Großmächte jedoch diese Nationsbildung, während sie in Montenegro von ihnen erschwert wurde, war doch die EU kein Freund der Loslösung von Serbien, die schließlich nolens volens akzeptiert wurde.
Doch es geht in diesem Kapitel nicht um eine vergleichende Studie der Nationsbildung zwischen Österreich und Montenegro. Vielmehr soll der Blick dafür geschärft werden, dass Sprachenfragen und Sprachenpolitik zutiefst mit den Fragen der nationalen Identität (točno – tačno) verbunden sind. Der Kampf um die nationale Identität manifestiert sich daher insbesondere an den Schulen, weil Nationalitätenkonflikte eben auch Sprachenkonflikte sind. Je näher die Sprachen beieinander liegen, und je ungefestigter diese Nationen sind, desto erbitterter werden die Konflikte offenbar ausgetragen. Das gilt natürlich auch für das ehemalige Jugoslawien, dessen meiste Nachfolgestaaten – allen politischen Mythenbildungen zum Trotz – eben sehr junge eigenständige Nationen sind. Im Fall Bosnien und Herzegowina kann noch nicht einmal von einem gemeinsamen Staatsbewusstsein gesprochen werden, weil Serben, Kroaten und Bosniaken im Grund genommen auch mehr als zehn Jahre nach dem Krieg nicht freiwillig in einem Staat zusammenleben. Daher wird es noch einige Zeit brauchen, bis jener Witz umfassende Realität wird, der im Hotel Holiday Inn in Sarajevo spielt:
Unmittelbar nach dem Krieg kommt ein Gast in das Restaurant des Hotels und will beim Kellner eine Tasse Kaffee bestellen: „Hoću Kafu“ (Ich will Kaffee), sagt der Gast zunächst auf Serbisch. Der Kellner antwortet: „Ne može“ (Geht nicht). Denkt sich der Gast, der Kellner ist vielleicht gegen die Serben, daher wiederholt er die Frage auf Kroatisch: „Hoću Kavu“. Wiederum verneint der Kellner. Schließlich versucht es der Gast noch auf Bosnisch: „Hoću Kahvu“. Darauf reißt dem Kellner die Geduld, und er sagt: „Mein Herr! Mir ist es gleichgültig, ob sie Kafa, Kava, oder Kahva sagen. Wir haben kein Wasser!“