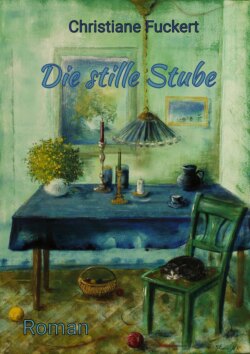Читать книгу Die stille Stube - Christiane Fuckert - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеLydia weiß, was dieser Streifen am westlichen Horizont zu bedeuten hat.
Von ihrer Position aus ist sie denen da unten einen Schritt voraus. Ein paar Minuten im Vorteil, weil sie über die Hügelkette auf der anderen Seite hinausschauen kann.
Wenn die im Tal es sehen, ist es auch schon da, das Unwetter. Kaum mehr Zeit nach Hause zu laufen, um die Dachluken zu schließen und die Kellereingänge zuzustopfen. Und dieser bedrohlich dichte Graustreifen wird viel Wasser mit sich bringen, das ist gewiss.
Anders der Wind. Der wird das Tal nur streifen, sich hier oben hingegen mit voller Wucht austoben.
Bis heute kann sie sich nicht entscheiden, was sie mehr fürchten soll: die Wassermassen oder den Sturm. Beides ist jedoch nahezu unbedeutend im Vergleich zum Feuer – das fürchtet sie wie den Weltuntergang.
„Na komm, Wotan, packen wir’s an! Der Blitz wird sich nicht gerade uns aussuchen, es gibt genügend hohe Bäume hier droben.“
Der Appenzeller, der zu Lydias Füßen vor der Bank ruht, hebt den Kopf von den gestreckten Vorderpfoten. Seinem wachen Blick ist zu entnehmen, dass er Geschäftigkeit wittert. Die starken Hinterläufe richten sich auf und der warme große Schädel reibt sich an Lydias Hosenbeinen.
„Bist ein Guter“, raunt sie dem Tier zu; ein paar wohltuende Worte in Anbetracht dessen, was die folgende Stunde mit sich bringen kann.
„Aber wetterfühlig warst du noch nie, mein Junge. Weißt du eigentlich, dass dein Name ‚Donnergott’ bedeutet?“ Sie schmunzelt und streicht dem Hund über den breiten schwarzen Rücken. Dabei betrachtet sie den Horizont und blickt anschließend besorgt zur Weide hinüber. Den besseren Instinkt für einen Wetterumschwung traut sie den Kühen zu. Schon eine ganze Weile stehen sie reglos da und starren vor sich hin. Weder das saftige Gras noch der wiederverwertbare Mageninhalt wollen sie interessieren. Die aggressiven dicken Fliegen dürfen sich ungestört um die Hinterteile tummeln, die Kuhschwänze machen keine Anstalten, sie zu verscheuchen.
Es wäre gut, die beiden Kühe im trockenen Stall zu wissen, wenn das Unwetter ausbricht. Doch dafür bleibt keine Zeit, sie müsste die Tiere über die Wiese zum Weideausgang treiben und von dort an Haus und Scheune vorbei in die Stallungen führen.
Lydia schlingt das Flanellhemd ihres Mannes fest um den mageren Körper und steigt zwischen der Zaunbespannung hindurch. Dann dehnt sie die Drähte auseinander, sodass der Hund mit gezieltem Sprung folgen kann – eines der Rituale, die sie beide im Schlaf ausführen könnten.
Während Lydia auf die zwei braunweiß gefleckten Kühe zuläuft, hämmert ihr Herz so fest, als fülle es den gesamten Brustkorb aus. Hektik und Aufregung bekommen ihr nicht mehr. Alles fühlt sich anders an als noch im vergangenen Sommer.
Mit Klapsen und wedelnden Armen versucht sie, das halsstarrige Vieh zur Überdachung am Weiderand zu treiben.
„Worauf wartet ihr noch? Ihr wisst doch Bescheid!“
Als Antwort erhält sie nur stumpfe Blicke. Selbst der Hund kann Lydias durchgreifende Gebärden nicht einordnen und fühlt sich animiert zum Spielen. Bellend umkreist er die Kühe, kneift zwischendurch in Lydias Gummistiefel und legt erwartungsvoll ein Stöckchen vor ihren Füßen ab.
In Wotans sonores Gebell mischt sich das erste ferne Donnergrollen. Der graue Streifen liegt mittlerweile wie eine schmutzige Filzmatte über der Hügelkette.
Jetzt müssen die da unten auch begriffen haben, was sie erwartet. Sobald die ersten Keller vollgelaufen sind, wird das Martinshorn der Feuerwehr ertönen, einer hilft dem anderen – oder auch nicht. Jedenfalls sind andere in solchen Situationen zu zweit, zu dritt, zu viert ...
Die Gedanken an die vielen Vorkehrungen, die noch zu treffen sind, drohen Lydia aus dem Gleichgewicht zu bringen: zuerst die Kühe, dann die Wäsche, oder besser erst Vogel und Hühner ins Trockne und danach die Wäsche von der Leine nehmen, nicht zu vergessen die offenen Fensterläden ...
Dass sie resigniert an der Rückwand der Weideüberdachung kauert, wird ihr erst bewusst, als der Hund seine Schnauze in ihren Schoß drückt und die warmen Leiber der Kühe sie wie ein Schutzwall umgeben. Die beiden sind ihr gefolgt, ohne dass Lydia es wahrgenommen hat.
„Na also, jetzt sind wir auch zu viert“, lächelt sie matt. Hier möchte sie sitzen bleiben, einfach sitzen und warten, bis das Unwetter sich verzogen hat. Wie gern würde sie sich ausruhen und das vertraute Aroma der mächtigen Tiere atmen. Wenn das Gewitter beginnt, werden die Kühe sich hinlegen oder ihr Hinterteil dem Wind zuwenden, um ihre Euter zu schützen; eine Reaktion aus Zeiten, in denen noch eine Milchbildung stattfand.
Ihre Hand gleitet durch das weiche Fell des Hundes, der neben ihr im Heu liegt, bereit für die gepflogenen Kraulminuten.
„Es geht nicht, Alter, nicht jetzt. Auf uns wartet noch jede Menge Arbeit. - Dann mal los!“ Der motivierende Tonfall gilt ihr selbst. Mit beiden Händen auf den Knien schiebt sie sich an der Bretterwand hoch. Ihr Rücken wird ihr nicht mehr lange dienen. Schon morgens aus dem Bett in die Senkrechte zu gelangen, wird von Tag zu Tag beschwerlicher. Stöhnend wendet sie sich den Kühen zu.
„Und ihr bleibt, wo ihr seid!“ Als Zeichen ihrer Konsequenz drückt sie ihre Handteller fest gegen deren breite Stirnseiten, so, als wolle sie die Tiere rückwärts gegen die Wand schieben. Die üblichen Gesten der Zuneigung sind jetzt fehl am Platz.
Der Hund hat den Kopf leicht gesenkt und betrachtet schielend das ungewöhnliche Schauspiel, wartet auf das, was jetzt geschieht. Lydias Geste scheint zu wirken: Es geschieht gar nichts, die Kühe bleiben stocksteif stehen, selbst als Lydia und Wotan sich fortbewegen.
Vor dem hohen Außenkäfig zwingt Lydia sich zur Ruhe. Wenn sie jetzt nur die kleinste Nervosität übermittelt, wird der Vogel sich nicht einfangen lassen. Mit zitternder Kehle versucht sie sich an dem vertrauten Singsang und lockt so den Nymphensittich auf die Sitzstange in Augenhöhe. Dann betritt sie langsam den Käfig.
„Vögel sollen sich auch wie Vögel fühlen!“, hatte ihr Mann entschieden und diese Voliere gebaut. Drei mal drei mal drei Meter, gleich neben dem Hauseingang. Entgegen Lydias Wunsch hatte er obenauf nur einen kleinmaschigen Draht befestigt – ein Vogel muss den Himmel sehen können –, und auf den winzigen Schlupfkasten will Lydia sich bei einem Unwetter nicht verlassen.
„Du wirst nass, Mozart, komm zu mir“, sagt sie mit gezwungen ruhiger Stimme. Der Vogel legt den Kopf schräg und beäugt aufmerksam die Menschenhand, die sich ihm verdächtig langsam nähert. Kein Futter. Sie hätte ein Salatblatt für ihn mitbringen sollen, vor allem aber den Käfig aus dem Haus.
„Was ist nun, magst du mit mir kommen?“
Natürlich mag er nicht. Längst weiß der Vogel den Unterschied seiner Behausungen zu bewerten. Der winzige kuppelförmige Käfig im Hausinnern verheißt nichts als Langeweile und Gefangenschaft. Und diese ausgestreckte Hand ist jedes Mal der Vorbote dorthin.
Lydia pfeift ein paar der Töne, die ihren Mann dazu animierten, diesen Vogel Mozart zu nennen. Fasziniert interpretierte er damals die ersten zufälligen Vogellaute als einen Auszug aus der ‚Zauberflöte’.
„Gar nicht so untalentiert, unser Federvieh“, hatte er mit stolzem Besitzerton festgestellt, „wer weiß, was der noch alles draufhat.“
Doch danach folgten nur noch Eigenkompositionen, kein einziges Mal mehr die ‚Zauberflöte’, so oft Mozart auch in der Stube neben dem Plattenteller saß. Bis er nach einer Weile kaum mehr einen Ton von sich gab.
„Er braucht Gesellschaft“, hatte Lydia kritisiert. „Du redest auch nicht, wenn du alleine im Zimmer bist.“
„Im Gegensatz zu dir“, hatte ihr Mann erwidert, doch umgehend bekam Mozart sein Nymphenweibchen ‚Constanze’, grau und schmucklos, aber heiß geliebt. Das Pärchen sang seine Duette und Soli, völlig unbekannte Werke, doch das Glück der beiden war perfekt. Und als der nächste Sommer bevorstand, bekamen sie die Voliere im Halbschatten, unter freiem Himmel.
Ob Mozart ihren Mann vermisst? Darüber hat Lydia noch nie nachgedacht. Sein Weibchen Constanze, ja, das vermisst der Vogel schmerzlich. Er wirkt einsam seit jenem schwarzen Tag im letzten Frühling: Mozart hockte auf der Stange, der kleine Kopf mit dem gebogenen Federsträußchen zuckte von rechts nach links, die Perlaugen schossen ratlos hin und her, gleich unter ihm lag seine geliebte graue Federkugel auf dem Boden, die dürren Füßchen gen Himmel gestreckt.
Nicht jetzt an so was denken ...
Plötzlich durchfließen wellenartige Zuckungen den Vogelleib und der zarte Bauchflaum zittert. Für ein paar Sekunden ist es totenstill auf dem Berg. Kein Blatt scheint sich zu bewegen, kein Vogel singt mehr.
Dann fährt der erste Windstoß durch Lydias Haar, brüllend laut und so heftig, dass sie ins Wanken gerät. Doch sie reagiert blitzschnell, greift zu und umfängt mit beiden Händen den erstarrten Mozart. Noch während sie über die Haustürschwelle eilt, schlägt hinter ihr die Tür der Voliere mehrmals auf und zu. Hektisch setzt sie den Vogel im Hauskäfig ab und verriegelt die kleine Gitterpforte.
Was nun? Die Wäsche?
Wie für ihr Erscheinen programmiert, zuckt ein Blitz hernieder, als Lydia das Haus verlassen will. Einundzwanzig ... zweiundzwanzig ... dreiundzwanzig … Den folgenden Donnerschlag spürt sie in den Fußsohlen. Das war genau überm Ort. Noch einen Kilometer, dann hat es mich!, denkt Lydia mit erneutem Herzklopfen.
„Wotan! Wo bist du? – Gib Laut!“
Sie weiß, wie der Hund reagieren kann, wenn er erschrickt: Er rennt los, sucht das Weite, weil der Ort des Erschreckens die Gefahr für ihn birgt.
Nicht auch noch ihn verlieren! Ihn braucht sie am meisten, seit sie alleine hier leben muss. „Wotan!“
Der klägliche Laut kommt von drinnen. Donnergott Wotan hat sich ins Haus verflüchtigt, folgert Lydia erleichtert. Zum Glück hat er so reagiert, wie es gut für ihn ist.
Jetzt setzt ein immer stärker werdendes Rascheln ein. Der Regen kriecht den Berg hinauf. - Die Hühner!
Sie eilt um den Wohntrakt herum zum Gehege, weiß schon jetzt, was sie erwartet: Alle Hühner mitsamt Hahn werden sich in den Stall verzogen haben, bis auf das eine orientierungslose. Es wird in seiner Panik immerzu gegen die Wand fliegen, bis es sich den Kopf eingerannt hat ...
Als Lydia um die Ecke biegt, das nächste Donnerkrachen im Rücken, bestätigt sich ihre Vermutung.
„Dummes Tier, mach es doch den andern nach!“ Während sie am Riegel zerrt, um in das Gehege zu gelangen, bläht sich ihr Flanellhemd und verfängt sich an einem Nagel neben dem Gatter. Die ersten dicken Tropfen klatschen seitlich gegen ihr Gesicht. Sie reißt an ihrem Hemd, ruckelt gleichzeitig am Tor, dabei ist der Sturm ihr steter Gegenspieler. Im Gehege streift das ängstlich flatternde Federvieh ihre Hüfte. Lydia greift blindlings zu und packt die stricknadeldürren Beine des Tieres. Mit einer Hand stützt sie sich an der Wand neben der Stallluke ab und schleudert das Huhn ins Innere zu den anderen.
Die hölzerne Verschlussklappe wird vom Wind so fest gegen die äußere Stallwand gepresst, dass sie mehrmals Lydias Hand entgleitet und zurückschlägt.
Im nächsten Moment hat die Regenfront sie erreicht. Das Hemd saugt sich an ihrem Rücken fest. Den folgenden Blitz nimmt sie nur aus den Augenwinkeln wahr, grell, zackig und scharf, zugleich den Donnerschlag, der sie für ein paar Sekunden lähmt.
„Es hat mich gewiss erwischt ... Verdammt, Gustav! Wie konntest du nur?! Du wusstest, was du riskierst, jetzt häng ich hier alleine!“
Der Wind verzerrt ihr Wutgeschrei. Sämtliche Kraft weicht aus ihrem Körper. Mit resignierten Bewegungen drückt sie die Klappe des Hühnerstalls zu, klemmt den Hebel in das Verschlusseisen und sackt auf dem lehmigen Boden in sich zusammen. Zitternd umschlingen ihre Arme den eigenen Körper, ihre Knie versinken im feuchten Hühnermist.
Ob es Wassertropfen oder Tränen sind, die über ihre Wangen laufen, weiß sie nicht. Ihre Zähne schlagen gegeneinander, sie verliert die Kontrolle über ihre Kiefermuskeln. Vornüber gebeugt verharrt sie so, bis die Wut ihr neue Kraft verleiht.
„Glaub ja nicht, dass ich mich aufgebe“, flüstert sie in ihre Armbeuge hinein, „dass ich die Tiere im Stich lasse, wie du mich!“ Mit steifen Fingern zieht sie sich am Gitter auf die Füße. Die Regenwand ist so dicht, dass sie von hier aus das Wohnhaus kaum mehr erkennen kann. Langsam setzt sie einen Fuß vor den anderen, schleppt sich gebeugt bis zum Haus hinüber.
„Wenigstens trag ich Gummistiefel“, sagt sie mit halbwegs fester Stimme und einem aufgesetzt zynischen Grinsen.
Fest gegen die zugefallene Haustür gedrückt wartet der steifbeinige, zahnlose Kater. Das struppige Fell, in dessen Grau man die Rotspuren vergangener Zeiten nur noch erahnen kann, ist so durchweicht, dass es tropft. Auch ihn hat es eiskalt erwischt, denkt Lydia, der es bei diesem Anblick gelingt, ihre Mimik zu entspannen, bis nur noch Mitleid für das Tier und für sich selbst übrig bleibt.
„Alles alt und marode bei uns, was? – Du, ich, der Hof ...“
Im nächsten Augenblick stürzt das Wasser vom Dach, überspringt die Regenrinne und klatscht auf Lydias Nacken. Resigniert hebt sie den Blick zum Himmel. „Das war deine Antwort auf meinen Vorwurf, Gustav, nicht wahr? Wieder mal ein Volltreffer.“
Trotz des Regenwassers in ihrem Mund schmeckt Lydia die Bitterkeit auf ihrer Zunge. Doch sie weiß schon jetzt, dass ihre Wut schwindet, sobald sie dem vertrauten ausgebeulten Hut im Garderobennetz begegnet.