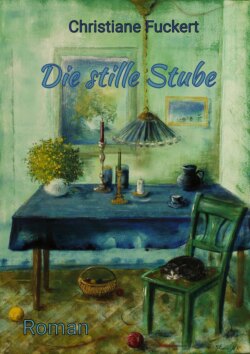Читать книгу Die stille Stube - Christiane Fuckert - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеLydia sitzt unter dem Dachüberstand, der ihr vor noch einer Stunde die unfreiwillige Dusche beschert hat. Mittlerweile ist die rustikale Bank neben der Haustür angetrocknet und eine alte Decke liegt auf der Sitzfläche.
An der rechten Hausseite ächzen die Giebelbalken. Überall tropft es. Wie ein flüsterndes Glockenspiel, denkt Lydia. Selbst die feuchten Perlen, die ihr rhythmisch auf die Schultern und ins Haar springen, empfindet sie als wohltuend – sie sind letzte Beweise dafür, dass sie das Unwetter gut überstanden hat.
Die Läden am Haus sind wieder geöffnet, ebenso die Fenster von Küche und Schlafzimmer. Diese gereinigte Luft ist eine wertvolle Entschädigung für Angst und Mühsal.
Auf allem, was Lydia umgibt, sitzen Wassertröpfchen, in denen sich die Sonne spiegelt. Was sie eben noch als einen Racheakt Gustavs auslegte, zeugt jetzt für die Schönheit der Schöpfung.
Ihr Blick schweift über die nahe Umgebung. Die Hühner staksen leise gurrend im aufgeweichten Gehege umher. In der Voliere hüpft Mozart munter von einem Ast zum nächsten. Sogar der alte Kater nutzt die auflebende Wärme für ein wohliges Räkelmanöver, gleich neben Lydias Bank.
„Marschall, wie alt bist du jetzt eigentlich?“ Lydia denkt an den Tag, an dem ihr Schwiegervater das fuchsrote Knäuel mitten auf dem Küchentisch absetzte:
„Darf ich vorstellen: unser neuer Marschall im Kuhstall. Er wird jeden Eindringling vertreiben, seht euch nur seine Krallen an.“
Somit hatte der Kater seinen Namen. Marschall nahm seine Aufgabe sehr ernst, knurrte nach seinem ersten Lebensjahr selbst die Gänse an, die sich frei auf dem Hofgelände bewegen konnten.
Etwa zwanzig Jahre musste das her sein.
Damals, Anfang der sechziger Jahre, gab es viele Gänse am Brausehof, dazu Kühe, Schweine, Ziegen, Schafe und einen Ackergaul. Der Hof war ordentlich bevölkert, nicht nur von Tieren.
Die Milchkühe verbrachten die Sommermonate auf der Südseite des Berges.
„Die scheucht man nicht hin und her“, meinte Lydias Schwiegervater Magnus, wenn jemand ihn belehren wollte, dass die Melkerei auf der Weide unnötigen Arbeitsaufwand bedeutete. „Wir leben nicht von der Milchwirtschaft, aber Kühe leben von frischem Gras.“
So sammelten sich die Tiere mit ihren prallen Eutern von selbst am Melkstand auf der Weide und lieferten immerhin so viel Milch, dass täglich mehrere große Kannen von einem Geschäftsmann aus dem Tal abgeholt werden konnten; ein angenehmes Zubrot, das jährlich zum Erntedankfest unter allen Arbeitskräften des Hofes aufgeteilt wurde.
Ein warmes Gefühl macht sich in Lydia breit, als sie nun zurückdenkt an diese wenn auch armen, so doch kontaktreichen Zeiten. Wobei Arbeitskräfte nicht die korrekte Bezeichnung war für die Helfer und Mitbewohner am Brausehof. Es war dem guten Herzen der ehemaligen Bäuerin zuzuschreiben, dass die kleine Gruppe von Menschen vier Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges eine neue dauerhafte Bleibe fand. Mit nichts weiter als dem karg geschnürten Bündel auf dem Rücken hatten diese Fremden sich auf der Flucht vor dem sicheren Hungertod zusammengetan und tauchten Anfang der Zwanzigerjahre erschöpft und unterernährt hier oben auf, im Alter von vierzehn bis dreißig Jahren. Und sie, Lydia war eine von ihnen gewesen – die jüngste von allen, ein Waisenkind ohne großartige Erinnerung an die eigenen Eltern, ein zartes weißblondes Mädchen, das so eingeschüchtert war wie ein gejagter Hase im umstellten Kornfeld. Es dauerte lange Wochen, bis gehaltvolle Nahrung und ungestörter Schlaf all diesen ausgemergelten Zuwanderern Gesundheit wie auch die Schaffenskraft ihrer Hände zurückgeben konnten.
Die Inflation mit all ihren Wirren ließ weder hier am Brausehof noch sonstwo in der Umgebung Entlohnungen zu, doch darum ging es keiner der Neuankömmlinge. Hier fand man Sicherheit, Geborgenheit, Nahrung und eine Schlafstätte, zudem ein wohltuendes Miteinander und Zusammenhalt.
Man baute an, erntete, betrieb Viehzucht und ernährte sich von den eigenen Erträgen. Man war eine einzige große Familie.
Im Jahr 1928 fand eine Hochzeit statt. Gustav, der Sohn des Bauern, hatte sie, Lydia, um ihre Hand gebeten. Wo schon so lange so viel verborgene Verliebtheit von beiden Seiten bestand, durfte jetzt die Zusammengehörigkeit öffentlich besiegelt werden. Lydia blühte auf, genoss die Liebe und den Respekt ihres Ehemannes und ebenso das Bewusstsein, zum Gedeihen des Brausehofes mit beitragen zu können.
Auf der Südseite des Berges gab es Kartoffelfelder und gehaltvolles Grünfutter, das getrocknet und für den Winter im Schober gelagert wurde. Zahlreiche Wiesen, Apfel- und Birnbäume wie auch ein langgezogenes Erdbeerfeld gehörten zum gepachteten Bereich des Hofes, der sich vom Hügel bis weit ins Gelände des südlichen Tales erstreckte. Dank verschiedener Wasserquellen konnten viele ertragreiche Jahre verbucht werden; die Sommer arbeitsreich und Hand in Hand wohltuend erschöpfend, deftige füllende Mahlzeiten an den langen Winterabenden, Gesellschaftsspiele, Handarbeiten und Planungen für das kommende Frühjahr.
Bis nach all der Zeit des gemeinsamen Schaffens und Einvernehmens ein einziger Satz die Idylle trübte.
„Ein fruchtbarer Berg!“, hatte Lydias Schwiegervater mit seinem ganz eigenen ländlichen Dialekt am langen Esstisch stolz geäußert, als vor fünfzehn Jahren, im Herbst 1965 die Vorratskammern und der Heuschober bis an den Rand gefüllt waren. „Und was für ein gutes Gefühl, dass dieser Berg uns die Zukunft sichert. Hätte diese Fruchtbarkeit nicht ansteckend sein können, um auch das Fortbestehen des Hofes zu sichern?“ Dabei flog sein Blick wie beiläufig zum entgegengesetzten Tischende und streifte seinen Sohn und dessen Ehefrau Lydia. Daraufhin hatte Lydias Mann Gustav seinen Teller beiseite geschoben, war aufgestanden und hatte nie wieder ein Wort mit seinem Vater gewechselt.
Zwei Jahre später beerdigten sie den alten Bauern, ohne jeden Versuch der Aussöhnung.
Lydia seufzt und betrachtet ihre knotigen, abgearbeiteten Hände, die plötzlich schmerzhaft verkrampft auf ihrem Leib liegen. Das Fortbestehen des Hofes, ja, das liegt in der Tat jetzt ganz allein in diesen Händen …
Als hätte der Appenzeller ihre Gedanken erfasst, hebt er den Kopf und schleckt ihre Handrücken ab. Dann prüfen seine wachen Augen ihre Miene und werden erst zu zufriedenen Schlitzen, als sein Frauchen sich bemüht zu lächeln.
„Wir Menschen mit unseren zermürbenden Gedanken, was? Damit habt ihr Tiere nichts zu tun. Habt ja recht, ist im Grunde nur Zeitverschwendung, lässt sich im Nachhinein sowieso nichts mehr ändern. Na los, Wotan, sehen wir nach den Kühen!“
Die beiden Kühe haben sich wie vermutet unter der Überdachung gedreht, die Hinterteile zur Wetterseite hin. Immer noch stehen sie stocksteif da.
„Gibt es hier oben irgendeinen, der keine Angst vor Gewittern hat?“, ruft Lydia ihnen zu. Als hätten die beiden sie verstanden, drehen sie sich auf der Stelle und sehen ihr entgegen.
„Ab mit euch, in die Sonne!“
Bald wird das Gras hier hüfthoch sein. Das schaffen diese beiden Tiere nicht alleine. Fürs Mähen würde sie sich jemanden herbestellen müssen, aber das wiederum lässt ihr Portemonnaie nicht zu.
Sie geht hinter den Tieren her, weiß nicht, ob sie sich jemals einsamer gefühlt hat. Nur zwei Kühe sind ihr geblieben. Falls Lydias Kräfte im selben Maße weiter nachlassen, wird sie auch diese beiden bald abholen lassen müssen. Wenn sie an den Abtransport vor einem halben Jahr denkt, an die Rampen, den letzten Blick der Tiere mit den ihr zugewandten Köpfen, fragend und ohne die Chance auf eine Antwort, alsdann Resignation und schwere Schritte hinauf ins Wageninnere, ins Nichtverstehen oder Befürchten – was auch immer in den Hirnen solcher duldsamen, mächtigen Tiere vor sich gehen mag ...
Für den Moment will der Weg bis zur Weidenmitte Lydia an den letzten Weg mit ihrem Mann erinnern. Einen Fuß vor den anderen, mechanisch und unzähligen Blicken ausgesetzt, war sie drunten im Tal alleine in vorderster Reihe dem Buchensarg gefolgt. Selbst ihre Gedanken auf jener kurzen Wegstrecke sind wieder greifbar.
„Warum, Gustav“, hatte sie nur immerfort still gefragt. „Du warst so gesund, hättest vielleicht noch viele schöne Jahre haben können. Aber du musstest ja alles auf eine Karte setzen, und das war die falsche, Gustav, du hast bewusst zu hoch gepokert, hast die mit dem Sensenmann gezogen, obwohl der sich dir warnend gezeigt hat ... Und all die Leute hier, wie die mich anstarren! Für die bin ich dessen Gehilfin. Durch deinen Dickschädel, Gustav! Denn der Pfarrer hat nicht recht, wenn er behauptet, dass es dem allmächtigen Gott gefallen hat, unseren Bruder Gustav Brause zu sich zu holen ... Gefallen hat ihm das nicht, nein, du hast dich förmlich angeboten, geholt zu werden ...“
Dann hatte Lydia sich beschworen, diese wenigen Minuten noch durchzuhalten, den stummen Anklägern, die so unverhohlen ihren schrecklichen Verdacht gegen sie hinter vorgehaltener Hand äußerten, die kalte Schulter zu zeigen und war, noch bevor die schwarze Versammlung sich aufgelöst hatte, mit kleinen, hektischen Schritten auf ihren Berg geflohen.
Am Rande der Weide steht die Wäschespinne. Wie schlaffe Körperteile hängen dort ihre regenschweren Kleidungsstücke. Ein Fremder würde glauben, hier oben wohne ein Mannsbild, denkt Lydia beim Anblick der großen Hemden, in die sie sich täglich einhüllt wie in einen Schutzmantel. Trotz der Sommerwärme friert ihr ausgemergelter, dünner Körper immerzu.
Ihr Blick schweift hinüber zur Vogelscheuche im Kräutergärtchen – der Sturm hat sie schief gefegt.
„Mit deinem alten Strohhut auf dem dicken Sackkopf sieht sie dir ähnlich, Gustav, die langen Arme ausgebreitet wie du, wenn du hinter den Gänsen her warst ...“
Sie spürt, wie gut es tut, die eigene Stimme zu hören. Sie kann ungetrübt weitersprechen, dies ist der letzte Ort, an den sich die Dorfbewohner freiwillig begeben würden.
Die zwei Milchkühe sind stehengeblieben und schauen misstrauisch auf das Tal, aus dessen Richtung sich eben noch die Gefahr des Unwetters genähert hat. Lydia legt ihre Strickjacke ins feuchte Gras und lässt sich darauf nieder. Mit den Armen umschlingt sie ihre Beine und erinnert sich an eine Szene, fast genau an dieser Stelle.
„Ach Gustav, du und dein Viehzeug! Weißt du noch, die Fanni, deren lange Euter du mit einem Gurtnetz hochgebunden hattest, damit sie sich nicht darauf trat, wenn sie sich setzte? Und den kranken Kühen hast du einen Aderlass gemacht. Die Kälbchen durften an deinen Fingern nuckeln ... Als wir frisch verheiratet waren, hast du mich hinter dir her in den Stall gezogen, zu einer Geburt. Irgendwie schämte ich mich, vielleicht, weil du als Mann mehr über einen Geburtsvorgang wusstest als ich. Vielleicht schämte ich mich auch, weil uns beiden bewusst war, dass unser Kind einmal auf vergleichbare Weise auf die Welt kommen würde. Doch so weit durfte es ja nicht kommen ...“ Lydias Stimme ist leiser geworden, ein altvertrauter Druck krampft ihr die Kehle zusammen, und sie versucht wie so oft, diesen Schmerz hinunterzuschlucken.
In der Wiese um sie herum zuckt es, als wären Hunderte von Grashüpfern unterwegs. Doch schnell erkennt sie, dass es die einzelnen Halme und Wildblumen sind, die sich nach dem heftigen Regen mit Hilfe der Sonne wieder versuchen aufzurichten. Jedes einzelne Gewächs vollführt seine eigene kleine Auferstehung. Zu Lydias Geburtstag, Mitte Mai vor ein paar Jahren, hatte Gustav ihr ein Sträußchen aus Gänseblümchen gebunden, und da er eine heimliche Liebe zur Poesie hegte, lag ein sorgfältig ausgewähltes Zitat von Erich Kästner dem Gebinde bei:
‚Wer wagt es, sich den donnernden Zügen entgegenzustellen? – Die kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen!’
Darunter hatte er mit seiner krakeligen, wuchtigen Handschrift geschrieben: ‚Ich wünsche meiner Liebsten, dass auch sie, egal was geschieht, immer die Kraft haben wird, wieder aufzustehen.’
In diesem Jahr hat sie erstmals ihren Geburtstag alleine verbracht, hat ihn ignoriert, um jedoch am Abend aus genau diesem Wunsch ihres Mannes für ihre Zukunft neue Kraft zu schöpfen. Sie hat sich vorgenommen, seinen Wunsch als Rat zu verinnerlichen. Immer wieder aufstehen – sie will es versuchen, um ihrer selbst Willen, vor allem aber ihren Tieren zuliebe.
Während Lydia besonnen lächelt und sich auf die Beine bemüht, lässt eine Autohupe sie zusammenschrecken. Ruckartig dreht sie den Kopf, ihr Nacken knackst und sie weiß jetzt schon, dass sie am Abend Kopfschmerzen haben wird.
Doch vorrangig ist die Frage, welcher Mensch jetzt etwas von ihr will. Vielleicht ein Ausflügler, der sich verfahren hat?
Diese Touristen: „...Kann ich ein Glas Wasser haben?... Wie komme ich über den Berg auf die andere Seite?... Darf ich kurz Ihre Toilette benutzen?...“
„Meine Toilette ist verstopft, der Wald ist sicher groß genug!“ - Niemand gelangt in ihr Haus, nicht mehr, seit sie alleine hier lebt! Womöglich will man es ausspionieren, um sie später zu bestehlen ...
„Frau Brause, ich bin’s!“ Der Förster, der am Fuß des Berges wohnt und wahrscheinlich die Waldschäden begutachtet. Jetzt erkennt sie ihn, sein Gesicht zeichnet sich über dem grünen Pullover vom Grün der Hecke ab.
Ob er sich ernsthaft um sie sorgt? Oder kommt er nur seiner Pflicht als nächster Nachbar nach? Wie mag er überhaupt über sie denken? So, wie die im Tal?
Diesen Mann sieht sie nur dann, wenn sie ihm zufällig auf ihren Spaziergängen begegnet. Bei ihr auf dem Hof hat er sich seit Gustavs Tod nicht mehr blicken lassen.
Zu Gustavs Zeiten gab es eine Skatrunde, mit viel Selbstgebranntem: Gustav, der Förster und der ehemalige Arzt aus dem Ort, der seit seiner Praxisschließung über vierzig Kilometer weit entfernt lebt und dennoch regelmäßig zum Skatspielen hierher kam. Theo, der Arzt war es auch, der sich gleich nach der Beerdigung mehrmals telefonisch bei Lydia erkundigte, wie es ihr gehe und ob sie sich über Besuch freue.
„Danke, es geht, und nein, ich freue mich nicht über Besucher, und das wisst ihr alle ganz genau!“, hatte sie ihn knapp wissen lassen, damals, als der Telefonanschluss noch funktionierte.
Zwei Mal hatte sie aus Unwissenheit die Kosten an die Telefongesellschaft nicht überwiesen. Gustav hatte ihr seine persönliche Bürokratie vorenthalten. Mit seinen Worten hatte er sie ‚entlastet’, so wusste sie weder Bescheid über den finanziellen Stand der Dinge noch über Bankangelegenheiten im Allgemeinen. Immer wieder hatte sie das Thema angeschnitten: „Was mach ich, wenn mit dir mal was ist, wenn ich selbst etwas erledigen muss?“
„Dann gehst du zu Herrn Schulthe von der Sparkasse, der erklärt dir alles, was du wissen musst.“
Was die Frauen vom Brausehof wissen mussten, war seit jeher auf das Häusliche und Bäuerliche begrenzt. Der hilfsbereite Herr Schulthe hatte Lydia ein Vierteljahr nach Gustavs Tod aufgeklärt.
„Sie vermuten richtig, eigentlich müssten Sie einen Brief erhalten haben. Das Telefon funktioniert nicht, weil die Rechnungen nicht beglichen wurden. Na ja, wenn es sich bei den beiden letzten auch nur noch um die Grundgebühr handelt. Telefoniert haben Sie wohl gar nicht mehr ...? Ihr Mann hat immer alles selbst überwiesen, er mochte keine automatischen Abbuchungen. Die Mitteilung der Telefongesellschaft ... nun ja, vielleicht sehen Sie doch nochmal im Briefkasten nach? - Und hier ist Ihr Sparbuch.“
Angeblich hatte Gustav es in einem Bankschließfach deponiert und aufgetragen, es seiner Frau irgendwann einmal, beim notgedrungen ersten alleinigen Bankbesuch, auszuhändigen. Eintausendfünfhundert Mark, die sie nicht antasten wird, bis sie wirklich in allergrößter Not steckt. Letztendlich aber sagt ihr die Kaufkraft dieses Betrages kaum etwas, weil Geldbeträge ihr schlechthin nichts sagen.
Was sie gerade so überschaut, ist die monatliche Summe der kleinen Rente, die sie mittlerweile jedes Mal zur Hälfte abhebt und in einer Zigarrenkiste, ganz unten im Kleiderschrank, für ihre unerlässlichen Einkäufe aufbewahrt. Den Rest sollen diejenigen abbuchen, die etwas von ihr zu fordern haben. Wer auch immer das sein mag, interessiert sie nicht.
„Frau Brause, wir haben uns lange nicht gesehen“, sagt der Förster, der ihr über die Wiese ein Stück entgegengekommen ist. „Sie machen keine Spaziergänge mehr? Ich hätte mich sowieso demnächst bei Ihnen gemeldet. Aber jetzt war ja das starke Unwetter, und da dachte ich, das ist ein Grund, mal nach der Frau meines alten Skatbruders zu sehen.“
„Ein Grund, ja“, wiederholt Lydia mechanisch, weil ihr die Worte fehlen, mit einem Menschen zu sprechen. Weil sie nach so langer Zeit nicht mehr weiß, wie man das macht.
Mit hängenden Armen steht sie dem Mann gegenüber, von dem sie weiß, dass er eine rothaarige Frau, Greta, und zwei fast erwachsene Söhne hat. Nein, sie weiß es nicht nur, sie hat seine Familie gekannt, in alten, ungetrübten Zeiten, die Lydia vor knapp einem Jahr selbst beendet hat.
Der Förster bietet ihr seine Hand an und Lydia erwidert kraftlos den Begrüßungsdruck. „Gibt es Schäden, Frau Brause?“
„Keine, nein, ich habe keine entdeckt.“
„Das Dach ist dicht geblieben? Hat es nirgendwo hineingeregnet, ins Wohnhaus, in den Stall?“
„Nirgends, nein“, sagt sie, spürt jedoch im selben Augenblick Panik in sich aufsteigen. Was, wenn doch? Sie hat sich noch nicht richtig überzeugt, ob alles trocken ist im Haus. Und in den Stall hat sie nicht mal hineingeschaut. Doch das alles geht den Förster nichts an.
Gustav hatte das Stalldach mit Dach-Hauswurz bepflanzt. Aus Überlieferungen wusste er, dass in diese Pflanze niemals ein Blitz einschlagen würde.
„Sogar auf Ziegeln gedeiht das Zeug!“, hatte er ihr versichert, damals, nach dem Feuer.
„Ja, wenn dann also alles in Ordnung ist bei Ihnen“, startet der Förster seinen Abschied.
„Das ist es“, sagt Lydia, „alles ist gut.“ Er soll wieder wegfahren. Er ist nur da, um sein Gewissen zu erleichtern, glaubt Lydia seinen überschwänglichen Gebärden zu entnehmen. Sie braucht weder geheucheltes Mitgefühl noch liegt ihr etwas am Seelenheil ihrer Mitmenschen.
Der Mann wendet sich seinem Jeep zu, dessen Fahrertür fluchtbereit offen geblieben ist. Er steigt ein, deutet mit erhobener Hand einen Gruß an und wendet sein Fahrzeug. Dann bremst er noch einmal ab, ruft ihr zu: „Ich fahre in den Ort, einkaufen. Wenn Sie etwas brauchen, ich kann es Ihnen mitbringen!“
Nach fast einem Jahr fällt ihm das ein – wie fürsorglich, denkt Lydia bitter, obwohl ihr durchaus bewusst ist, dass sie auch ihn eingeschlossen hatte mit ihrem Aufruf, sich vom Hof fernzuhalten. Dennoch, sie bräuchte Lebensmittel, Brot, Butter, Kaffee, Mehl, auch etwas Obst täte ihr gut, Waschpulver und Toilettenpapier und Zahnpasta ... Wann war sie das letzte Mal mit dem Traktor drunten zum Einkaufen?
„Ich brauche nichts, alles ist da.“
Sie sieht, wie der Förster die Schultern zuckt, dann fährt er davon. An den Motorgeräuschen erkennt Lydia, wo er sich gerade befindet, welche Kurve er den Hang hinab nimmt. Nach über vierzig Jahren Bergerfahrung haben ihre Sinne vieles gespeichert, was andere kaum registrieren.
Mit großen Schritten stapft Lydia am Wohnhaus vorbei zum Stall. Sie öffnet die zweigeteilte Tür, erst den oberen, dann den unteren Verschlag.
Nicht hinauf zur Decke schauen, nimmt sie sich vor; mit Nestern, Kokons, Spinnweben und verdreckten Fledermausschlafplätzen will sie sich im Moment nicht befassen. Nur der Fußboden ist von Bedeutung.
Meter für Meter schreitet sie den leeren Stall ab. Keine Pfützen, nicht die geringste Nässe. Befreit atmet sie durch und lässt die Türverschläge weit offen stehen, damit auch hier die warme, trockene Luft Einzug halten kann.
Vielleicht ist die gute Dachabdichtung auf Gustavs Hauswurz zurückzuführen, der zwar ungepflegt, aber als geschlossene Decke das Dach besiedelt.
Zuversichtlich geht sie weiter zum Scheunentor, öffnet nur die Schlupftür und steigt hindurch.
Es riecht nach frischem Heu wie lange nicht mehr. Das Aroma erinnert sie an heiße Sommertage auf der Südseite des Berges, an hölzerne Heugabeln, Gelächter, kratzende Waden, an Instantkaffee und reich belegte Pausenbrote.
Sie schließt die Augen, lockert ihren Körper und saugt gierig den Erinnerungsduft ein, genießt die Bilder der Vergangenheit, die sich hinter ihren Lidern aneinander reihen.
Ein Schauder durchläuft sie, von den Haarspitzen bis hinunter in die Fußsohlen: Warum riecht es hier nach so langer Zeit nach frischem Heu? Bitte nicht, denkt sie inbrünstig.
Doch ihr Verdacht bestätigt sich, als sie erst nach oben zur Tenne, dann hinunter zum aufgestapelten Heuberg sieht. Der angenehme Geruch rührt von frischer Luft, die durch ein großes Loch im Scheunendach strömt und von den darunter gelagerten regennassen Heuballen.
Ein Großteil ihres Vorrats liegt in einer Wasserlache, die sich ausgebreitet hat bis zur anderen Seite der Scheune, wo zu allem Übel auch das Stroh zum Auskleiden des Kuhstalls wie eine Insel von Wasser umgeben ist. Schon jetzt weiß Lydia, dass sie nicht die Kraft haben wird, diese Massen an Heu und Stroh auseinander zu zerren, damit sie trocknen können. Und mit derselben Überzeugung weiß sie auch, dass sie nicht das Geld hat für eine Reparatur und neues Viehfutter für den nächsten Winter heraufbringen zu lassen, selbst wenn es nur noch für zwei Kühe reichen muss.
Sie hört, wie Wotan durch die Schlupftür springt, vernimmt das patschende Geräusch, das seine aufsetzenden Pfoten im stehenden Wasser erzeugen. Bei ihren eigenen Schritten war ihr das nicht aufgefallen – ihre Hoffnung muss sich über Verstand und Ohren gebreitet haben.
Nun, sie hat sich getäuscht, hat sich selbst und den Förster belogen. Ob der eine Lösung für sie gefunden hätte? Niemals würde sie diesen Mann um Rat fragen, und um Hilfe bitten schon gar nicht! Aber jemand anderen hat sie nicht mehr als Ansprechpartner.
„Verdammt, Gustav, ich habe deinen Starrsinn übernommen! Du hast mich nicht nur allein gelassen, du hast mich gleichzeitig isoliert!“