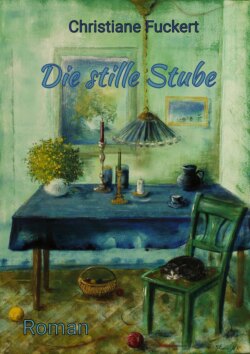Читать книгу Die stille Stube - Christiane Fuckert - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 5
ОглавлениеEine Stunde ist verstrichen. Nun hält der grüne Lanz vor dem Friedhofstor.
Wie von selbst hat er auf dem Rückweg hier abgebremst, ohne den eigentlichen Willen der Fahrerin.
In Lydias Gefühlswelt kämpfen Starrsinn und Herz schmerzhaft gegeneinander. Hitze und Kälte. Bedürfnis und Wut.
Sie streicht die Strähnen an ihren Schläfen zurück und wirft einen bangen Blick durch die schmiedeeisernen Stäbe. Stein an Stein, Kreuz an Kreuz, alles in Reih und Glied angeordnet und gepflegt wie die Balkone und Vorgärtchen im Ort.
„Na gut, Gustav, ich komm mal kurz rein. Aber nur, um nach dem Rechten zu sehen.“
Dem Hund befiehlt sie, sich auf seinem Trittbrett ruhig zu verhalten. Doch im Grunde braucht Wotan in solchen Situationen keine Kommandos – das meiste zwischen ihr und dem Tier geschieht in stillschweigender Übereinkunft.
Das Tor sperrt und quietscht, wie um ihr die Gelegenheit zu geben, ihrem bisherigen Standpunkt treu zu bleiben und weiterzufahren. Für einen Moment verharrt sie auf dem Kiesweg. Ihr Geisteszustand ist so zerbrechlich, dass sie ihren Entscheidungen oft nicht mehr trauen kann.
Dort hinten rechts in der Ecke, unter den Zweigen des einzigen Baumes auf dem Friedhofsgelände, hatten sie ihn bestattet. Es muss das hölzerne Kreuz sein, das vom Wind oder den Schneemassen des vergangenen Winters schief gefegt wurde. Eine lichtlose Ecke, in der es nie richtig Tag zu werden scheint.
Noch wagt Lydia nicht den Weg dorthin. Sie schlägt die entgegengesetzte Richtung ein. Das Doppelgrab ihrer Schwiegereltern ist bedeckt mit altem Laub. Nur eine einsame Pflanze ragt aus der einen Seite empor. Der Anblick bringt Lydia zum Schmunzeln, und ein aufkommender Mitteilungsdrang lässt sie schnurstracks zur dunklen Baumseite eilen.
„Das solltest du sehen, Gustav, drüben bei deinem Vater dringt die Kratzbürstigkeit durch den Erdboden. Eine gigantische Distel, die sich sogar in deine Richtung neigt!“
Gleich darauf schlägt sie die Hände vor die Augen. „Tut mir leid, Gustav. Es hat ja niemand danach gesehen. Fast ein ganzes Jahr lang nicht.“
Die familiären Gräber werden jedem Betrachter das unterstreichen, was längst in dessen Gedächtnis geschrieben steht: Hier stimmt etwas nicht!
„Dabei seid ihr alle im Ort daran beteiligt, dass ich mich hier nicht mehr habe blicken lassen“, flüstert Lydia. Durch den wässrigen Schleier vor ihren Augen blinzelt sie auf das windschiefe Kreuz. „Es wird Zeit, dass ich dir einen festen Rahmen aus Stein besorge.“ Sie fingert in ihrer Jacke nach einem Taschentuch, wischt sich über das Gesicht und schnäuzt sich, vergewissert sich dann, dass sie alleine ist, dass niemand sie hören kann.
„Ich war im Supermarkt, Gustav. Hab mich kaum zurechtgefunden, so lange war ich nicht mehr ausgiebig einkaufen. Dafür wurde ich immerhin zweimal gegrüßt, hörst du? Lydia Brause, die Hexe vom Berg, wurde hier unten im Tal von zwei Menschen gegrüßt! Ein Mal von der halbblinden alten Schweigerhofmutter, der andere Gruß kam von der Fremden an der Kasse. Davon muss ich jetzt zehren, bis ich wieder herunterkomme, bis ich wieder mal unter Menschen bin. Ha, aber Blicke hab ich zur Genüge erhalten, Blicke, die mir den Rücken durchbohrt haben. Doch ich werde einen Teufel tun und mich rechtfertigen! Dann müsste ich nämlich weit ausholen und deinen Dickschädel beschreiben. Und der war dermaßen dick, dass mir niemand so lange zuhören würde.“
Während sie spricht, harken ihre Finger durch die von Unkraut überwucherte Erde um die beiden kleinen Buxbäumchen herum. Wer sie gepflanzt hat, weiß sie nicht; in Anbetracht der verwahrlosten Grabstätte muss es noch vor dem letzten Winter gewesen sein.
„Vermutlich dein Freund Theo, der Doktor. Oder jemand, dem klar war, dass die kriminelle Lydia ihrem Opfer eh keine Blumen bringt. Womit er recht hätte, bis auf die Tatsache, dass es keine Kriminelle gibt und der wirklich Schuldige Gustav heißt.“
Lydia hat sich erhoben und ihre Wut lässt es gelingen, das Holzkreuz mit Wucht erneut in den Boden zu rammen, sodass es auf Anhieb geradesteht.
„Das war's dann“, murmelt sie mit hohler Stimme. Sie wendet sich ab und eilt aus dem Friedhofsgelände hinaus.
Am Traktor lehnt ein kleiner Junge. Lydia hat keine Beziehung zu Kindern, sie kann nichtmal sein Alter schätzen. Das Kind schaut ihr direkt in die Augen, wendet sich den großen Hinterrädern des Traktors zu. „Ist das deiner?“, fragt es und drückt den Daumen in das schmutzige Profil des Reifengummis.
„Meiner, ja. Und jetzt geh zurück, ich fahre gleich los.“ Lydia steigt an Wotans Kopf vorbei auf ihren Sitz. Den gefüllten Korb und eine weitere Tasche mit Einkäufen hat sie zu beiden Seiten an den Rückenstützen der Beifahrersitze festgezurrt.
„Darf ich deinen Hund streicheln?“, fragt der Junge.
„Nein, er beißt.“
„Schade.“ Der Junge strotzt vor Dreistigkeit, findet Lydia. Sie kann nicht nur schlecht das Alters eines Kindes schätzen, vielmehr hat sie überhaupt keinen Draht zu ihnen. Immer sind es die Söhne und Töchter von Spaziergängern, die plötzlich droben auf dem Hof auftauchen und die unverschämtesten Wünsche äußern.
Sie startet den Motor. „Jetzt geh endlich zurück, Junge, mach schon.“
„Darf ich ein Stück mitfahren?“
„Nein.“
„Warum nicht?“
„Darum. - Solltest du nicht in der Schule sein?“
„Ich bin krank.“
„Ah ja, das sehe ich. Und jetzt ab, zehn Schritte nach hinten!“ Das fehlt noch, dass man sie bezichtigt, fremde Kinder auf ihren Bulldog einzuladen! Lydia zwingt sich, das Kind eindringlich anzusehen, damit es den Ernst ihres Befehls erfasst. Der direkte Blickkontakt scheint den Jungen jedoch erneut zu ermutigen.
„Wo wohnst du?“, ruft er gegen den tuckernden Motor an.
„Da oben auf dem Berg.“
Warum hat sie das beantwortet?, fragt sie sich beim Davonfahren. Es liegt doch nahe, dass dieser Junge daheim erzählt, eine Frau mit Traktor habe ihm gesagt, sie wohne auf dem Berg und somit eine Art Einladung ausgesprochen, ein Lockmanöver …
„Gustav, ich brauche einen Fürsprecher, das ist ja alles kaum mehr auszuhalten“, klagt Lydia laut vor sich hin, und ihre Hände scheinen für einen Moment zu schwach, das Lenkrad zu umfassen. Selbst das Aufblitzen der Sonne zwischen den Wolken scheint sie warnen zu wollen. Sie sehnt sich zurück auf ihren Hügel. Doch dort wartet auf dem Küchentisch noch immer dieser bedrohliche Umschlag …
Mit einem Mal hat Lydia das Gefühl, ihre Nahrung vom Morgen von sich geben zu müssen. Sie gelangt gerade noch aus dem Ort heraus, um anzuhalten, vom Traktor zu klettern und sich über den Seitengraben zu beugen.
Es ist merkwürdig ruhig, nachdem Lydia den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen hat. Sie parkt genau vor ihrer Haustür. Wotan passt sich ihrer Reglosigkeit an. Selbst Mozart sitzt auf seiner Stange wie ausgestopft. Ob wieder jemand hier war? Jemand hier ist?
Sie verspürt nur noch das Bedürfnis, sich auf dem Sofa auszustrecken und ihre Gedanken zu sammeln. Doch bis dahin gilt es, alle Kräfte zu bündeln. Sie steigt ab und späht um sich. Rasch befreit sie den Hund von den Gurten des Trittbretts.
„Such, Wotan, such!“ Wer immer sich momentan in der Nähe aufhält, wird sich nun reflexartig bemerkbar machen, mutmaßt sie und trägt auf wackligen Beinen ihre Einkäufe in die Küche.
Der Brief liegt mitten auf dem Tisch – mit den Knitterfalten sieht er aus wie ein grinsendes Maul. Im nächsten Moment hat Lydia den Umschlag vom Tischtuch gefegt. Sie weiß nicht einmal, wo er gelandet ist.
„Ich bin alles so leid, Gustav! Worauf soll ich denn noch hinleben?“, keucht sie, während sie den schweren Einkaufskorb auf einen Stuhl wuchtet, damit sie sich beim Ausräumen nicht bücken muss.
Gemeinsam mit ihrem Mann waren die Einkaufsfahrten wie Ausflüge. Mittlerweile ist jeder Einkauf ein einziges Spießrutenlaufen, allein und völlig ungeschützt.
„Gustav, du sorgst dafür, dass ich von jedem Verdacht reingewaschen werde! Hast du gehört? Das ist ein Befehl. Der erste, den ich dir in unserer gesamten Ehe erteile. Und lass mich umgehend wissen, wie ich deinen Grabstein finanzieren soll! Das Geld vom Sparbuch lasse ich aufs Konto überschreiben, damit was da ist für all die Rechnungen für Haus und Grund, von denen ich nicht die geringste Ahnung habe. Die lassen sich ständig etwas einfallen, um mich zu schröpfen, wer weiß, ob das alles seine Richtigkeit hat. Der elektrische Strom ist teurer geworden, aber den zahl ich gerne, bin ja froh, dass die Leitungen über unsern Berg führen.“
Die Mittagssonne hat ihren Weg in die Küche gefunden. Die Fensterscheiben sind beinahe blind, einzig die Schlieren ihrer Finger aus der Stunde nach dem Unwetter unterbrechen die Trübung des Glases. Wotan, als Silhouette im Gegenlicht, steht wedelnd vor ihrem Stuhl und scheucht Staubfahnen durch die Luft.
Lydia muss niesen. „Wir ersticken im Mief“, sagt sie weinerlich zu dem Hund. Ihr Blick wandert hinüber zur Eckbank, zu Gustavs leerem Platz, gewiss zum tausendsten Mal seit dem letzten Herbst, und die Verzweiflung saugt ihr die Kraft aus dem Leib. Sie schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch. „Entweder meiden wir künftig die Küche oder wir verscheuchen die Erinnerung und räumen um!“
Die Konsequenz in ihrer Stimme lässt den Appenzeller innehalten und die Ohren aufstellen. So zumindest deutet Lydia einstweilen Wotans Haltung. Als ihr das Tier jedoch im nächsten Moment die Kehrseite zuwendet und knurrend hinausläuft, weiß sie, dass Gefahr im Verzug ist. Augenblicklich scheint sie zu versteinern, unfähig zur geringsten Bewegung. Nur ihr Gehör nimmt noch Anteil an dem, was sich vor dem Haus abspielt.
Sie wohnt lange genug in diesem Gebäude, um die Geräusche im und ums Haus herum entschlüsseln zu können. Das stumpfe Schaben auf dem Pflaster rührt von Schuhen, von kurzen, zielstrebigen Schritten. Dann ein Rascheln, ein leises Poltern, das darauffolgende Winseln ihres Hundes, ein weiterer Polterschlag, und dann Totenstille. Wenn soeben jemand ihren Hund ausgeschaltet hat, kann sie froh sein, ihr eigenes Leben zu behalten. Aber ein Leben ohne Wotan, hier oben ganz allein?
Das nächste Geräusch, das zu ihr in die Küche dringt, ein Laut von quietschenden Eisenfedern, bringt Leben in ihre erstarrten Gliedmaßen. Sie stößt sich vom Tisch ab, rappelt sich auf die Beine und schleicht wie ein Einbrecher durch den Hausflur. Langsam schiebt sie den Kopf am Türrahmen vorbei, ihre Augen fliegen über den Vorhof. Wenn man ihr den Lanz stehlen will, bitte sehr! Auf ihn kann sie verzichten. Nur sollte ein Dieb sie selbst nicht unbedingt zu Gesicht bekommen.
Ruckartig zieht sie den Kopf zurück, mit der bangen Frage im Hinterkopf, wo in dem Fall dann aber ihr Hund abgeblieben ist …
Erneut reckt sie den Hals, so weit, dass ihr Blickwinkel die großen Hinterräder des Traktors erfasst. Umgehend atmet sie durch, tief und befreit. Das Bild, das sich ihr bietet, ist an Einklang nicht zu übertreffen: Der Appenzeller liegt auf dem Trittbrett des Traktors und gleich über ihm thront in der Fahrerschale der Junge. Auf beiden Mienen liegt ein Ausdruck des Triumphs: Der Junge hat, was er will, und ihr Hund glaubt, es gehe wieder auf große Fahrt. In der Tiefe ihres Herzens ist sie erleichtert und gönnt beiden den Genuss des Augenblicks. Doch solche Gefühle sind ihr nicht mehr erlaubt, wenn sie klare Verhältnisse bewahren will. Der Kloß in Lydias Hals fliegt zugleich mit ihrer schrillen Stimme über die gesamte Umgebung.
„Was fällt dir denn ein?! Mich so zu erschrecken! Runter da, sofort!“ Sie betont jede Silbe, denn sie hat kaum mehr die Kraft, sich zu wiederholen. In Strümpfen steht sie auf dem kalten Steinboden und wartet darauf, dass das Zittern ihrer Knie nachlässt.
„Das ist ein toller Traktor!“, entgegnet der Junge, als hätte es Lydias Befehl nie gegeben. „Fahren wir denn jetzt mal ein Stück und ich darf lenken?“
Diese Kinderstimme klingt etwas zu tief, denkt Lydia, und die Vorderzähne sind zu groß. Seine Haare wirken ungepflegt und der bunt geringelte Pullover mit den Goldknöpfen am Ausschnitt wurde dem Jungen offenbar von einem Mädchen vererbt.
Dass sie plötzlich nachgibt, mag an dieser vernachlässigten Aufmachung liegen oder an der Gewissheit, dass hier nichts Schlimmes im Gange ist.
Vielleicht spielt aber auch ein eigennütziger Gedanke mit, als sie sagt: „Na gut, dann verhalt dich ruhig, ich zieh mir die Schuhe an.“ Sie wirft einen letzten tadelnden Blick auf den Jungen, der nun mit speckigen angespannten Fäusten erwartungsvoll nickt. Auch Wotan erhält ein stummes Kopfschütteln von ihr, bevor sie sich im Hausflur ihren Arbeitsschuhen zuwendet.
Während ihr Gehirn in gebeugter Haltung gut durchblutet wird, nistet sich unter einem Lächeln eine befreiende Idee ein, die ihr auf der Stelle neue Kraft verleiht.