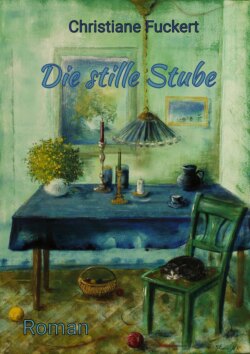Читать книгу Die stille Stube - Christiane Fuckert - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 8
ОглавлениеDer Junge scheint Wort gehalten zu haben.
Es sind drei Tage vergangen, ohne dass jemand aufgetaucht ist, um ihr einen Vortrag über unbefugte Einladungen an fremde Kinder zu halten. Es hat auch niemand mehr vor ihrer Tür eine Zigarette ausgetreten.
Ein eigenartiges Schweigen umgibt den Brausehof, obwohl sich im Grunde nichts im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen dieses Trauerjahres verändert hat. Wie immer steht sie alleine da mit ihrer Arbeit und ihren Tieren. Und doch will es Lydia so vorkommen, als habe etwas diese triste Normalität unterbrochen.
Es muss die, zugegeben etwas lästige, kurze Gesellschaft des Kindes gewesen sein, die ein altbekanntes Bedürfnis in ihr wiedergeweckt hat. Dem Knaben namens Olav mit Vogel-F war es kurzfristig gelungen, die zähflüssige Atmosphäre um sie herum aufzumischen und durchzulüften. Nachdem er gegangen war, roch es in ihrer Küche nicht mehr nur nach Einsamkeit und alten Putzlappen und feuchtem Hund. Für eine Stunde war es einmal nicht Gustav gewesen, für den sie ihre Sprache noch nutzt, auch waren es nicht ihre Tiere und die notwendigen Selbstgespräche, die ihre Stimmbänder beweglich halten sollen. Nein, sie hatte unvorbereitet reagieren müssen, war gefordert worden von den Fragen und Bemerkungen eines Gegenübers.
Trotz der vermeintlichen Zuverlässigkeit dieses Jungen bleibt Lydia auf der Hut, denn die dort unten sind unberechenbar.
„Stopp!“, appelliert sie an sich selbst. „Reiß dich zusammen und lass nicht wieder die Bitternis aufsteigen. Denk nur an schöne Dinge. Irgendwann müssen doch mal bessere Zeiten anbrechen, die schlechten hast du ja nun alle durchgemacht.“
Ob Geldscheine im Kühlschrank brüchig werden? Sie eilt in die Küche und holt den kleinen eiskalten Topf hervor, hebt den Deckel und starrt auf das Bündel von Banknoten, die großen rotbraunen, die mit einem Gummiring den Rest umschlingen.
Unvorstellbar, wenn sie drunten im Supermarkt mit einem Fünfhunderter bezahlen würde ... Ein anderer Empfänger wiederum würde diese Größenordnung als normal einstufen, einer, der ihr vielleicht …
„Was meinst du, Gustav? Soll ich es wagen?“ Ganz kurz fragt sie sich, ob er, wenn er sie hört, auch ihre Gedanken mitverfolgen kann. Doch mit dieser Überlegung will sie sich später beschäftigen, dann, wenn sie wieder einmal entmutigt dasitzt und etwas Sinnvolles zum Nachdenken braucht.
Während Lydia sich mit Eimer und Schwamm das blinde Küchenfenster vornimmt, arbeiten ihre Gedanken an anderen Ansätzen weiter.
In Sachen Geld und Bürokratie entspricht ihr Wissen dem eines Kleinkindes. Etwas, mit dem man nie in Kontakt gekommen ist, bleibt so lange Fremdland, bis man sich dorthin auf den Weg macht, um Erfahrungen zu sammeln und zu lernen.
Sie hat keine Ahnung, wie das Finanzen-System funktioniert, auch nicht, ob man Geldgeschenke stillschweigend annehmen darf. Der bündige Begleitzettel enthält ein Wort, das sich nach dem Vokabular eines Sachkundigen anhört: rechtmäßig. Der gefüllte Umschlag soll also ein rechtmäßiges Geschenk sein. Etwas, das ihr zusteht.
Würde ihr dieses handschriftliche Formular ohne Unterschrift aber nützlich sein, wenn das Ganze sich als teuflischer Plan entpuppte, wenn es gestohlenes Geld wäre, das man bei ihr wiederfinden würde?
Lydia legt den triefenden Schwamm zur Seite. Sie beginnt sich auf eine andere Art für die Scheine zu interessieren und betrachtet sie näher, durch ihre Brille und gegen das Licht. Geldscheine haben ein Wasserzeichen und einen eingewobenen Silberstreifen, so viel glaubt sie jedenfalls zu wissen. Dass es 500-Mark-Scheine gibt, wusste sie hingegen nicht.
Sie drückt eine der beiden großen Banknoten an die feuchte Scheibe, streicht darüber, bis sie wie festgeklebt dort haften bleibt. Dann tritt sie einen Schritt zurück. Der rasierte Mann mit dem breiten Hut und dem Pelzkragen blickt redlich drein, so, als wolle er Lydia beruhigen, dass er wirklich der ist, für den sie ihn halten soll: der Hüter eines rechtmäßigen Schatzes.
Nacheinander pappt Lydia alle Geldscheine an die Scheibe. Sie muss kichern: Ein Fremder draußen könnte glauben, es handele sich um das Schaufenster eines Geldfälschers, einer Blütenfabrik.
Der erste Schein, der abfällt, wird ausgegeben, handelt Lydia im Geiste mit sich aus. Sie muss nicht lange warten, die Scheibe beginnt zu trocknen und ein grüner Zwanziger segelt auf die Fensterbank. Damit könnte sie drunten im Laden ihren kleinen Einkaufskorb mit dem Nötigsten füllen, kalkuliert sie kurz. Nach und nach löst sich ihr gesamter suspekter Reichtum vom Glas. Nun tut sich die unvermeidbare Frage auf, was sich mit einem solchen Geldbetrag so alles ausrichten ließe …
Lydia kennt keine Preise und keine Summen, durchblickt gerade noch die Kosten im Bereich der Nahrungsmittel. Im vergangenen Frühjahr benötigte sie neue Gummistiefel. Bis heute weiß sie nicht, ob man in dem kleinen ortsansässigen Schuhgeschäft von ihr den rechtmäßigen Preis, die Hälfte oder das Doppelte des wahren Wertes gefordert hat. Die Schuhe waren nicht ausgezeichnet, und ihr ging es nach erfolgreicher Anprobe einzig noch darum, zu bezahlen und den Laden so schnell wie möglich wieder mit diesen Stiefeln zu verlassen, um sich auf ihren sicheren Berg zu verziehen.
„Warum hab ich solche Angst vor Menschen, Gustav? Wie dumm bin ich eigentlich? Wahrscheinlich so dumm, wie du mich gern gesehen hast. Als eine Frau, die nie nachfragt, die alles hinnimmt, wie man es ihr vorsetzt. Aber jetzt kann ich nichts mehr einfach hinnehmen, weil niemand mehr da ist, der mir etwas gibt, verstehst du, Gustav? Jetzt muss ich mir selbst etwas geben. Aber das habe ich nie gelernt. Ich war nie anspruchsvoll. Das einzige, worum ich ständig gebettelt habe, waren frische Farben. Aber für den Brausehof war immer alles gut genug. Wann kam uns auch mal jemand besuchen? Ja, deine Skatbrüder. Und wen von denen hat es geschert, wie unsere Wände aussehen? Schau dich doch um in meiner Einsiedlerklause. Hier wird nicht mehr gelebt. Alles ist karg und schäbig, die Tapeten im ganzen Haus sind schmuddelig. Verblichene Muster in allen Zimmern. Ich brauche wenigstens einen Raum, der mich freundlich aufnimmt. Ich will nicht mehr länger von draußen aus dem bunten Licht in ein finsteres Loch wechseln, wenn ich mein eigenes Haus betrete. Du hast es gut, treibst dich jetzt im puren Himmelblau herum, dabei war genau das immer meine Farbe! Nicht grau und braun und schmutzig und verlebt und verblichen und trist und … ach, lass mich doch in Frieden!“
Diese Rede hat Kraft gekostet. Lydia sitzt auf der Eckbank. Was hat sie da gerade von sich gegeben? Etwas, das ihr erst beim Aussprechen bewusst geworden ist? Hat sich so viel Unzufriedenheit in ihr angestaut? Oder haben diese Geldscheine sie so schnell verführt, Pläne für Erneuerungen zu schmieden? Vielleicht aber schließt sich solch ein plötzliches Bedürfnis nach Veränderung ja ganz natürlich einem Trauerprozess an? Vielleicht gelingen Gedanken in andere Richtung nur, wenn zuerst die Umgebung sich verändert und die vielen Erinnerungen dadurch ein wenig beiseite gedrängt werden? „Und wenn schon, mein lieber Gustav. Schau halt weg, wenn's dir nicht passt!“
Mit Hingabe erhält jede einzelne Banknote ihren Platz auf dem Tischtuch. Lydia schiebt und sortiert, bis das Gesamtbild vor ihr ein geordnetes Muster ergibt.
An dem völlig verschmierten Fenster ziehen Wolkenfetzen vorbei, denen Lydia augenblicklich ein namentliches Gebilde zuspricht. Sie ist schon immer eine Wolkendeuterin gewesen. Die Formationen am Himmel sind ihre ganz persönliche Literatur, und hier oben ist man den Wolken so nah, als würde man die Nase in ein Buch stecken.
„Das ist dein Grinsen, was da gerade vorbeifliegt, stimmt's? Du bist gar nicht aufgebracht über meine Standpauke. Du bist derjenige, der diesem Umschlag den Weg zu mir gezeigt hat.“
Die Wolken wandeln ihre Form, wie Lydia ihnen entnimmt, zu einem breiten schlafenden Gesicht und sind im nächsten Moment in der rechten Fensterecke verschwunden.
„Wie du meinst, dann mach dich halt aus dem Staub. Dir sind solche Dinge ja egal, du willst nicht, dass ich dich damit noch belästige. Hast ja recht, mit alldem hast du nichts mehr zu tun. Aber ich, Gustav, ich bin noch hier, ich kann nicht einfach wegsehen und davonfliegen wie ein Luftballon.“
Lydias kurz erwachte Lebenslust zieht sich zurück, dahin, wo sie nicht bewusst abgerufen werden kann. Sie betrachtet ihre Bäuerinnenhände mit der pergamentdünnen Haut über dem hervortretenden Adergeflecht, beobachtet wie ein neutraler Zuschauer, wie diese Hände die Geldscheine sorgfältig einsammeln und sie gewissenhaft in der Zigarrenkiste im Kleiderschrank verstauen. Nur der symbolhafte Zwanziger verbleibt in der Küche, gut sichtbar eingeklemmt zwischen dem Schiebeglas ihrer Vitrine, durch die das Perlmuttservice ihrer Schwiegermutter schimmert.
Beim Anblick der zierlichen Mokka-Tässchen wird Lydia von einem Gedanken regelrecht geflutet, so spürbar klar, dass ihr Herz einen Satz macht und sie sich nichtmal mehr über die eigene sauber melodische Singstimme wundert, mit der sie ihren Fensterputz fortsetzt. Immer noch summend nimmt Lydia sich auch den Rest der Küche vor, hängt dabei fasziniert und zugleich schuldbewusst ihrer Idee nach.
Sie isst ihr Nachmittagsbrot, spült ihren Teller und das benutzte Messer ab, bürstet vor dem Haus Wotans Fell durch und kann sich endlich überwinden, die beiden kleinen Fressnäpfe von Marschall zu entsorgen. Hier neben der Bank haben sie nichts mehr zu suchen, es gibt keinen Kater mehr, genauso wenig, wie es auf diesem Hof noch einen Bauern gibt. Nur Marschalls Schlafkorb will sie aufbewahren – eine Erinnerung an ihren treuen Hofkater muss ihr verbleiben.
Die Arbeit hat Lydia nun fest im Griff, die resoluten Bewegungen tun ihr gut. Sie reinigt das Hühnergehege inmitten der gurrenden Schar des Federviehs. Und immer wieder reibt sie sich zwischendurch die Augen hinter den Brillengläsern und lässt ihren Blick über das Panorama aus türkisgrünen Tannenspitzen und sattem Himmelblau schweifen. Genau das ist es, denkt sie dann jedes Mal, genau das wird einen Teil meiner Seele heilen.
Es wird ein paar Tage brauchen, bis sie es sich erlaubt, die Tür am Ende des Wohntraktes zu öffnen, aber wer sonst, wenn nicht sie hat das Recht dazu? Und wann, wenn nicht jetzt sollte sie sich dieses Recht nehmen? Es wird Mut erfordern, das ist gewiss, aber wenn sie den erst gefasst hat, wird sie sich fragen, warum sie diesen Mut nicht schon vorher hatte, eben weil genau das schon so lange ihr Recht war …
Lydias Gedanken schlagen Purzelbäume, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, und dazwischen jedes Mal einen Salto der Zuversicht. So lange, bis sie spätabends in ihrem Bett liegt, todmüde von der Arbeit des Tages und immer noch überwältigt von ihrem Vorhaben. Doch immer, wenn sie glaubt, wohlig mit der Matratze zu verschmelzen, zieht ein Film wie ein giftiger Faden durch ihre Träume: die Bilder ihres verletzten, leblosen Katers, den sie an den Hinterbeinen vor sich hält, um ihn in seine kleine Erdgrube zu betten.
„Marschall, flieg zu Papa und lass dich trösten, er hat jetzt sehr viel Zeit für dich.“