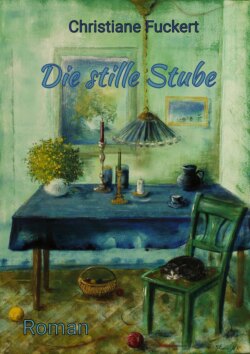Читать книгу Die stille Stube - Christiane Fuckert - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеIn dieser Nacht wartet sie vergeblich darauf, einschlafen zu können.
Selbst wenn Gustav neben ihr liegen und alles mit ihr besprechen würde – unter diesen Umständen wären Sorgen so oder so berechtigt. Bis auf den Unterschied, dass es mit ihm an der Seite das wohltuende Wörtchen ‚wir’ gäbe.
Lydia hat ihr Bett verlassen. Es macht keinen Sinn, so verkrampft dem Schlaf aufzulauern.
Aus verschiedenen Blechdosen mischt sie in der Küche getrocknete Kräuter für einen Teeaufguss zusammen. Sie weiß nicht, welche Wirkung diese Zusammenstellung hinter sich herziehen wird – auf das Kräuterlexikon in ihrem Kopf hat sie im Augenblick keinen Zugriff.
Schafgarbe, Kamille, Rosmarin, Pfefferminz, Beinwell ... Vielleicht wird sie noch unruhiger, als sie es so schon ist.
Sie lässt sich auf dem abgewetzten Sofa nieder und betrachtet Gustavs Sessel, das Kissen, das sein schweres Kreuz gestützt hat. Für dieses Möbelstück ist die Zeit schon lange stehen geblieben, nicht einmal die Kissenfüllung hat sich wieder aufgerichtet – der Abdruck der Kehrseite ihres Mannes ist noch genauso, wie seine abendliche Haltung ihn geformt hat. Nach seinem Tod hat nie wieder jemand diesen Sessel benutzt. Wenn sie jetzt hinübergehen und ihre Nase in die Polster drücken würde, Gustavs Geruch wäre sofort präsent. Lydia hat sich ihn oft genug auf diese Weise zurückgeholt: ein Aroma aus Mulch, Erde und Schmierseifenwasser.
Sein Foto hingegen verwahrt sie in einer Schublade. Noch mag sie ihm nicht unvorbereitet in die Augen sehen. Es ist die einzige Porträtaufnahme, die ihres Wissens von ihm existiert. Auf dem Brausehof wurde nicht fotografiert. Nur ein kleiner Karton existiert, eine spärliche Ansammlung von Fotografien aus einer Zeit, in der man den Moment noch für wesentlich hielt. Später diente ein Motiv nur noch dem Vergleich der Entwicklung von Jungvieh beim Wachstum. Vorher-Nachher-Fotos.
„Fotos erinnern einen doch nur daran, dass es einmal anders war. Und die Zeit, die man braucht zum Justieren und den Auslöser zu drücken, geht einem an wahren Eindrücken verloren.“
Mit solcher Art von Argumenten setzte Gustav gern seine Sichtweise durch. Er hatte eine recht helle, laute Stimme. Nur wenn er leise sprach, sackte sie in einen warmen Bariton ab.
„Wenn du wüsstest, dass wir ein Loch im Dach haben“, flüstert Lydia dem Sessel zu. „Ein Baum ist genau auf die Stelle gefallen, die du mit einem Stück Wellblech repariert hattest. Hat wieder gepasst, was? Dem gesamten Rest vom Dach hätte das wahrscheinlich nichts ausgemacht. Und jetzt ist das Heu nass, Gustav, das, was noch im Trocknen liegt, wird nicht mehr lange reichen für die Kühe. Hast du überhaupt mitgekriegt, dass ich nur noch die zwei alten Kühe habe, die nicht mehr kalben? Die vier anderen musste ich abholen lassen, allein wäre ich mit den Milchkühen nicht mehr fertiggeworden. Und du weißt, wie schwer es mir immer gefallen ist, mich von unserem Viehzeug zu trennen. Gelitten hab ich jedes Mal, als ginge es mir selbst ans Leder! Und dann dieser letzte Abtransport, den auch noch ich veranlassen musste… Aber das sag ich dir: Diese beiden letzten kriegen auf dem Brausehof das Gnadenbrot, und wenn es tausendmal gegen den bäuerlichen Grundsatz ist, unrentables Vieh durchzufüttern. Und gerade jetzt ist das Winterfutter nass. Ach, Gustav, wenn du wüsstest … Aber vielleicht weißt du es ja und schickst mir eine Idee, wie ich die ganze Misere überstehe?“
Lydias zitternde Hände wärmen sich an Gustavs großem Teebecher.
„Die Weidenzäune müssten auch neu gespannt werden. Ein paar Pfähle sind morsch. Aus deinem Komposthaufen wuchert das Unkraut. Du immer mit deinem Kresse-Test, ob die Erde gut war zum Durchsieben. Jetzt könnte ich mit Mainzauber und Giersch handeln, das müsstest du sehen, Gustav, du würdest Fotos machen von deinem Komposthaufen, als abschreckende Erinnerung, eine Vorher-Nachher-Aufnahme. Außerdem ist die Tränke an der Weidenquelle vermoost. Den Kühen schmeckt das Wasser daraus nicht mehr, es wird sofort trüb und schmierig. Jetzt muss ich regelmäßig den Wassertank beim Eingang füllen. – Ach ja, und es gibt Tausende von Maulwurfshügeln in diesem Jahr. Ich kann nicht wie du mit der Maulwurferde meinen Salat anziehen, bin froh, wenn ich überhaupt ein paar vernünftige Köpfe ernten kann. Mir wird das jetzt schon alles zu viel. Ich bin schwach geworden, Gustav, und sehr sensibel, kann nicht mal mehr ein Spinnennetz wegmachen, weil ich erst jetzt ahne, wie viel Arbeit in so einem haarfeinen Gebilde steckt. – Hach, weißt du was? Ich hol mir was von deinem Selbstgebrannten!“
Lydia rappelt sich auf die Beine. Der Schnaps steht seit Gustavs Tod unangetastet in der hinteren Ecke im Schrank. Endlich hat sie einen Grund, eines der kleinen Gläschen zu benutzen, die ihr so gut gefallen. „Ich weiß, das sind Likörgläser, aber das muss dir jetzt egal sein. Hier wird nicht mehr nach Richtlinien gelebt, hier wird sich nur noch irgendwie über Wasser gehalten. Und wenn ein falsches Glas die Stimmung hebt, was soll’s!“
Der lange, gebogene Ausschank lässt die klare Flüssigkeit über den Rand des winzigen Glases schießen. „Guck weg, Gustav, den Rest schütte ich sowieso in den Spülstein. Das will ich mir nämlich nicht anfangen ...“ Lydias Zunge tastet den Schnaps, dessen Geruch allein ihr schon immer widerlich war. Ekel überkommt sie, dann kippt sie den Inhalt in ihren weit geöffneten Mund und schüttelt sich. „So, angefangen und sofort wieder abgewöhnt.“
Mit eigentümlicher Genugtuung trägt sie die Flasche in die Küche und lässt den Schnaps in den Ausguss gluckern.
„Das tut weh, Gustav, ich weiß, so sparsam, wie wir immer gelebt haben ... Aber freu dich für meinen Entschluss, ich bin zur Zeit so labil, mit dem Alkohol zum Freund könnte hier alles vor die Hunde gehen.“
Hinter sich hört Lydia leise Schritte auf den Holzdielen. Wotan hat seinen Schlafplatz im Flur verlassen und trottet müde auf Lydia zu. Er rechnet nicht mit Besuch, hat sich längst an die Selbstgespräche gewöhnt. Vermutlich hat das Wort ‚Hunde’ ihn veranlasst zu kommen. Er folgt Lydia zum Sofa, legt sich auf dem abgenutzten Teppich auf die Seite und schläft sofort wieder ein. So lag er abends bei ihnen, wenn der Fernseher eingeschaltet war.
Lydias nackter Fuß schlüpft aus der Holzpantine und krabbelt durch das warme Hundefell. Sie muss dringend ihre Füße baden, die Fußsohlen sind hart vom vielen Stiefeltreten, es könnten sich Druckstellen entwickeln. Überhaupt wird sie mehr auf sich achten müssen, denn Kranksein kann sie sich nicht mehr erlauben, nicht, seit hier alles von ihr abhängt.
Seit gewiss zehn Jahren hat sie keinen Arzt gebraucht.
„Wozu eigentlich die teuren Beiträge?“, hatte Gustav vor ein paar Jahren gemeint, „meine Lydia mit ihren Wildkräutern weiß mehr als jeder Doktor.“
Gustavs Überschlag zufolge wären die wenigen Arztbesuche, die eventuell wahrgenommen werden mussten, immer noch viel günstiger gewesen als die Versicherungsbeiträge. Freiwillige ‚Prognosegelder’ lehnte er grundsätzlich ab.
Welch ein Glück nun für Lydia, dass ihr Mann durch seine Tätigkeit bei der Straßenwart pflichtversichert war und sie damit ebenso. „Wer weiß, was dir Querkopf eingefallen wäre ohne diese automatischen Abzüge. Wahrscheinlich hättest du es irgendwie fertiggebracht, uns völlig ungesichert meinem Kräuterlexikon zu überlassen, du altmodischer Dickkopf, der du warst! Ein Wunder, dass wir überhaupt einen Fernseher besitzen!“
Moment, der Fernseher!, schießt es ihr heiß durch alle Glieder. Der Stecker ist während des Unwetters in der Wanddose geblieben! Ob dieser einzelne heftige Schlag in das Gerät gefahren ist? Seitdem hat sie es nicht wieder eingeschaltet.
Noch mehr belastende Gedanken kann sie im Moment jedoch nicht gebrauchen. Sie wird morgen testen, ob der Fernseher noch funktioniert. Nur den Stecker will sie für diese Nacht herausziehen.
Während sie sich über das Gerät beugt, nimmt sie ein leises Trommeln über sich wahr. Es hat wieder zu regnen begonnen, nicht stark, aber mit einzelnen dicken Tropfen. Die Tür zur Speichertreppe steht offen, erinnert sie sich. Dort oben schlägt der Regen seinen Rhythmus auf das Fensterchen aus Plexiglas, das sie im letzten Jahr hatten einbauen lassen, damit diese Dachbodenseite ein wenig mit Tageslicht versorgt wurde.
Genauso würde jetzt nebenan das Heu in der Scheune besprenkelt werden.
Lydia wundert sich über die innere Ruhe, die sie plötzlich erfüllt. Ihr ist wohlig warm. Sie greift nach der Wolldecke am Sofaende, zieht sie sich bis über die Schultern und lässt sich zur Seite sinken.
Ob das Scheunendach eigentlich gegen Wetterschäden versichert ist? Aber an wen wendet man sich in solch einem Fall? Sie weiß es nicht, im Grunde weiß sie gar nichts. Nur, dass ein paar Meter weiter eine arme Tanne aus der Verankerung gerissen wurde und ihr Dach gleich mitverletzt hat ...
Bei aller Liebe zur Natur bringt der Gedanke an den umgestürzten Baum sie zum Schmunzeln. Was, wenn sie das gemeinsam mit dem Förster entdeckt hätte? Bestimmt hätte der sich mehr für seinen Baum interessiert als für ihren Dachschaden. Wieder muss sie lächeln. Vielleicht bekommt sie selbst ja nach und nach diesen Schaden – und alles wird ihr nichts mehr ausmachen ...
Wotans dicker Schädel hechelt den heißen Hundeatem genau in ihr Gesicht.
Lydia ist verwirrt, weiß weder, welche Tageszeit es ist noch warum sie auf dem Sofa liegt.
Die Zeiger der Wanduhr gegenüber stehen auf halb fünf, das Pendel bewegt sich nicht. Hat sie einen Mittagsschlaf gehalten? Aber am helllichten Tag verschließt sie doch niemals die Klappläden zur Frontseite hin ...
Durch den schweren Vorhang am seitlichen Fenster fällt ein Spalt Tageslicht auf die Wand mit der Uhr und dem verstaubten Sims gleich daneben. Dieser Anblick ist ihr nicht vertraut, nicht aus der Liegeposition heraus.
Lässt ihr Gedächtnis nach? Fühlt es sich so an, wenn man entdeckt, dass man sich auf die eigene Orientierung nicht mehr verlassen kann?
Als sie auf dem Tisch nach ihrer Brille angelt, bleibt ihr Blick an dem Likörglas haften. Und sofort erschließen sich ihr alle Antworten: Sie hat die Nacht hier verbracht, mit dem Kopf auf der Sofaseite, die seit jeher ausnahmslos die Fußseite war. Und Wotans unruhiges Hecheln signalisiert, dass er dringend ins Freie muss, weil es schon spät ist.
Erleichtert über ihre plötzliche Klarheit steht sie auf und öffnet die Haustür. Sofort zeigt der Hund Unruhe, klebt mit der Nase auf dem Boden und nimmt Spur auf, Richtung Stall und Scheune.
Der Fuchs war da, folgert Lydia. Sie sieht, wie der Hund sich dreht und die Spur zurückverfolgt, doch dann läuft er an ihr vorbei und aus dem Hof hinaus.
„Wotan, hierhin!“ Nein, ein Fuchs ist nichts Weltbewegendes mehr für ihren Hund, den handelt sein Geruchssinn ab wie die anderen Nachbarn, die Hasen, Rehe, Igel und Marder.
Sie hört ihn in der Ferne bellen, mutet es sich jedoch nicht zu, erneut so laut zu rufen – ihr Herz rast jetzt schon schneller als es darf.
Im Nachthemd setzt sie sich auf die Bank neben der Haustür und wartet, betrachtet die alten Pflastersteine, durch deren Ritzen sich das Unkraut empordrängt. Kaum mehr zu bewältigen, das alles; doch sie darf solche Nebensächlichkeiten nicht mehr an sich heranlassen, sonst kann sie gleich aufgeben.
Mit einem Mal erstarrt ihr Blick. Nicht weit von ihren Pantoffeln liegt eine ausgetretene Zigarette. Hier war jemand ... Wer war hier? ... Der Förster hatte weiter vorn geparkt und auf der Wiese mit ihr gesprochen ...
Das also ist der Grund für Wotans aufgeregte Stöberaktion. Womöglich hat jemand auf dieser Bank gesessen, während sie gleich hinter dem nächsten geschlossenen Laden geschlafen hat. Und Wotans Wegstrecke zufolge muss dieser Mensch zu Stall und Scheune gegangen sein. Das Hühnerhaus ist noch verriegelt, darauf kann es niemand abgesehen haben.
Warum hat Wotan nicht angeschlagen? Kann sie sich jetzt nicht mal mehr auf ihn verlassen? Lässt er genauso nach wie sie? Doch im Moment wäre sie einfach nur erleichtert, wenn er überhaupt zurückkäme.
„Gustav, wenn du das kannst, dann gib acht auf mich, ich hab niemanden mehr ...“
Das Selbstmitleid treibt ihr heiße Tränen in die Augen und sie spürt, wie ihr Körper sich verkrampft. Dann hört sie es rascheln, kurz darauf sieht sie Wotan, der auf sie zugerannt kommt. Bei dieser Mobilität ist nicht zu befürchten, dass ihr Hund nachlässt. Wotan ist jetzt acht, ein robuster Appenzeller, dessen Rasse eine durchschnittliche Lebenserwartung von zwölf Jahren zugeschrieben wird. Bei seinem Anblick wünscht Lydia, dieses Tier möge sie überleben, wird aber unmittelbar von ihrem Gewissen aufgefordert, so egoistisch nicht zu denken und einigt sich auf den Wunsch, dass sie selbst gerade lange genug lebt, damit Wotan bis zum letzten Atemzug versorgt und behütet ist.
Er trägt etwas im Maul, einen toten Vogel, den er sachte vor Lydias Bank ablegt. Sie weiß, dass er die Amsel in diesem Zustand gefunden hat. Gustav hat es nie zugelassen, dass Wotan Vögel jagte, geschweige denn verletzte.
„Da ist nichts mehr zu machen, mein Guter“, sagt Lydia, indem sie den geknickten Flügel der erstarrten Amsel zwischen zwei Finger packt und damit ums Haus herum schlurft. An der Rückseite des Wohntraktes endet der Privatbereich des Brausehofes, zumindest vom Interesse her, wenngleich das Stück unbearbeitetes Land noch dazugehört. Hier hat man die Natur allezeit sich selbst überlassen. Farne und Gräser reichen meterhoch, und ein paar alte Tannen halten die sommerliche Glut der Südseite vom Haus entfernt.
Lydia legt den toten Vogel ins Gras. Soll der Fuchs ihn holen – auch das regelt die Natur von selbst.
Wieder nimmt Wotan intensive Witterung auf. Es ist jemand hier gewesen, folgert Lydia erneut, vielleicht bekommt sie gleich einen Schlag auf den Kopf, wer weiß ...
Solche beklemmenden Situationen sind ihr nicht unbekannt. Wenn man alleine in der Wildnis lebt, weit abseits jeder menschlichen Siedlung, wird man irgendwann selbst zu einem Teil des Waldes. Wenn man dann noch dasselbe Pech hat wie die linke Tanne, die schräg auf dem Scheunendach liegt, ist man selbst auch ganz schnell ein gestürzter Baum, dem es die Lebenskraft mitsamt den Wurzeln ausreißt.
„Siehst du, Gustav, dein Vater hatte recht: ‚Eines Tages werden uns die Tannen so nah beim Haus zum Verhängnis.’ Du hast dich durchgesetzt, hast erst letzten Sommer noch gesagt, das Ozonloch lässt mit den Jahren die natürlichen Schattenspender immer kostbarer werden ... Jetzt kannst du entscheiden, was kostbarer ist: der Baum oder unser Dach ... Aber was muss dich das noch kümmern ...“
Der hohe Flurspiegel, den Gustav stets ‚Lügner’ nannte, weil er den Betrachter lang und unterernährt wiedergibt, bringt Lydia dazu, über sich selbst zu lachen. Bevor ihr draußen jemand etwas zuleide getan hätte, wäre er selbst geflüchtet. Sie sieht aus wie ein geschundener Geist. Das Nachthemd ist nass und schmutzig von den Waden bis hinauf zur Hüfte. Ihr offenes weißgraues Haar hängt in langen Strähnen auf ihren Schultern, die Brille ist befleckt und ihre Nasalfalten wirken in dem Zerrspiegel wie Narben von Axthieben.
Ehe ihr herausrutschen will: „Gustav, dreh dich weg, sieh nicht hin!“, verschluckt sie diese Äußerung lieber. Am besten macht sie gar nicht erst auf sich aufmerksam, vielleicht beschäftigt er sich ja noch mit der umgestürzten Tanne hinterm Haus.