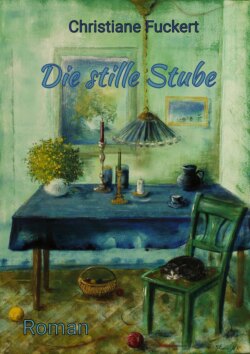Читать книгу Die stille Stube - Christiane Fuckert - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 7
ОглавлениеWenn sie gleich aufwacht und sich an diesen Traum noch erinnern kann, wird sie stolz sein, ihre Probleme zumindest für die Zeit des Schlafens alleine lösen zu können. Sie wird ihrem Mann davon erzählen, auch, dass sie diesen erträumten Brief als eine Antwort von ihm betrachtet hat.
Da sie so klar denken kann, müsste es gleich so weit sein: Der Hahn wird krähen, sie wird die Augen aufschlagen, gegen die Deckenleuchte ihres Schlafzimmers schauen und ihrem Traum nachhängen, wie man einen eindrucksvollen Spielfilm noch eine Weile auf sich wirken lässt.
Etwas unter ihr regt sich. Es muss Wotans dicker Schädel sein, der sich am Fußende des Bettes an ihre Beine schmiegt …
Lydia hebt den Kopf. Sie blinzelt gegen das grelle Sonnenlicht an, das schräg von der Seite durch die trübe Scheibe des Küchenfensters fällt, auf sie und auf das Tischtuch, auf ihre Arme, die ihren Kopf gehalten haben … Sie ist wahrhaftig am Tisch eingeschlafen, hat sogar geträumt, von dem Jungen aus dem Tal, für den sie Kakao gekocht hat …
Ihr Rücken schmerzt beim Aufrichten, ihre Pupillen flattern, als sie sich zuerst in der Küche umsieht und danach mit einem Anflug von Begreifen ihren Blick auf das Tischtuch senkt. Ganz links liegen die alten schwarzen Dominosteine, mit denen sie früher einmal die Winterabende gefüllt haben, daneben steht der Kakaobecher des Jungen. Und zwischen ihren angewinkelten Ellbogen liegen sie alle, nach Farben sortiert, blau, braun, grün, sogar zwei große Rotbraune …
Der Schock muss ihre Sinne derart verwirrt haben, dass sie einen Aussetzer hatte. Sie hat nicht geträumt! Und bei diesem Brief kann es sich nur um einen äußerst geschmacklosen Scherz handeln. Wer macht ihr schon solch ein großzügiges Geschenk? Dreitausend Mark, zusammengerollt und nur mit einer kurzen Notiz versehen, das Ganze zwischen die Gitterstäbe der Voliere geklemmt, und der einzige Hinweis auf den Absender ist eine ausgetretene Zigarette auf den Pflastersteinen…
Lydia wischt sich über die Wangen, schiebt ihre Brille von der Stirn vor die Augen und betrachtet den kleinen handschriftlichen Begleitzettel:
'3.000DM - rechtmäßiges Geschenk für Lydia Brause.'
Schon beim ersten Lesen, so erinnert sie sich jetzt, gleich nachdem der Junge gegangen war, hat sie im Innenohr beim Betrachten dieser bündigen Mitteilung ein Auflachen vernommen. Es war Gustavs Lachen.
Obwohl diese schwungvollen Buchstaben mit seiner Handschrift nicht die geringste Ähnlichkeit haben. Wie sollten sie auch, Gustav ist seit fast einem Jahr tot und begraben!
Kurz entschlossen klaubt Lydia die glattgestrichenen Geldscheine zusammen, packt sie in einen kleinen Kochtopf mit Deckel und verstaut diesen in der hintersten Ecke ihres Kühlschranks. Sie schiebt den Turm der frisch eingekauften Lebensmittel davor, Butter, Käse, Quark, Wurstaufschnitt, schließt die Kühlschranktür und verlässt fluchtartig die Küche.
Es muss ihre übliche Aura des Aufbruchs sein, die den Hund zielstrebig zur Haustür laufen lässt. „Hast recht, Wotan, ich brauche jetzt unbedingt frische Luft!“
Sie gehen zur Weide, die sich vom Ende des Hofes sanft Richtung Abhang zieht. Den zwei Kühen scheint es gut zu gehen. Die Tiere heben nur kurz die malmenden Mäuler und wenden sich gleich wieder dem Weidegras zu.
„Der hohe Fruchtzuckergehalt nach dem heftigen Regen verändert den Geschmack der Halmspitzen. Wie frisch geerntete Zuckererbsen auf deiner Zunge“, hatte Gustav ihr einmal erklärt. Er besaß das Talent, die belanglosesten Dinge für sie anhand von ausgewählten Worten kostbar werden zu lassen. Und noch jetzt, da seine Stimme lange verstummt ist, kann Lydia sie abrufen wie ein Tonband, das sie stets mit sich trägt, vielmehr noch: Sie kann seinen Stimmfall aufleben lassen, als stünde ihr Mann gleich hinter ihr.
Warum vernimmt sie sein Lachen, jedes Mal, wenn sie die wenigen Wörter auf dem Begleitzettel des Umschlags betrachtet? Es muss einen Grund dafür geben.
„Verlass dich drauf, Gustav, das krieg ich noch raus!“, stößt sie aus, als sie mit Wotan am Hang steht und gegen die hochstehende Mittagssonne die Hügelkette auf der anderen Seite betrachtet. Gleich darauf gleitet ihr Blick hinunter ins Tal.
Was haben die im Ort jetzt wieder mit ihr vor? Wahrscheinlich ist es Falschgeld, mit dem sie auffliegen soll, sobald sie einen Schein ausgibt …
Lydia senkt den Kopf, betrachtet die blinkenden Ösen ihrer Arbeitsschuhe, in denen sich die Sonne spiegelt, und kommt sich vor wie ein Leuchtturm, einsam auf hoher Warte und gut sichtbar für jeden im Tal. Ein abschreckender Leuchtturm mit kreisendem Warnlicht: Bleibt nur weg von hier, ihr wisst ja, wie gefährlich ich bin!
Der Vierklang der Kirchenglocken dringt zu ihr herauf. Um diese frühe Nachmittagsstunde wird eine Beisetzung stattfinden. Wenn sie sich ein paar Schritte weiter vorwagt, wird sie die schwarzen Punkte ausmachen können, die sich am Fuß des Berges Richtung Friedhof bewegen. Da werden sie dann alle versammelt sein, natürlich auch die Gelegenheit nutzen, mit abschätzenden Blicken auf die vernachlässigten Brause-Grabstellen die Hexe vom Berg zum Thema zu machen, und sie selbst wird wie schon manchmal zuvor das Bedürfnis haben, einen Felsbrocken den Abhang hinunterstürzen zu lassen …
„Du meine Güte, Gustav, schau mich doch an. Wie bitter bin ich geworden. So hättest du mich niemals akzeptiert. Aber seit du fort bist, hat sich alles verändert. Das Leben verhöhnt mich. Nichtmal mehr zu einem kleinen unschuldigen Jungen kann ich freundlich sein. Es fühlt sich an, als gäbe es nur noch Feinde, keinen mehr, der es gut meint mit mir. Das alles hättest du verhindern können, dann wärst du jetzt noch bei mir. Aber du mit deinem ewigen Eigensinn und deiner Beweissucht!“
Mit den letzten Worten hat Lydia ihrem Bedürfnis nachgegeben und einen – wenn auch kleinen – Stein von sich fort geschleudert, so heftig, dass der plötzliche Ruck durch ihren Rücken sie aufstöhnen lässt.
„Komm, Wotan, laufen wir ein Stück.“
Sie wendet sich vom Tal ab, betrachtet die sattgrünen Baumspitzen, die in einen tiefblauen Himmel ragen. Und als sie mit ihrem Hund den nahen Wald betritt und die Sonne ihre Strahlen schräg durch die Zweige vor ihr auf den umrankten Weg wirft, hat sie das Gefühl, der einsamste Mensch am schönsten Fleckchen der Erde zu sein.
Seit Lydia denken kann, ist die Natur ihr kostbarster Reichtum gewesen, ein Reichtum, den sie mit dem ihr kostbarsten Menschen teilen konnte, und den sie jetzt nur noch mit einem Hund, einem Vogel, , ein paar Hühnern, zwei Kühen und einem alten Kater teilt …
„Wo treibt sich eigentlich unser alter Marschall rum? Ich hab ihn seit gestern nicht mehr gesehen. - Wir suchen ihn. Such, Wotan, such Marschall! Aber langsam, mein Guter, damit ich mithalten kann.“
Sie braucht eine sinnvolle Aufgabe, und wenn das Ergebnis etwas so Wertvolles wie das Aufstöbern des gebrechlichen Katers wäre, hätte sich dieser völlig konfuse Dienstag ihres Lebens schon gelohnt.
Wotan hat den vermissten Kater wahrhaftig gefunden. Nun liegt das struppige alte Tier wie meistens vor der Haustür auf dem Pflaster, an seinem Lieblingsplatz, mit dem Unterschied, dass es jetzt nicht wie sonst auf den Hinterläufen kauert, sondern auf der Seite liegt. Marschall ist tot. Ob es ein Fuchs war oder ein Bussard, der ihm so übel zugesetzt hat, kann Lydia an den Verletzungen in seinem Genick nicht ausmachen. Er muss noch die Gelegenheit gehabt haben, sich zu wehren, an seinen Krallen klebt Blut. Das zahnlose Mäulchen ist weit geöffnet.
So gern würde Lydia jetzt ihre Gefühle einfach ausschalten, und im tiefsten Inneren weiß sie auch, dass dieser unerwartete Angriff eine Gnade für ihren alten Kater gewesen ist, der schon lange dem Tod näher war als dem Leben.
Dennoch verspürt sie eine Trauer, die man mehr einem Menschen entgegenbringt.
Marschall gehörte zu einer der letzten Hinterlassenschaften aus ihrem Leben mit Gustav.
Wotans Winseln entlockt Lydia ein müdes Lächeln. „Ja, übernimm du die Trauer um deinen alten Freund. Für mich heißt es jetzt: nichts mehr fühlen, nicht mehr denken, erstmal nur handeln. - Marschall muss beerdigt werden.“
Der Tierfriedhof des Brauseanwesens liegt etwas abseits der Weide, am Rande des Waldes, einem Bereich, den kein Fußgänger jemals aufsuchen würde, da ein Stück Stacheldrahtzaun jeden Spaziergänger wie von selbst daran vorbeilenkt. Nicht einmal der Förster weiß, wie viele Knochen und Kadaver dieses Stückchen Erde birgt. Seit jeher wurden hier die Haustiere begraben, ebenso die Nutztiere, die den Bedingungen einer Schlachtung nicht mehr standhielten. Es wurden auch nie Hinweise gesetzt, welches Tier wo begraben liegt, man hatte immer nur einen verbleibenden Stein ein Stück weiter platziert, damit man wusste, wo sich die Reihe fortsetzen durfte.
„Soll nur ja keiner kommen und meckern!“, lautete Gustavs und auch die Meinung seines Vaters. „Wir bezahlen brav unsere Grundsteuern, außerdem werden keine Privatgrundstücke mit den Abwässern dieser Grabstellen belästigt.“
Es ist das erste Mal, dass Lydia hier alleine Hand anlegt. Gebeugt steht sie da, stützt sich auf den Spaten in der Rechten und wischt mit der Linken den Schweiß von ihrer Stirn. „Und jetzt kehren wir sofort um, Wotan. Wir sollten mal was essen. Dir muss doch ohne Ende der Magen knurren.“
Auf dem Rückweg zum Haus schielt sie zum Scheunendach, wirft einen Blick auf die schräg liegende Tanne über dem hinteren Dachteil, das von hier aus nicht einzusehen ist, von dem sie aber bestens weiß, wie es aussieht. Und ohne es zu wollen spürt sie, wie sich ihre Mundwinkel nach oben ziehen, ganz kurz nur, aber nicht ohne ein eigenartig beruhigendes Gefühl in ihr zu hinterlassen, als ihr inneres Auge ihr einen Rückblick auf den Küchentisch vom Mittag gewährt.
Vielleicht scheint da jemand aufrichtig besorgt um sie zu sein?
Wer kann schon wissen, was sich so alles zwischen Himmel und Erde abspielt, zwischen Menschen, die mit dem Band der Liebe verbunden bleiben, wo immer sie sich auch gerade aufhalten …