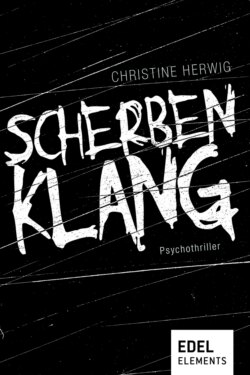Читать книгу Scherbenklang - Christine Herwig - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеRaus. Sie musste hier raus.
Wer weiß, wo er ist? Oder wo sie sind?
Irgendwo hier in diesem riesenhaften Haus, vielleicht im zweiten Stock, vielleicht auf dem Dachboden. Vielleicht auch in der Speisekammer, von der sie gerade nur eine lächerlich dünne Wand trennte. Dann saß sie praktisch in der Falle. Dann bräuchte er nur wenige Schritte, um an seinem Ziel zu sein. Helens Hände grapschten unbeholfen und hektisch nach ihrem Handy auf dem Boden, ließen es zitternd zweimal fallen. Sie kam aus dem Gleichgewicht, kippte nach vorn auf alle viere, wollte sich aufrichten, stolperte, hastete halb kriechend zur Haustür.
Raus! Ich muss hier raus! Ich muss die Polizei rufen!
Jeder andere Gedanke war vergessen.
Du wirst sie nicht wieder sehen. Beide nicht.
Weil ich dich töten werde? Klar. Was denn sonst? Als Helen die Stufen vor dem Haus hinabstürmte, rechnete sie schon damit, von hinten gepackt, festgehalten und zurück ins Haus gezerrt zu werden. Ihre Angst hatte ein Level jenseits sinnvoller Reflexe erreicht. Tunnelblick, kalter, rasender Puls. Jegliche Fähigkeit, zu denken: aus.
Nach Luft ringend wie nach einem Marathonlauf erreichte sie die Straße und drehte sich taumelnd um. Die Reste des Sedativums in ihrem Blutkreislauf schnürten ihr die Atmung ab und lähmten ihren Verstand. Sie brauchte einige Sekunden, bis sie mit klarem Blick feststellen konnte, dass niemand ihr gefolgt war.
Mechanisch und immer noch zitternd drehte sie die rechte Handfläche mit dem Handy nach oben, brauchte drei Anläufe, ehe sie den Bildschirm entsperrt, und zwei weitere, bis sie den Notruf 110 korrekt eingegeben hatte. Dann erst konnte sie atmen.
Minuten später, die Hände an eine wärmende Tasse Kaffee gepresst, kam sie wieder vollends zur Besinnung. Der Kontrollverlust über Sinne und Muskeln hatte nachgelassen, ihr Körper zitterten nur noch leicht. Zwar konnte sie sich nicht erinnern, was genau sie dem Beamten am anderen Ende der Leitung gesagt hatte, aber es musste ausgereicht haben. Abschließend hatte er sie aufgefordert, bei einem Nachbarn – falls vorhanden – zu klingeln und dort auf das Eintreffen eines Streifenwagens zu warten.
Nun stand sie bei den Reinkes in der altmodischen, aber gemütlichen Küche und war unsagbar froh, andere Menschen um sich zu wissen, die ihr nichts Böses wollten. Auch wenn sie über neunzig waren. Auch wenn ihre klapprige Eingangstür vermutlich nicht einmal einen wütenden Dreijährigen dauerhaft hätte aussperren können. Aus einem irrationalen Grund heraus fühlte Helen sich hier sicher.
»Möchten Sie vielleicht ein Brötchen, Fräulein?« Irmgard Reinke tauchte rechts neben Helen auf, einen Korb mit frischen Brötchen in den dünnen, alten Händchen. Ihr Blick war mitleidig, in den tieferen Zügen allerdings ebenso angstvoll wie der ihres Gegenübers. Aus Pflichtgefühl und Anteilnahme hatte sie selbstverständlich nicht abgelehnt, als Helen um Einlass gebeten hatte, doch ein Einbruch in ihrer stets friedlichen Nachbarschaft war nichts, was die betagte Dame in ihrem Alter noch gebrauchen konnte.
Im Gegensatz zu mir wäre sie niemals imstande, vor einem Eindringling zu fliehen, schoss es Helen durch den Kopf.
»Vielen Dank, aber ich glaube, ich kann jetzt nichts essen«, antwortete sie hastig, um die negativen Gedanken hinwegzuwischen. Das Lächeln, an dem sie sich danach versuchte, ging schief.
Die alte Dame nickte mitfühlend und zog sich mit langsamen, wackligen Schritten an den Küchentisch zurück. Klischeehaft mit einer vergilbten Plastiktischdecke überzogen wartete er bereits auf die morgendliche Routine des Paares. Abgezählte Käse- und Wurstscheiben, Kaffee in abgenutzten, aber lieb gewonnenen Tassen. Butter unter einer altertümlichen Haube. Die Tageszeitung am Tischrand. Einige Fliegen, die der Klebefalle an der Decke noch nicht erlegen waren, hockten in der kleinen Marmeladenschale und an der Zuckerdose.
Was für eine heile Welt. Hier drüben, nur zwanzig Meter entfernt. Auf der anderen Seite der Straße.
Kaffeeduft und Deutschlandfunk. Während die Tür der Nummer zweiundzwanzig in einem Schrei erstarrt offen stand; und die drückende Leere dahinter auf die Straße zu fließen drohte.
Helen hob die Tasse an ihre Lippen. Atmete mehr hinein, als dass sie wirklich vorhatte, den etwas verwässerten Kaffee zu trinken.
Was war in den letzten Stunden nur passiert? War wirklich ein psychopathisch veranlagter Einbrecher in dieses schäbig aussehende Haus eingedrungen, hatte ihr kryptische Nachrichten auf einem alten Telefon und im Erinnerungsspeicher ihres Handys hinterlassen und sich über Stunden im Haus versteckt gehalten? Während sie, in einer Lache aus Blut erwacht, ein Kind in ihrem Bauch verloren hatte, das laut einem übermüdeten Allgemeinmediziner nie existiert hatte? Nicht existieren konnte, weil sie angeblich unfruchtbar war? Wie unfassbar – wie absurd!
Es kam ihr vor, als wüsste der Fremde, dass die Welt sie vor Stunden allein gelassen hatte. Dass er kommen und gehen konnte, wie es ihm beliebte, und alles, was er vorfinden würde, war eine überspannte, nervlich labile Frau Ende zwanzig, die …
Mein Gott! Nein! Das kann nicht sein!
Die Tasse schlug in ihrem freien Fall an der Fensterbank an, verlor dabei einen Großteil ihres Inhaltes und zerbarst auf dem gekachelten Fußboden keine Sekunde später in drei große Stücke. Irmgard Reinke stieß erschrocken die Luft aus.. Und Helen starrte aus dem Fenster. Regungslos, bis auf das krampfartige Zittern, das ihren Körper plötzlich zurückerobert hatte.
*
Du wirst sie nie wiedersehen. Beide nicht.
Helen hatte die Nachricht in ihrer Panik ursprünglich auf sich bezogen. Hatte angenommen, es wäre ein Hinweis darauf, dass der Eindringling sie mit sich nehmen, verschwinden lassen oder einfach nur töten wollte. Dass Flucht zwecklos sein und sie darum niemanden mehr wiedersehen würde.
Doch was, wenn er wirklich gewusst hatte, dass sie allein sein würde? Weil es in der Nachricht nicht um sie ging. Sondern um Nadja und Jan! Was, wenn er die beiden in seiner Gewalt hatte? Oder sie, um Himmels Willen, vielleicht schon tot waren?
Helens Fantasie wirbelte herum, wirkte wie ein Strudel, der sie gegen sämtliche äußeren Reize abschirmte. Die Angst bildete Wortfetzen und Farben in ihrem Kopf; Schuld. Leblos. Tod. Isolation. Hilflos. Gelähmt. Schreie in dunklem Rot, Lila und Schwarz.
Die genau acht Minuten, die seit ihrem Anruf bei der Polizei bis zum Eintreffen des Streifenwagens vor dem Haus Nummer zweiundzwanzig vergingen, waren wohl die längsten in Helens Leben. Sie war gefangen im Warten auf ihre einzige Hoffnung, auf Hilfe, und hatte dennoch entsetzliche Angst.
Angst, die ganze Geschichte erzählen zu müssen.
Angst, zu erfahren, dass es vielleicht bereits etwas über Jan zu berichten gab.
Angst, dass sie nach ihm suchen und ihn finden würden – tot.
Angst, wieder in das Haus zurückkehren zu müssen.
Angst, dass ihr eigenes Leben sie überholt hatte. Und sie jetzt einsam zum Sterben zurückließ.
Als schließlich ein blau-silbernes Auto draußen vor den Fenstern auftauchte, fühlte sich Helen außerstande, ihm auch nur einen Schritt entgegenzugehen. Sich nur einen Zentimeter wegzubewegen aus der klapprigen Küche der Sicherheit. Also wartete sie. Bis die Beamten geklingelt hatten. Irmgart Reinke die Tür geöffnet hatte. Und der ältere der beiden Männer sie ansprach.
Dann brachen alle Gedanken aus ihr heraus.