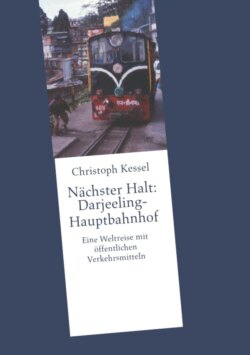Читать книгу Nächster Halt: Darjeeling-Hauptbahnhof - Christoph Kessel - Страница 12
Der »Dog« und seine Tücken
ОглавлениеEtappe: Von Bar Harbour ME, USA 44° Nord 68° West (GMT -4) nach St. Louis MO, USA 39° Nord 90° West (GMT -5): 2.573 km – Total 16.843 km
St. Louis, 10. Oktober 2002
Mit der Ankunft in meinem ersten US-Bundesstaat auf dieser Reise, dem kleinen Maine, befand ich mich weiterhin auf der Spur der Wikinger, die vor 1.000 Jahren etwa bis zum heutigen New Jersey vorgedrungen waren. Maine gehört zu den sechs Bundesstaaten, die die so genannten »Neu-England-Staaten« bilden. Grob genommen ist dies der äußerste Nordosten der USA. Maines Spitzname lautet »Pine Tree State«, wegen der vielen Pinien, die es einmal gegeben hatte – nun leider aber nicht mehr allzu häufig gab. In Maine fing nun meine Reise quer durch das Land von Küste zu Küste mit einer urtypischen amerikanischen Institution an, die alle kennen, aber wahrscheinlich noch niemand aus der Leserschaft genutzt hat: den Greyhound. Die wenigen Leute, die ich traf und die mit diesen Überlandbussen unterwegs gewesen waren, hatten nur Horrorgeschichten auf Lager. So war ich gespannt, was ich alles zu erzählen hätte. Leider verlief meine erste Fahrt von Bar Harbour nach Boston ebenfalls nicht gerade allzu angenehm.
Zunächst durfte ich morgens um halb fünf im Platzregen aufstehen und mein Zelt zusammenpacken. Der einzige Bus von Bar Harbour nach Boston musste unbedingt morgens um halb sieben abfahren. Glücklicherweise nahm ich den Luxus eines Taxis in Anspruch, um nicht im Dauerregen zur Busstation zu gelangen, ansonsten wäre ich wahrscheinlich total aufgeweicht worden. Da ich in den USA permanent Gefahr lief, wegen Vitaminmangels an Skorbut zu erkranken, da es im preiswerten Nahrungsmittelsektor meist nur Chips und Cola zum Essen und Trinken gab, stopfte ich mich im Bus mit Pflaumen und Birnen aus einem Vegetarier-Laden voll. Daraufhin bekam ich im Bus allergrößte Magenkrämpfe. Neben mir saß dazu noch ein Mitsechziger, der statt die amerikanische Fahne zu schwenken, eher mit seiner starken Alkoholfahne auf sich aufmerksam machte. Zudem nickte er leider gleich nach Fahrtantritt ein und begann ein DauerSchnarch-Konzert. Nach sieben Stunden Fahrt war ich endlich in Boston, Massachusetts, angekommen. Der Staat trägt zu Recht den Spitznamen »Spirit of America«.
Boston gilt als Geburtsstätte der Vereinigten Staaten. In der Stadt startete die amerikanische Revolution und dort entsprang auch der für die USA so typische Patriotismus. Vor der Revolution gab es die amerikanische Nation überhaupt noch nicht. Vielmehr waren mehrere Staaten aus der »Alten Welt« damit beschäftigt, sich diesen Kontinent untereinander aufzuteilen und schließlich später gegenseitig abzuringen. Die Spanier unter Christoph Kolumbus waren seit 1492 auf dem heutigen Gebiet der USA vor allem im Westen und Süden aktiv. Die Franzosen unter Cartier bauten hingegen Forts von Québec in Kanada den Mississippi hinunter bis nach Nouvelle Orléans, dem heutigen New Orleans. Die Engländer hingegen bauten unter Cabot an der Ostküste jeweils eigenständige Kolonien auf. Diese bildeten die Basis der heutigen Oststaaten. Sogar die Holländer im heutigen New York, damals »Nieuw Amsterdam« genannt, und die Schweden auf der Delaware-Halbinsel mischten im großen Spiel mit. Ganz im Westen traf man bis zum 17. Jh. an der Küste nördlich vom heutigen San Francisco sogar auf russische Stützpunkte, die von Pelzhändlern aufgebaut worden waren. Doch die dominierende Macht wurde mit der Zeit England. Nieuw Amsterdam wurde von den Holländern gegen Surinam eingetauscht, die Schweden gingen mehr oder weniger freiwillig. Die Franzosen wurden im 7-jährigen Krieg um 1760 besiegt. 1763 verlor Frankreich nicht nur Kanada, sondern auch das gesamte Territorium auf heutigem US-Boden mit der Ausnahme von New Orleans und Lousiana.
Auslöser für die amerikanische Revolution war eine große Steuererhöhung durch das Empire in den Kolonien an der Ostküste. 1773 fingen die Kolonien an, britische Güter zu boykottieren und kippten riesige Teeladungen in den Hafen von Boston. Dieses Ereignis ging als so genannte »Boston Tea Party« in die Geschichtsbücher ein. Daraufhin wurde der Bostoner Hafen von den Briten geschlossen. 1775 startete schließlich in Boston die Revolution unter ihrem Führer George Washington, als britische Truppen von Revolutionsgarden beschossen wurden. Mitten im Krieg am 4. Juli 1776 erklärten 13 britische Kolonien, die heutigen Bundesstaaten entsprechen, ihre Unabhängigkeit vom Empire in Philadelphia. Der Krieg wurde durch das Eingreifen der Franzosen ab 1778 auf der Seite der neuen amerikanischen Nation gegen die Briten drei Jahre später im Jahre 1781 entschieden. 1783 wurde die amerikanische Unabhängigkeit im Vertrag von Paris allgemein anerkannt. Die Westgrenze bildete der Mississippi. Spanien hielt weiterhin Florida und das Land westlich vom Mississippi. Die neu entstandenen Vereinigten Staaten von Amerika bestanden damals lediglich aus ehemaligen britischen Kolonien östlich des Appalachen-Gebirges. Das Gebiet westlich der Appalachen zum Mississippi hin war lediglich US-Territorium. Es entstand dort damals noch kein Bundesstaat.
Als erstes gab ich in Boston den Reiseführer über Kanada wieder brav ab. Der Reiz an Boston bestand für mich an dem starken Kontrast zwischen alten Häusern und Friedhöfen, die direkt neben riesigen Wolkenkratzern etwas deplatziert wirkten. Ansonsten genoss ich es einfach, in den vielen kleinen Straßen spazierenzugehen und das Leben auf der Straße zu beobachten. Morgens um halb acht scheinen alle Bostonians wie ferngesteuert ihrem Pappbecher Kaffee zu folgen, den sie vor sich wie einen Joystick halten. Wie von Geisterhand gesteuert, schwirren die Menschen durch die Straßen und schaffen es doch tatsächlich, sich den Kaffee nicht gegenseitig überzukippen. In Boston traf ich zum ersten Mal auf die traumatischen, patriotischen Reaktionen, die 09/11 folgten. Überall wehte das Sternenbanner, und häufig fand ich Sprüche wie »We’ll never forget«{45} oder »Together we stand«{46}. Dass das Sternenbanner aber auch den grünen Hahn von der Corn-Flakes-Packung vertrieben hatte, finde ich etwas übertrieben.
Da ich mich in Großstädten nicht allzu lange aufhalten mochte, wollte ich mit dem Greyhound wieder hinaus ins Hinterland der Neu-Englandstaaten fahren, genauer gesagt nach Vermont. Doch Reisen mit dem Greyhound-Bus bringt immer wieder neue Abenteuer mit sich, die die Tour abwechslungsreich gestalteten. Da die Amerikaner das »Queueing« von den Engländern übernommen hatten, standen vor jedem Bus die Passagiere geduldig schon eine halbe Stunde vor der Abfahrt an. Ich dachte, ich besitze ein Ticket und telefoniere lieber nochmals mit meinen Eltern in Deutschland. Das war leider ein Fehler. Ich reihte mich schließlich als letzter in die Schlange ein, aber als ich in den Bus stieg, waren alle Plätze bereits belegt. Außer mir fand noch eine weitere Person keinen Sitzplatz mehr. Der Fahrer wollte uns erst auf dem Gang mitnehmen, sagte schließlich aber, dass ein zusätzlicher Bus zehn Minuten später abführe. Das glaubte ich allerdings nicht und wollte an Bord bleiben. Aber der Busfahrer warf mich mehr oder weniger aus dem Bus hinaus. So regelte man das bei Greyhound mit überbuchten Bussen. Schnell konnte ich noch meinen Rucksack aus dem Gepäckraum des Busses herausholen. Dafür bekam ich allerdings einen Anschiss vom Fahrer, denn dies wollte er auch nicht. Aber ich bleibe doch lieber gemeinsam mit meinem Rucksack stehen, ansonsten würde ich ihn eventuell nie wiedersehen.
Die andere Person, Andria, eine Italo-Amerikanerin, war für mich anfangs typisch amerikanisch: naiv und höflich. Sie machte Platz für eine andere Person, die irgendwo einen Anschluss-Bus erreichen wollte. Dabei musste Andria einen Transatlantik-Flug abends in Montreal erreichen. Dumm gelaufen, da natürlich kein Bus kam. Dank Andrias italienischem Temperament konnte ich mir die »Jetzt-flippe-ich-total-aus-Show« sparen. Diese spulte Andria für uns beide ab, während ich auf unser Gepäck aufpasste. Was hatte ich auch zu meckern? Ob ich nun in Burlington, Vermont, abends um sieben oder um elf ankam war mir letztendlich egal. Die Hauptsache bestand im Ankommen. Andrias Lage war weitaus dramatischer. Der nächste Bus fuhr dreieinhalb Stunden später ab. Andria bekam ein Gratis-Ticket, verpasste aber dafür definitiv ihren Flug nach Europa. Ich durfte auch ein Beschwerdeschreiben unterzeichnen, auf das sich aber nie wieder jemand bei mir gemeldet hat. Manche Mitarbeiter von Greyhound waren allerdings wirklich hilfsbereit, muss ich zu ihrer Rettung gestehen. Ein Busfahrer, der das ganze Theater verfolgt hatte, meinte, er würde bereits eine Stunde früher als der andere Bus nach White River Junction fahren. Wo lag eigentlich White River Junction? Nun gut, hinein in den Bus. Wir hofften einfach, einen Anschluss in White River in Richtung Vermont und Montreal zu bekommen.
Nun verließ ich für längere Zeit die Küste des Atlantischen Ozeans, der ich seit St. Malo in der Bretagne zwei Monate zuvor mehr oder weniger immer wieder gefolgt war. Auf die Idee an diesem Freitag Nachmittag wieder einmal raus aufs Land zu fahren kam halb Boston. Wir standen zunächst zwei Stunden im Stau. Danach klapperte unser Bus alle Dörfer des US-Bundesstaates New Hampshire ab. Ich fand New Hampshire grauenvoll. Es regnete aus Kübeln, wir standen im Stau und wir wussten nun noch nicht einmal mehr, ob wir den Anschluss nach Burlington und Montreal bekommen würden, da der spätere Bus direkt ohne Zwischenstopps in den Käffern New Hampshires abfuhr. White River Junction bestand aus vier Tankstellen und einem McDonald’s. Dort hatte ich wirklich keine Lust, die Nacht zu verbringen, doch welch ein Wunder, es wartete tatsächlich ein Bus nach Montreal via Burlington in diesem gottverlassenen Kaff.
Während der Busfahrt konnte ich mich mit Andria gut über ihr Land und ihre Landsleute unterhalten. Sie erzählte mir, dass im Fernsehen permanent erzählt würde, dass die ganze Welt Amerikaner hasste. Als ich ihr klarmachte, dass die Kritik sich gegen George W. Bushs Politik und nicht gegen das Volk richtete, war sie ziemlich überrascht. Nun kann ich diesen Patriotismus nachvollziehen, den die Leute an den Tag legten. Wenn man die ganze Zeit erzählt bekommt, dass dich jeder hasst, schweißt das ganz sicher zusammen. Von Manipulation der Massen zu reden, ist in diesem Kontext sicherlich nicht falsch. Ich wurde auch von Amerikanern angesprochen, ob ich Bundeskanzler Schröder gut fände. Als ich sagte, dass ich ihn dem Unionskanidaten Stoiber vorziehen würde, lehnten sie ab, weiter mit mir über Politik zu reden.
Auf der Fahrt von White River Junction nach Burlington lernte ich Byron kennen, der auch in diese Studentenstadt unterwegs war. In Burlington angekommen, rief er seine Kumpels an, die mich direkt auf den Campingplatz der Stadt fuhren. Denn eine dritte Nachtwanderung innerhalb weniger Tage wäre mir wirklich zu viel gewesen. Dafür wurde ich nachts in meinem Zelt »überfallen«. Meine Lebensmittel hatte ich dummerweise ins Vorzelt gelegt. Daraufhin kamen Eichhörnchen und versuchten mein Müsli zu klauen. Aber ich verteidigte erfolgreich mein Essen gegen diese »Terroristen«.
Burlington war eine eher untypische amerikanische Kleinstadt in einem eher untypischen US-Bundesstaat. Vermont ist vielleicht der liberalste Staat der ganzen USA. Schließlich gibt er gleichgeschlechtlichen Partnerschaften die gleichen Rechte wie Partnerschaften zwischen Mann und Frau. Für einige US-Bundesstaaten wäre dies der glatte Wahnsinn. Der Spitzname »Green Mountain State« und die durchweg grünen Nummernschilder lassen schon auf eine gewisse Wertschätzung der Natur schließen. Als ich in Burlington sah, wie umweltbewusst die Leute sind, war ich tief beeindruckt. Mülltrennung, eine Recyclingfirma, dutzende Meilen von Fahrradwegen, Fußgängerzonen und drakonische Strafen für Leute, die ihren Müll nicht korrekt entsorgen – wahlweise 500 US-Dollar oder zehn Tage Gefängnis. Vermont ist zu Recht stolz auf seinen selbstgewählten Sonderstatus, und man legt Wert darauf, dass der Besucher weiß, dass Vermont sogar von 1777 bis 1791 ein souveränes Land war, ehe man sich den Vereinigten Staaten anschloss.
Alle zwei Jahre finden in den USA Wahlen für den Gouverneur, den Senat und das Repräsentantenhaus statt. So auch in diesem Jahr. Dabei sah der Straßenwahlkampf etwas anders aus als bei uns. Statt Wahlplakaten fand ich in den Städten und Dörfern im Vorgarten der Leute kleine Schilder mit dem Namen der Kandidaten darauf. Parteien und teilweise Nachnamen oder gar Wahlslogans fand ich überhaupt nicht. So wollte in Vermont beispielsweise Bernie – Nachname unbekannt – wiedergewählt werden. Gegenkandidat Jim Douglas gibt wenigstens noch eine Webseite an, seine Parteizugehörigkeit hingegen bleibt im Dunkeln. Dies ist der personalisierte Wahlkampf in Rein-Form, wie wir ihn zwischen Stoiber und Schröder auch gerade hatten. Dass lediglich wir Deutschen die »Kultur« der Amerikaner übernehmen ist falsch, da umgekehrt das selbe gilt. Hier gibt es doch tatsächlich Aldi. Viele Leute laufen mit den orange-blauen Aldi-Tüten durch die Gegend, sodass ich mich fast wie zu Hause fühlte. Auch Fußball wird langsam wirklich populär. Und das Oktoberfest mit Sauerkraut, Wurst und viel dünnem Bier ist Kult.
Nachdem ich in Burlington einen ganzen Tag lang mit einem ausgezeichneten Rad auf herrlichen Radwegen die langsam in Herbststimmung getauchte Landschaft entdecken durfte, ging es nun wieder mit dem »Dog«,{47} wie die Amerikaner sagen, auf Achse. Vor mir lag eine 25-Stunden-Fahrt durch vier Bundesstaaten nach Chicago, Illinois.
Der »Milk Run«{48} führte zunächst durch zahlreiche Dörfer aus Vermont hinaus in die Hauptstadt des Bundesstaates New York nach Albany. Dass sich in Amerika die Hauptstädte der Staaten meist in gottverlassenen Dörfern befinden, werde ich wahrscheinlich nie verstehen.{49} New York bezeichnet sich dazu noch als »Empire State«. Wie müsste sich dann Rheinland-Pfalz mit seiner Landeshauptstadt Mainz und seinen 185.000 Einwohnern nennen? Für die 200 Kilometer brauchte der Bus glatte fünf Stunden. Für den nächsten Bus stellte ich mich rechtzeitig an, und dieses Mal waren zwei andere Personen die Dummen, die nun auf den zehn Minuten später sicherlich nicht abfahrenden Bus warten durften. Von Albany fuhr ich durch »Klein Holland« an Dörfern wie Amsterdam oder Rotterdam Junction und an gelbrot gefärbten Wäldern vorbei, dem Sonnenuntergang entgegen. Irgendwann machten wir endlich einen Stopp in Rochester, New York, um etwas zu essen zu bekommen. Beim einzigen so genannten »Restaurant« handelte es sich um eine Subway Filiale, die normalerweise Sandwiches herstellt. Leider war aber gerade das Brot ausgegangen. Prima, wie sollte ich nun einen Sandwich ohne Brot essen? Da half nur noch die »wunderbare« Automatenkost, die aus Cola und Nacho-Chips bestand.
Nachts erreichten wir Buffalo, New York. In mir keimte wieder Hoffnung auf, etwas zu essen zu bekommen. Doch natürlich waren alle Restaurants um diese Zeit geschlossen. Aus einem Loch in der Wand verkaufte jemand noch Cheeseburger à la Mikrowelle. Damit wenigstens etwas zu schmecken war, wurde der Plastik-Burger dermaßen mit Ketchup und Senf vollgeladen, dass meine Hose auch noch reichlich mitessen durfte. Jetzt war ich am erwarteten kulinarischen Supergau angelangt. Erst um drei Uhr morgens, bei der Ankunft in Cleveland, Ohio, bekam ich schließlich einen Kaffee, der allerdings auch sehr künstlich schmeckte, dem Süßstoff und dem Milchpulver sei Dank. Ohio bezeichnet sich selbst als »Buckeye State«.{50} Im Morgengrauen erreichten wir den nächsten Staat, Indiana und endlich ein Wendy’s, in dem es halbwegs essbares Futter gab. Indiana hat zwei Spitznamen. Der eine lautet »Crossroads of America«, was natürlich stimmt. Schließlich kommt man auf dem Weg von Nord nach Süd, oder von Ost nach West fast unweigerlich durch diesen zentral gelegenen Bundesstaat. Der andere Spitzname lautet »Hoosier State« und stammt aus der Zeit der ersten Siedler im 19. Jh. Immer wenn es an der Tür klopfte, wurde von innen gefragt: »Who is here?«, so entstand schließlich das Wort »Hoosier«.
Nach 25 Stunden Fahrt und 1.600 strapaziösen Kilometern erreichte ich den Zielstaat Illinois mit seiner Metropole Chicago. Illinois Spitzname ist banal und lautet »Land of Lincoln«. Da ich von der Busfahrt ziemlich kaputt war, lief ich in Chicago, um mich wieder einmal richtig locker zu machen, ein bisschen ziellos durch die Kulisse der Wolkenkratzer und Parks direkt am Lake Michigan.
Beim Flanieren durch Chicagos Straßen stand ich plötzlich vor dem Hancook-Hochhaus, mit seinen 95 Stockwerken nicht ganz so hoch wie der berühmte Sears Tower, der höher als das frühere World Trade Center ist. Eigentlich kostete es sieben US-Dollar, um mit dem Aufzug nach oben zu gelangen. Doch irgendwie landete ich in einer Gruppe von elegant gekleideten Herrschaften und plötzlich befand ich mich im Aufzug nach oben. Dort landeten wir in einem Nobelrestaurant, und ich rechnete jeden Augenblick damit, sofort wieder hinausgeworfen zu werden. Stattdessen wurde mir ein Platz am Fenster mit Aussicht auf die imposante Skyline der Stadt angeboten, auf die ich beim Sonnenuntergang mit einem Guiness vom Fass anstoßen konnte. Am nächsten Tag bekam ich von einem Chicagoer einen Tipp, einmal in die »German Neighbourhood« zu fahren, um ein bisschen »deutsche Luft« zu schnappen. Mit dem »El«, einer Bahn, die auf Stelzen überirdisch verläuft, fuhr ich hinaus aus der Innenstadt. Weit außerhalb von Downtown lag »Little Germany«, das durch und durch mit Kneipen bestückt war, die »Carolas Hansa Clipper« oder »Brauhaus« hießen. Bei »Meyers Delikatessen« gab es nicht nur Wurst und Brot, sondern auch die »Eintracht«, eine Zeitung in Deutsch von Deutschamerikanern für Deutschamerikaner. Es war interessant, sich mit amerikanischen Staatsbürgern auf Deutsch bei einem Weizen vom Fass zu unterhalten.