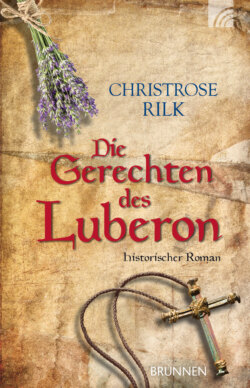Читать книгу Die Gerechten des Luberon - Christrose Rilk - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Opfer
ОглавлениеLieber Bruder …“ Pierre Filhol, der Erzbischof von Aix, ging mit ausgestreckten Händen Jerôme Ghinucci, dem Bischof von Cavaillon entgegen. „Wie gut, dass Sie gekommen sind. Setzen Sie sich zu mir.“
Ghinucci beugte das Knie. „Eminenz“, sagte er mit rauer Stimme. Der Erzbischof hielt ihm mit flüchtiger Gebärde die Hand hin, und Jerôme Ghinucci berührte den Ring leicht mit den Lippen. „Dominus tecum“, murmelte er.
„Der Herr sei auch mit dir, lieber Bruder. Aber nun setzen Sie sich doch. Ich habe nicht viel Zeit, müssen Sie wissen.“ Der Erzbischof musterte seinen Untergebenen mit wachem Blick. „Übrigens hatte auch ich eine Unterredung mit Ihnen ins Auge gefasst. Nun jedoch sind Sie mir zuvorgekommen. Da ich ohnehin nächste Woche etwas Wichtiges, auch bezüglich Ihrer Reise nach Rom, mit Ihnen besprechen muss, denke ich, können wir unser colloquium heute etwas kürzer gestalten, da Sie ja doch … Nun also, was gibt es?“
Ghinuccis Blick war auf eine fein gearbeitete, zierliche Figur aus Jade geheftet, die auf dem Besuchertischchen stand. Es war ein kleiner grüner Drache.
„China“, bemerkte der Erzbischof. „Auch die Heiden fertigen oftmals Dinge, die das Auge eines Kunstliebhabers erfreuen können, obgleich … Aber über fernöstliche Kultur wollen wir ja nicht reden.“
Jerôme Ghinucci fuhr mit der Hand langsam über den schimmernden kleinen Drachenleib. Der glatte, kühle Stein war merkwürdig verwandt seinen kalten Fingern.
Er zog die Hand zurück. „Eminenz, ich bin gekommen, um Ihnen Einblick zu geben in einen Konflikt des Gewissens, der mir die Ausübung meines Bischofsamtes erschwert.“
Der Erzbischof seufzte. „Doch nicht etwa Frauengeschichten?“
Der Bischof von Cavaillon hob abwehrend die Hände. „Nein, nein, es ist ernster, Eminenz.“ Er hielt inne, um dann bedächtig Wort für Wort zu sprechen. „In der letzten Bischofskonferenz …“
„Ach so.“ Ein Ausdruck von misstrauischer Wachsamkeit trat auf die Züge des Erzbischofs, und er sah seinem Gegenüber schweigend ins Gesicht. Dem geschärften Blick entging nicht der gequälte Zug um den Mund des anderen, und er registrierte auch Jerôme Ghinuccis innere Unruhe, die durch die routinierte äußere Gelassenheit durchschien wie ein flackerndes Licht durch einen glatt gezogenen Vorhang.
Jerôme Ghinucci begann: „Es ist so …“
Der Erzbischof hob die Hand. „Warten Sie!“ Er nahm die Messingglocke vom Tischchen und läutete. Ein Mönch trat geräuschlos ins Zimmer.
„Ich möchte in der nächsten Stunde keinesfalls gestört werden. Die Audienz wird verschoben. Schick die Gesandten weg, sie sollen heute am Nachmittag wiederkommen.“
„Aber …“
„Kein Aber, Bruder Matteo.“ Der Mönch zog sich zurück.
„Beginnen Sie!“ Der Erzbischof rückte seinen Sessel in den Schatten eines Mauervorsprungs. „Ich höre. Ich bin sehr interessiert daran, eine Erläuterung zu bekommen über Ihre vielleicht etwas befremdlichen Äußerungen in der letzten Bischofskonferenz, die mir – wie Sie sich denken können – sogleich zu Gehör gebracht worden sind.“
Bischof Ghinucci lächelte bitter. „Das war zu erwarten, Eminenz. Die neuerlichen Strömungen in unserer heiligen Kirche machen mir Sorge. Ich registriere eine erhöhte Bereitschaft zu Polarisierung und vorschneller Ausgrenzung. Theologische Fragen werden in der Bischofskonferenz vernachlässigt zugunsten machtpolitischer Erwägungen. Es gibt eine Gruppe unter den Bischofbrüdern, die immer unverhohlener auf eine gewaltsame Lösung der Frage um die Einheit der Kirche drängt.“
Der Erzbischof runzelte die Stirn. „Sprechen wir doch klar: Diese – wie Sie zu nennen belieben – Frage nach der Einheit der Kirche ist die Ketzerfrage in der Provence, die wir sicherlich zu lösen haben.“
Jerôme Ghinucci senkte den Kopf. „Man muss die Abgrenzung des rechten Glaubens vom Irrglauben sehr vorsichtig und bedachtsam vornehmen. Die Universität von Paris prüft zurzeit gewisse Inhalte, die auf die Lehre dieses Valdes zurükkgehen, der übrigens sehr viel Gedankengut mit dem heiligen Franziskus von Assisi gemeinsam hat …“
„Möglich. Jedoch hat die waldensische Lehre seit Valdes im Lauf der drei Jahrhunderte sich weiterentwickelt und durchaus politisch gefährliche Züge angenommen. Die wilden, unkontrollierten Auswüchse sind das Gift, das die heilige allgemeine Kirche geschwächt hat und den Halt des Staates an der Kirche gestört, wenn nicht untergraben hat. Sehen Sie doch auf die deutschen Gebiete. Die Kirche hat dort immense Verluste an Macht und Einfluss hinnehmen müssen. Sagen wir es offen, Jerôme: Dieser Individualismus von ungebildeten Laien hat etwas ungeheuer Revolutionäres an sich. Können Sie diese Sorge Ihrer Amtsbrüder nicht nachvollziehen?“
Bischof Ghinucci nickte schwer. „Doch, Eminenz. Man muss mit diesen Irrgläubigen reden. Einiges an der Ausformung unserer Lehre bemängeln sie nicht ganz zu Unrecht. Ecclesia semper reformanda – die Kirche muss sich ständig erneuern, und falls es an der Zeit sein sollte, neue Impulse aufzunehmen, sollten wir hellhörig sein.“
Der Erzbischof warf ihm einen schnellen, scharfen Blick zu. „Hellhörig, mein Lieber? In welcher Hinsicht?“
„Wir sollten ihnen zuhören, warum sie glauben, sich absondern zu müssen. Was sind die Gründe für eine mögliche Abspaltung? Und diese Gründe haben wir zu prüfen, Eminenz, genau zu prüfen.“
„Mit Ihrer Meinung stehen Sie sicherlich nicht allein“, sagte der Erzbischof leichthin und sah ihn mit lauerndem Ausdruck an. „Haben Sie denn Leute, die Sie unterstützen?“
Der Bischof bejahte. „In der letzten Kapitelversammlung im Kloster Sénanque hat sich eine große Zahl der Mönche gegen die Methoden der Inquisition ausgesprochen.“
Pierre Filhol, der Erzbischof von Aix, sah eine Weile vor sich hin. Sénanque, ausgerechnet Sénanque. Er horchte dem schweren dunklen Glockenschlag nach, der von der Erlöserkathedrale herüberklang. Elf Schläge. Elf Jünger und ein Abtrünniger. Die eine heilige, allgemeine Kirche, deren Diener ich bin, immer sein wollte, und eine Schar von Abtrünnigen. Er musste ein verhasstes Gefühl von Hilflosigkeit niederringen.
Widerwillig sagte er: „Extra ecclesiam nulla salus – außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Diesen Grundsatz können Sie doch nicht außer Acht lassen, Jerôme. Die Tatsache, dass diese Menschen von der heiligen Kirche abfallen, ist Grund genug, die Führer der Irrgläubigen als Seelenverderber anzusehen. Müssen wir nicht die Glieder unserer Kirche schützen vor ihnen, notfalls mit Gewalt?“
„Eminenz, das bestreite ich niemals. Aber in der alten Kirche galt auch dies als unumstößlich: ecclesia non sitit sanguinem – die Kirche dürstet nicht nach Blut. Ist sie doch selbst aufgebaut auf dem Boden, den unsere Märtyrer mit ihrem Blut getränkt haben. Die Inquisition verlässt darin unsere geheiligte Tradition.“
Der Erzbischof hob die Stimme. „Dazu kann ich nur sagen: Der Heilige Vater steht in der Anwendung der Inquisition in der päpstlichen Tradition seit Papst Gregor IX., mehr als dreihundert Jahre lang. Der Kampf gegen das Ketzertum ist ein heiliger Krieg.“
Jerôme Ghinucci beugte sich vor. Er fühlte das dumpfe, schwere Pochen seines Herzens, als er sagte: „Eminenz, der Schrecken der Inquisition liegt in der Art ihrer Anwendung. Ankläger und Richter sind identisch, das Verfahren ist geheim, als Beweisverfahren wird die Folter angewandt, die Papst Nikolaus I. als gegen Gottes Gebot verboten hatte, der Ausgang des Prozesses steht immer schon fest …“
Der Erzbischof klopfte mit den Fingerknöcheln auf die Tischplatte. „Nicht doch, Bischof Ghinucci. Das sind Unterstellungen. Gut, es gibt unqualifizierte Inquisitoren. Wie Sie wissen, habe ich selbst mich ausgesprochen für die Ablösung des Inquisitors Jean de Roma vor fünf Jahren, der – wenn ich so sagen darf – weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Heute jedoch gehören diese Exzesse der Vergangenheit an, Gott sei gelobt. Der derzeitige Prozess gegen den Waldenserketzer Bérard zum Beispiel verläuft, wie ich höre, nach allen Regeln und äußerst korrekt in der Behandlung des Beschuldigten.“
Der Erzbischof von Aix lehnte sich zurück und sah aus schmalen Augen auf Jerôme Ghinucci, den Bischof von Cavaillon, dessen bleiche Züge nun deutlich den Ausdruck innerer Qual spiegelten.
„Ich hatte eine Unterredung mit dem Angeklagten.“ Ghinuccis Stimme war rau geworden, wie sprödes, zerbrechliches Material.
Der Erzbischof fuhr auf. „Was, Sie haben …“ Er brach ab.
„Ich hielt es für angebracht, ihn aus dem Gefängnis heraus mir vorführen zu lassen.“
„In Ihr Ordinariat? Habe ich Sie recht verstanden?“
„Ja. Ich habe ihn befragt.“ Ein bitteres Lächeln kräuselte seine Lippen. „Nicht im Sinn der Inquisition.“
Der Erzbischof legte seine langfingrigen, gepflegten Hände aneinander und betrachtete seinen rot funkelnden Ring. „Bedenken Sie, Jerôme, auch ein Inquisitor muss den Beweis des Geistes und der Kraft erbringen. Regelmäßig ist die Zahl der abgelegten Geständnisse dem päpstlichen Legaten zu melden. Die Einheit muss voranschreiten gegen die grassierende Verwirrung. Sie müssen das in historischer Dimension sehen, lieber Bruder.“
Ghinucci schwieg. Er sah zum Fenster hinüber. Sein Blick blieb ruhen auf der alten, mächtigen Zeder, den bläulich schimmernden, vom Wind bewegten Zweigen.
Langsam sagte er: „Der Barbe Bérard ist noch ein junger Mann. Er kam von Sizilien im letzten Jahr zu Fuß über Piemont herüber in die Provence. Ich sah ihn mir genau an. Ein Mensch bäuerlicher Abkunft, mittelgroß nur, fast gedrungen. Sein fadenscheiniges Hemd konnte das Spiel seiner kräftigen Rückenmuskeln und die Breite seiner Schultern nicht verbergen. Aber er konnte nicht mehr gehen. Sie mussten ihn mehr schleppen, als dass sie ihn führten.“
Er hielt inne und lauschte diesem dumpf schabenden Geräusch nach zwischen den schweren Schritten der Wächter, das dieser Mann auf den kühlen, schimmernden Steinplatten seiner Bischofsresidenz hinterlassen hatte.
„Seine Beine hingen kraftlos herab, seine Füße waren mit einer dicken Schicht von Lappen umwickelt. Wie ich hörte, hat man sie ihm während der Verhöre langsam verbrüht. Blut und Wasser war die Spur seiner Füße.“
Der Erzbischof hob abwehrend seine schönen Hände. „Ich bitte Sie!“
Ghinucci schluckte schwer. „Ja. Eminenz, ich habe gesündigt, weil ich ihn habe kommen lassen und damit seine Pein vergrößert habe. Ich hätte ihn aufsuchen müssen. Kaum bei mir angekommen, wurde er ohnmächtig. Er war … geschunden …, so geschunden, wie … Er sollte dem Inquisitor andere Namen preisgeben, Namen für die Liste, Sie verstehen. Das hat er nicht getan – noch nicht.“
Der Erzbischof von Aix nahm den jadegrünen Drachen in die Hand und betrachtete ihn nachdenklich. Er steckte ihm den Zeigefinger in das geöffnete Maul.
„Nun ja, keine schöne Sache, gewiss nicht. Aber wenn diese Irrlehre besiegt ist, brauchen wir hier keine Inquisition mehr. Dann wird die Kirche, dieser Garten Gottes zurückfinden zu dem befriedeten Dasein, auf dem allein der Segen des Höchsten ruht.“ Er fasste seinen Untergebenen scharf ins Auge. „Aber diesen Kampf müssen wir durchfechten, Jerôme.“
Ghinucci beugte sich vor. In seinen dunklen Augen glomm ein Feuer. Der Erzbischof sah es mit widerwilligem Respekt und wollte ihn besänftigen: „Warum ereifern Sie sich so, lieber Bruder?“
Jerôme Ghinuccis Stimme wurde laut. „Ich habe mit einem gläubigen Nachfolger Jesu Christi gesprochen, Eminenz. Sicher, dieser Barbe ist wenig gebildet, er ist von geradezu naiver Geistesart. Jedoch ist er beseelt von dem Wunsch, in den Fußstapfen unseres Erlösers auf Erden zu gehen, Schritte zu machen auf dem Weg eines persönlich verantworteten Glaubens. Seine Seele ist frei und nur gebunden durch Christus.“
Ein langes Schweigen folgte seinen Worten.
Dem Erzbischof war die Röte in die Stirn gestiegen, aber er wartete, bis er sicher war, dass seine Stimme wieder zu ihrem gewohnten ruhigen Klang gefunden hatte.
„Frei!“ Die Art, wie er dieses Wort betonte, wies auf eine tief sitzende Erbitterung hin. „Frei! Wer von uns soll denn frei sein! Unsere Freiheit haben wir auf den Altar unserer heiligen Kirche gelegt, nicht wahr, Bruder Bischof, und sie als Brandopfer dargebracht wie die vor uns und die nach uns. Aus dem Opfer der Freiheit stieg die mächtige Mutter Kirche empor in ihrer unbezwingbaren, hehren Gestalt, von der der Evangelist Matthäus geschrieben hat, dass sie fest steht bis zur Ewigkeit und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen können. Warum achten Sie jetzt dieses Opfer gering, Sie, die Sie ja unschätzbare Verdienste erworben haben? Seine Heiligkeit selber hat Sie ausgezeichnet mit Lob. Ihre Rede auf dem 5. Laterankonzil war es würdig, in die Lehre der Väter unserer heiligen Kirche einzugehen. In Kürze reisen Sie nach Rom als einer von wenigen Auserwählten. Eine ruhmreiche Zukunft erwartet Sie, Jerôme. Ist dies alles nicht des Opfers wert?“
Bischof Ghinucci hatte gebeugt dagesessen wie unter einer schweren Last. Nun blickte er auf, und auf seinem Gesicht zeichnete sich heftige Unruhe ab.
„Vielleicht ist es nur die irdische Macht, der wir opfern, ich, Sie … Herrschen können, das ist wie ein süßes Gift in den Adern, man wird süchtig danach. Aber wir wissen, dass die Seele davon vergiftet wird, wie von innen ausgehöhlt, nicht wahr, das wissen wir …“ Sein Gesicht verzerrte sich. „Es ist Satan, der spricht: Falle vor mir nieder, und die Welt ist dein. Jesus Christus hat der Versuchung widerstanden, seine Kirche ist ihr erlegen. Eine Kirche, deren Gründer am Kreuz gestorben ist, darf keine Mordopfer bringen. Und es ist Mord, nichts anderes, wenn es in einem Prozess nicht mehr um Wahrheit geht, sondern darum, das zuvor gefasste Urteil nachträglich zu bestätigen. Wer der Inquisition in die Hände fällt, hat keine Chance mehr. Gesteht er, hat er sich selbst das Urteil gesprochen. Gesteht er nicht, ist er verstockt und des Todes schuldig. Ob er schuldig ist oder nicht, er wird verdammt. Die Kirche richtet ihn hin im Namen Jesu Christi, der gesagt hat: Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Kreuz, Scheiterhaufen, Galgen, Schwert – alle diese Instrumente der Gewalt sind Schläge ins Gesicht des gekreuzigten Erlösers.“
„Bitte, reden Sie nicht maßlos! Die heilige Kirche wacht über die Herde Jesu Christi, muss ich Ihnen das erst ins Gedächtnis rufen, Bischof Ghinucci? Das Wächteramt ist uns aufgetragen, um die reine Lehre zu schützen vor der Verkehrung durch ketzerische Irrlehrer. Die Kirche hat Vollmacht, zu richten …“
Ein heiserer, gequälter Laut entfuhr Jerôme Ghinucci. Der Erzbischof brach irritiert ab. „Was ist Ihnen?“
Bleich und streng, nicht wie das Antlitz eines Irdischen, kam ihm das Gesicht Ghinuccis vor. Und auf einmal hörte er die Stimme in seinen Ohren dröhnen wie mit einem zitternden Nachklang. Er beugte sich vor. „Was …“
„Ja. Ich sage es noch ein Mal: Christus selbst wird gekreuzigt von seiner Kirche. Fürchten Sie nicht das Gericht Gottes über Ihre Kirche, Herr Erzbischof?“
Der Erzbischof stand abrupt auf und reckte ihm starr die Hand entgegen. „Schweigen Sie! Sie gehen zu weit. Schweigen Sie doch!“ Heftig wandte er sich ab und drehte Jerôme Ghinucci den Rücken zu. Er trat zum Fenster und starrte blikklos auf die größer werdenden Schatten am hellen, ockerfarbenen Gemäuer der Kathedrale Unseres Heiligen Erlösers. Eine schwere Stille lastete über dem Raum, ein Schweigen wie ein endgültiges Verstummen.
Als er sich dem Bischof wieder zuwandte, war alle Verbindlichkeit aus seiner Miene verschwunden. Er trat zurück zum Tisch und setzte sich kerzengerade in seinen Stuhl.
„Warum meinten Sie, mir solche Sätze sagen zu dürfen?“, fragte er kalt. „Sie wissen doch, diese Mauern haben ein Gedächtnis.“
Jerôme Ghinucci sah ihn gequält an. „Wenn nicht Ihnen, wem dann? Auf wen kommt es an? Wer soll es tun?“
Die schwere Stille war ohne Trost.
Nach einer langen Pause nahm der Erzbischof wieder das Wort. „Sie sind nicht mehr tragbar als Bischof unserer heiligen Kirche. Das ist Ihnen wohl bewusst.“ Seine Stimme war leise, aber hart wie Stahl.
„Ich dachte, wenn Sie, Eminenz, Ihren Einfluss in der Bischofskonferenz … Die Bischöfe könnten sich vielleicht auf eine weichere Linie …“ Unter dem spöttischen Blick seines Gegenübers verstummte der Bischof von Cavaillon.
„Kompromisse, Jerôme? Nicht doch. Die Zeit der Kompromisse ist für Sie vorbei.“
Das Gesicht des Erzbischofs sah plötzlich aus wie das einer jener Heiligenfiguren am Portal der Erlöserkathedrale von Aix: steinern, glatt, abweisend. Jerôme Ghinucci fühlte eine Kälte in sich aufsteigen, die ihn wehrlos machte. Vorbei der wärmende Eifer, die zornige Hitze der vorigen Augenblicke. Vorbei auch das plötzliche starke Gefühl des Gehaltenseins in der Gegenwart des Auferstandenen. Nun gab es kein Zurück mehr, das wusste er. Er selbst hatte das Gespräch an diesen Wendepunkt getrieben. Er senkte den Kopf. Sein Kampf war vorbei.
„Sie erhielten doch Ihr Amt auf Lebenszeit, Bischof Ghinucci.“ Der Erzbischof ließ diesen Satz im Raum hängen wie ein Damoklesschwert.
Der Bischof erbleichte. Der kalte Griff der Angst hielt ihn in Reglosigkeit. Er umfasste die geschnitzten Armlehnen fest mit seinen klammen Händen. In quälender Langsamkeit hob er den Kopf und sah dem Erzbischof ins Gesicht, suchend, drängend.
Der hielt dem Blick stand. Stumm fragten sie einander ab mit den Augen, verbargen nichts mehr voreinander, ließen einander ihre Gesichter in ihrer Nacktheit erkennen, und ohne Worte verstanden sie einander wie im Angesicht des Todes.
„Sie werden auf eine weite Reise gehen müssen, Jerôme“, sagte der Erzbischof tonlos.
Jerôme Ghinucci schwieg. Um ihn war eine große Ruhe. Er lauschte auf das Rauschen der Zeder vor dem Fenster, und aus seiner verschütteten Erinnerung trat plötzlich ein Bild, zartfarbig und verfließend wie ein Aquarell: Er sah den Hügel von San Bartolo mit den schlanken Zypressen oben neben der alten Kapelle. Er spürte wieder die weiche Luft seiner Heimat und den würzigen Duft eines trockenen Spätsommers in der Toskana. An der Hand seines Vaters ging er den schmalen Pfad zur Kapelle hinauf.
„Mein Vater war ein einfacher italienischer Bauer“, sagte er unvermittelt in die Stille des Audienzraumes hinein, und der Erzbischof zeigte keinerlei Verwunderung. Er nickte nachdenklich.
Dann sprach er – und Ghinucci musste sich anstrengen, die leise Stimme zu verstehen – sehr langsam und verhalten: „Und ich bin Katalane, wussten Sie das? Aufgewachsen in einem Land, das seit Jahrhunderten die unselige Bestimmung hat, Menschen mit aufrührerischem Sinn und eigenbrötlerischen Gedanken hervorzubringen. Katalanien, das Land der Katharer. Aber dieses Katalanien hat auch die Bollwerke des Glaubens, die der Saat der Irrlehre trotzen.“ Er sprach nun fast im Flüsterton. „Kennen Sie Serrabona?“
Jerôme Ghinucci schüttelte den Kopf.
„Serrabona – in unserer katalanischen Sprache heißt es: gutes Gebirge. Eine Abtei hoch oben auf einem Bergvorsprung, ein weit vorgeschobener Posten wie der Karmel des Elia. Ein Kloster in der Einöde. Stellen Sie sich vor: ein weites Land, nur Schiefergestein, graue Felsen, Himmel, Steineichen. Die Sonne brennt ungehinderter als im Tal. Die Stürme im Winter lassen dort oben ihre ungezügelte Kraft los. Und die Herbstnebel hüllen die Abtei tagelang in einen grauweißen Schleier. Serrabona. Ein heiliger Ort. Die Mönche dort leben rein ihrem Herrn, frei von allen weltlichen Händeln, in völliger Abgeschiedenheit. Von Serrabona kommt keiner zurück in die Welt.“
Der Bischof von Cavaillon bedeckte sich die Augen mit einer Hand. „Unsere Welt braucht den Dienst der Betenden“, sagte er stockend.
Der Erzbischof nickte. „So sind Sie also bereit?“
Jerôme Ghinucci hörte seine Stimme wie die eines Fremden. „Ich bin bereit.“
Die Stille zog nun ein in sein Inneres, er öffnete sich ihr ganz. Es war ihm, als läge plötzlich ein längst vergessener Duft über diesem erzbischöflichen Raum. Er erkannte ihn wieder, den leicht modrigen Geruch der Kühle wie in der dämmrigen Kapelle auf dem Hügel seiner Kindheit.
„Mein Leben bedarf der Buße“, flüsterte er.
Der Erzbischof sah in das bewegte Gesicht seines Gegenübers und wandte dann betreten den Blick ab wie einer, vor dessen Augen sich etwas Ungehöriges abspielt.
Schließlich fragte der Erzbischof: „Wann hätte Ihre Reise nach Rom stattfinden sollen?“
Ghinucci sah auf wie ein Erwachender. Es schien, als habe er Mühe, die Wörter auf seinen Lippen zu formen. „In vierzehn Tagen, Eminenz.“
„Geben Sie Order, dass schon nächste Woche der Aufbruch erfolgen soll.“
Der Bischof nickte stumm.
„Im Kloster Le Thoronet machen Sie die erste Rast. Von dort wird dann alles in die Wege geleitet sein.“
„Aber in Rom …“
Der Erzbischof schnitt ihm das Wort ab. „Das alles hat Sie nicht mehr zu interessieren.“
Er stand auf und trat hinter Ghinuccis Stuhl. Er sah auf die gebeugten Schultern des Bischofs, seinen gesenkten Kopf und die Reglosigkeit seiner Gestalt; deutlicher konnte das Eingeständnis einer Niederlage nicht sein. Der Erzbischof ließ ihm noch einen Augenblick Zeit, dann fasste er seine Schulter mit leichtem Druck. „Sie müssen jetzt gehen.“
Jerôme Ghinucci erhob sich langsam. „Ich danke Ihnen, Eminenz.“ Er verbeugte sich steif.
Der Erzbischof reichte ihm die Hand zum Kuss. „Leben Sie wohl, Geronimo.“
Als er seinen Namen in seiner italienischen Muttersprache ausgesprochen hörte, hob Jerôme Ghinucci den Kopf und sah ihn an. In seinen Augen stand Trauer. „Ja“, sagte er leise, „ein Kreis wird sich schließen.“
Er beugte das Knie, und der Erzbischof machte das Kreuzeszeichen über ihm. „Der Herr segne deinen Ausgang und Eingang.“
Als die Tür sich hinter Jerôme Ghinucci geschlossen hatte, streckte der Erzbischof seine Hand aus und betrachtete versonnen den Ring, Zeichen seiner Würde. Es war ihm, als sähe er sein eigenes Spiegelbild sehr klein und mit schmerzender Klarheit in dem roten Glanz des Steines. Zögernd trat er zum Fenster. Dort unten geht er nun zu seinem Wagen, Jerôme Ghinucci, hochverdienter Bischof der heiligen Kirche, glänzender Theologe, von der Kurie ausgewählt als Mitglied des vorbereitenden Ausschusses zum bevorstehenden Konzil von Trient. Einer, der tief gefallen ist – oder hoch erhoben? Der Erzbischof lächelte freudlos. Wer mochte das entscheiden!
Er schloss die Augen. Serrabona. Er sah vor sich das Dunkel der Abteikirche, fensterlos wie das Allerheiligste des Tempels, im Kerzenschein schimmerte die Säulenreihe aus dem rosa Marmor der Pyrenäen, glänzten die Kapitelle wie das helle Fleisch der Opfertiere. Und durch das Tor trat einer in dunkler Kutte, durch nichts zu unterscheiden von all den anderen dieser selig Friedfertigen in der weltabgeschiedenen Einöde.
„Bete auch für mich dort oben, Bruder Geronimo“, flüsterte Pierre Filhol, der Erzbischof von Aix.
Die Kathedrale St. Veran war bis auf den letzten Platz gefüllt, draußen am Eingang standen die bischöflichen Wachen und versperrten den Zugang zum Kirchenraum. Die Leute stauten sich auf dem Kirchplatz und drängten nach vorn. Als das Glockengeläut einsetzte, verebbte der Lärm der Stimmen allmählich.
„Auf der Reise nach Rom an Herzversagen gestorben“, sagte ein alter Mann laut zu den Umstehenden. „Wer das glaubt! Ich wette, es war der Schwarze Tod. Sie haben wieder einmal eine Nachrichtensperre verhängt, aber ich habe aus verlässlicher Quelle gehört, dass in Oberitalien die Pest ausgebrochen sein soll. Wenn die nur nicht zu uns kommt!“
Eine Frau kreischte auf, Unruhe machte sich bemerkbar. Erregte Stimmen schwollen an.
„Leute, gebt Ruhe, sonst wird der Platz geräumt.“ Der Hauptmann sprach laut und drohend; er hatte die Anzeichen der Panik erkannt und fürchtete einen unkontrollierbaren Ausbruch der Volksmenge. Er pochte anhaltend mit dem Lanzenschaft auf das Pflaster. Die Leute wichen zurück.
„Man sollte die Grenzübergänge schließen“, meinte ein Mann in bäuerlicher Kleidung halblaut. „Italiener brauchen wir hier nicht.“ Zustimmendes Gemurmel gab ihm Recht.
„Bischof Ghinucci war auch Italiener“, entgegnete eine Frau.
„Das ist etwas anderes! Still jetzt!“
Der Chor der Mönche begann zu singen. Nun wurde es ruhig auf dem Platz. Sie wollten die Stimme des Erzbischofs von Aix hören.
In der Kathedrale, vorne in der zweiten Reihe, saß der Baron von Oppède mit seiner Frau. Zufriedenheit erfüllte ihn. Es ist gut, dass ein anderer bald Bischof wird. Ghinucci war mir nicht wohlgesonnen. Aber nun hat die Vorsehung einen Wechsel herbeigeführt, Dank sei dem weisen Gott, dem Herrn der Geschichte. Vielleicht unterstützt der neue Bischof in deutlicherer Weise mein Anliegen, den Irrglauben zu bekämpfen. Der Baron überließ sich seinen Gedanken.
„… und so übergeben wir Jerôme Ghinucci, den hochehrwürdigen Bischof von Cavaillon und allzeit treuen Diener unserer heiligen Kirche dem gnädigen Gericht des allmächtigen Gottes.“
Jean d’Oppède beugte dankbar das Knie.
„In deiner Güte, o Herr, erweise dich gnädig an Zion, lass neu erstehen Jerusalems Mauern. Dann wirst du annehmen Brandopfer und Gaben als gültige Opfer, dann wird man Opfertiere legen auf deinen Altar. O Herr, gib ihm die ewige Ruhe.“
Die klare, ruhige Stimme Pierre Filhols, des Erzbischofs von Aix füllte mühelos den Raum. Jean d’Oppède blickte zu ihm auf. In seinem prächtigen Ornat, die hohe Gestalt in erhabener Ruhe, kam er ihm vor wie die Verkörperung des erhöhten Christus auf Erden.
„Und das ewige Licht leuchte ihm“, antwortete die Menge der Gläubigen.
Der Erzbischof hob die Hand zum Segen.
„Ehre sei dir, o Herr …“, murmelte der Baron zusammen mit allen anderen. Und einen Augenblick lang wusste er nicht mehr, ob er Christus meinte oder den hohen Würdenträger vor dem Hochaltar.
„Mein lieber Baron“, Pierre Filhol, der Erzbischof von Aix musterte sein Gegenüber mit kühler Abschätzung, „eine Bestattung wird es nicht geben in Cavaillon. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Dieser Bischof wird fehlen müssen in der Gruft von St. Veran. Er hatte den persönlichen Wunsch – und Seine Heiligkeit selbst wollte, dass diesem Anliegen entsprochen wird –, in seiner Heimat die letzte Ruhe finden zu dürfen. Wie Sie wissen, stammte Bischof Ghinucci aus Italien.“
Jean d’Oppède verbeugte sich beflissen. „Es gereicht unserer heiligen Kirche zur Ehre, dem letzten Wunsch ihres treuen Dieners entsprochen zu haben. Auch ohne Grabstätte wird die Stadt Cavaillon ihrem verstorbenen Bischof ein ehrendes Andenken bewahren. Wir werden eine Bronzetafel in St. Veran setzen lassen.“
Der Erzbischof neigte den Kopf. „Tun Sie das, Baron.“
Der Vizelegat von Avignon, der im Rang der höchste anwesende Amtsinhaber der Kirche nach dem Erzbischof war, hatte die beiden Männer aufmerksam beobachtet. Nun stand er auf, worauf das Stimmengewirr an der festlichen Tafel sofort verstummte.
Der Vizelegat ließ seinen kalten Blick über die kirchlichen Würdenträger und die Adelsherren mit ihren Damen schweifen, und auf seine scharf geschnittenen Züge trat ein fast unmerklicher Ausdruck von Geringschätzung.
„Meine Damen und Herren, wir wollen an diesem ernsten Tag nicht auseinandergehen, ohne die lehrreiche Legende des heiligen Veran anzuhören, nach dem ja die Kathedrale dieser bedeutenden Stadt Cavaillon genannt ist.“ Seine klingende Stimme hatte auch jetzt einen spöttischen Unterton. „Ich bitte also den geehrten Bruder Prior von St. Veran um seinen geschätzten Vortrag.“
Er setzte sich und nahm seinen Pokal in die Hand. Rot funkelte der Wein in dem geschliffenen Kristall. Er nahm einen tiefen Schluck und neigte dann lauschend den Kopf. Die Tischrunde versank nach seinem Vorbild in horchende Konzentration.
Der gebrechliche Prior war aufgestanden und begann, mit hoher, zittriger Stimme und monotoner Sprechweise die Legende des Heiligen vorzutragen.
„Der heilige Veran, nachdem er zum Priester geweiht worden war, vollbrachte mehrere Wunder. Der Herr war mit ihm, und das Volk sah mit gläubigem Vertrauen auf zu ihm. Er war der erste Bischof von Cavaillon und hatte dieses Amt 30 Jahre lang inne, Gott zur Ehre und den Menschen zum Nutzen. Die Sage erzählt, dass ein grässlicher Drache aus der Unterwelt vom Satan selbst losgelassen wurde als Geißel und Anfechtung für die fromme Stadt Cavaillon. Der Drache kam des Nachts und verschlang viele Menschen, sodass die Bevölkerung der Stadt stark dezimiert wurde. Dem heiligen Bischof Veran gelang es, nachdem er in Fasten und Beten lange Zeit sich abgesondert, das Ungeheuer zu fesseln. Er verbot ihm kraft des Heiligen Geistes, sich an dieser Stadt zu vergreifen. Nachdem der gefesselte Drache das Gelöbnis getan, sich von der Stadt fortan fern zu halten, löste der heilige Veran seine Fesseln und ließ ihn frei. Das Ungeheuer floh eilends und sprang bis ins Luberongebirge. Seither ist Gottesfürchtigkeit ein Kennzeichen der Stadt. Nie mehr ist das Tier des Abgrunds hier aufgetaucht. Der heilige Veran starb im Jahr 590. Erst 400 Jahre später wurde der Grundstein zu der Kathedrale gelegt. Aber ihr Name stand fest. Sie sollte für alle Zeiten die Kathedrale des heiligen Veran heißen.“
Der Prior setzte sich unter dem höflichen Applaus der Tischgesellschaft.
Der Vizelegat von Avignon wandte sich lächelnd an Pierre Filhol, den Erzbischof von Aix. „Ein Drache – welch schönes Symbol, nicht wahr, Eminenz. Sehr vielseitig verwendbar. Der Drache – vielleicht ein kirchliches Symbol? Wäre das zu gewagt?“
Pierre Filhol war amüsiert, wie es schien, aber seine Augen blickten wachsam. „Der heilige Michael im Kampf mit dem Drachen, diese Darstellung gehört ja traditionell zur kirchlichen Kunst. Ich denke auch an die orthodoxe Kirche, die diese Tradition …“
Der päpstliche Vizelegat hörte den Ausführungen des Erzbischofs mit höflichem Interesse zu. Er ist klug wie eine Schlange, dieser Katalane, aufs Glatteis lässt er sich nicht führen.
Laut sagte er: „Ich sehe, Eminenz, Ihr umfassendes Wissen auf so vielen Gebieten der Geistesgeschichte macht Sie zu einem hochinteressanten Gesprächspartner. Ich schätze mich glücklich, in naher Zukunft öfters in den Genuss Ihrer Konversation kommen zu dürfen.“
Pierre Filhol verzog keine Miene. „Auch ich finde die Entscheidung, auf die Sie anspielen, von Weisheit getragen und zum Wohl unseres Landes.“
Der Vizelegat beugte sich leicht vor und sprach Jean d’Oppède über den Tisch hinweg an. „Ich finde an der Legende interessant, dass der Drache auf dem Luberongebirge freigelassen wurde. Haben Sie nicht Ihren Stammsitz in dieser Gegend, Baron?“
Der Baron zögerte einen Augenblick, dann sagte er: „Mein Vater bekam im Jahr 1501 Burg und Ort Oppède als Freigut von Papst Alexander VI. Unsere Familie war schon immer der Kurie treu ergeben seit der Zeit der Kreuzritter. Die Einheit der heiligen Kirche ist auch mir ein Herzensanliegen.“
Der päpstliche Vizelegat nickte anerkennend. „Dann sind Sie also der richtige Mann, Baron, den Drachen im Luberongebirge, sollte er sich wieder regen, zu bekämpfen. Ihr Amt als Zweiter Präsident des Parlaments unserer Provence gibt Ihnen ja Handlungsspielraum.“
Jean d’Oppède deutete im Sitzen eine Verbeugung an. Ein warmes Gefühl des Stolzes überkam ihn. Er wollte geziemend antworten, aber da stand der Erzbischof von Aix auf. „Es wird Zeit zum Aufbruch. Begleiten Sie mich, Baron?“
Jean d’Oppède geleitete ihn zum Ausgang, die übrigen Würdenträger folgten.
„Ist schon eine Entscheidung gefallen für die Nachfolge von Bischof Ghinucci?“, fragte er mit diskret gedämpfter Stimme.
Pierre Filhol wandte sich ihm zu mit einem steinernen Lächeln im Gesicht. „Vielleicht haben Sie heute mit ihm gesprochen, Monseigneur.“
„Der Vizelegat?“ Der Baron war überrascht. „Er ist doch schon Bischof von Toulon.“
Der Erzbischof sah ihn bohrend an. „In Kürze wird er auch das Bistum Cavaillon verwalten. Er ist ein Mann großer Erfahrung und hat als Vizelegat wertvolle Kontakte. In diesen unruhigen Zeiten ist er ein Garant für die erwünschte Stabilität unserer heiligen Kirche.“
Der Baron stimmte zu. „Selbstverständlich begrüße ich diese Entscheidung.“
Der Erzbischof blieb stehen. Seine dunklen Augen – glomm nicht ein Funke Verachtung darin? – ruhten einen Augenblick zu lang auf Jean d’Oppède. „Das bezweifle ich nicht.“
Hatte Ablehnung in seiner Stimme mitgeklungen? Der Baron sah ihn verwirrt an. Aber der Erzbischof reichte ihm schon die Hand, und Jean d’Oppède beugte das Knie.
„Danke verbindlichst für Ihren hohen Besuch, Eminenz.“ Er küsste den Ring.
Pierre Filhol, Erzbischof von Aix, bestieg die Kutsche. Mit keinem Blick schaute er zurück. Diese Amtshandlung war endlich überstanden! Flüchtig schaute er in den Spiegel und erschrak über das fremde bleiche Gesicht des Mannes in der Amtstracht des Leichenbegängnisses. Eine Welle von Übelkeit und Angst überflutete ihn, er ließ sie über sich hinweggehen und hielt stand. War es das Holpern und Schütteln des Wagens, was ihm heute schlecht werden ließ?
„Fürchten Sie nicht das Gericht Gottes über Ihre Kirche, Herr Erzbischof? Das Gericht Gottes über … Gericht Gottes …“ Er fühlte, wie ihm der Schweiß ausbrach und in Tropfen den Rücken hinunterrann. Seine Gedanken verwirrten sich in einem Augenblick des Entsetzens: eine Totenmesse – aber der Tote lebte. Oder hatte ein Toter die Messe gelesen für einen Lebenden? Jerôme Ghinucci, wie du mich angesehen hast mit Qual und Hoffnung in den Augen, an jenem Tag im Audienzraum in meiner Residenz in Aix … Der Erzbischof atmete schwer. Er lehnte sich zurück an das harte Polster des Wagens. Die Räder holperten über das Pflaster, und in seinem schmerzenden Kopf hämmerte ein Wort sein quälendes Stakkato: Frei … frei …
Und er hörte seine eigene Stimme sagen: „Wer von uns soll denn frei sein!“