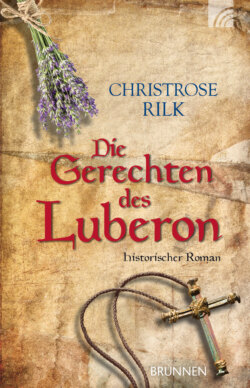Читать книгу Die Gerechten des Luberon - Christrose Rilk - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wie Steine in einer Pyramide
ОглавлениеOzias Mormas, der Gerber und Schuhmacher von Oppède, saß in seiner Werkstatt. Er hatte etliche seiner besten Häute vor sich ausgebreitet. Unschlüssig fuhr er mit dem Daumen über das kühle, glatte Leder, das er ausgesucht hatte. Oder soll ich doch lieber das dunklere nehmen? Kräftig muss es sein und doch weich, gleichmäßig in der Stärke, von schöner Farbe und mit glatter Oberfläche. Nein, dieses hier ist genau richtig. Solch schöne Stücke gibt es nicht gleich wieder. Marcel wird staunen, welch ein Prachtstück sein alter Vater ihm daraus machen wird. Und das dunklere Leder nehme ich für die Stiefel. Er stand auf und ging zum Regal.
Ein Schatten fiel in den kleinen Raum. In der Eingangstür stand eine hohe Gestalt. Ozias Mormas runzelte die Stirn. Diesen Menschen sah man lieber zur Tür hinausgehen als eintreten.
„Untertänigen Gruß, Herr Baron“, murmelte er ohne Ehrerbietung, „womit kann ich dienen?“
Der Baron d’Oppède trat an den niedrigen Tisch. Er strich mit der Hand leicht über die Lederstücke und sagte: „Diese nehme ich, sie gefallen mir. Du sollst mir ein paar Stiefel machen.“
Ozias Mormas schüttelte den Kopf. „Nicht aus diesem Leder. Das ist vergeben.“ Er wies mit dem Kopf zum Regal. „Suchen Sie sich dort ein Leder aus, Monsieur.“
Jean d’Oppède sah ihm misstrauisch ins Gesicht. Der Alte senkte den Blick nicht. Unter finster zusammengezogenen Brauen blickten ihn dunkle Augen unverwandt an.
„Nein!“ Jean d’Oppède hob die Stimme nicht, aber ihr Klang war scharf geworden. „Ich will genau dieses Leder hier.“
Der Gerber räumte schweigend das Leder vom Tisch und trug ein paar andere Häute vom Regal herüber. Er legte sie auf den Tisch.
„Feine Ware“, sagte er mit einem drohenden Unterton, „hier, sehen Sie, fein sogar für einen Baron, der Gerichtspräsident ist und Menschen verurteilen kann.“
Eine Zornesader schwoll auf der Stirn des Barons. „Ich nehme das Leder, das ich dir gezeigt habe. Hast du das verstanden?“
Ozias Mormas wurde laut: „Aber dieses Leder ist nicht verkäuflich.“
„Das bestimme ich, Mormas. Und jetzt nimmst du Maß!“
Ozias Mormas rührte sich nicht.
Aus dem Hinterzimmer trat hastig Esther Mormas. Ozias wusste: Seine Frau hatte an der Tür gelauscht und hielt jetzt die Zeit für gekommen, dass sie eingreifen musste. Sie beugte das Knie und sagte demütig: „Es ist uns eine Ehre, Herr Baron.“
„Es sieht nicht danach aus“, bemerkte Jean d’Oppède aufgebracht.
Esther drückte ihrem Mann ein Holzmaß in die Hand. „Ich hatte es gebraucht“, sagte sie und sah ihm starr in die Augen, „hier hast du es wieder. Jetzt kannst du dem Herrn Baron Maß nehmen.“
Ozias Mormas sah sie zornig an, aber sie hielt seinem Blick stand. Schließlich kniete sich Ozias widerwillig auf den Boden und nahm Maß.
„Bis nächste Woche müssen die Stiefel fertig sein“, befahl der Baron. „Und du weißt, aus welchem Leder ich sie haben will.“
„Selbstverständlich, Herr Baron.“ Esther Mormas öffnete ihm beflissen die Tür. „Sie können sich darauf verlassen.“
Jean d’Oppède trat ins Freie. Dieser Gerber wurde allmählich untragbar! Und er hatte es zugelassen, dass dessen Sohn Marcel ein Kamerad von seinem Nicolas gewesen war! Das war, wie sich jetzt herausgestellt hatte, ein schwerer Fehler gewesen. Aber er hatte ja viel Zeit in Aix zugebracht mit seinen Aufgaben im Parlament und im Gerichtshof, da hatte er sich schließlich nicht um alles kümmern können. Jean d’Oppède schwang sich wütend in den Sattel. Meine Kinder schlagen nicht so ein, wie sie sollten. Schuld daran ist die Erziehung ihrer Mutter. Ist adlig geboren und weiß nicht, wie Adlige sich benehmen sollten! Die Kinder mit Sprösslingen aus dem gemeinen Volk spielen lassen! Er gab dem Pferd die Sporen. Das Benehmen dieses Mormas ist wirklich unerträglich.
„Der Baron reitet rücksichtslos durch so eine enge Gasse“, schimpfte eine junge Frau, die eben ihr Kind von der Türstufe hochgerissen hatte. „Soll er sich doch das Genick brechen!“
„Was fällt dir ein!“, schrie Ozias Mormas seine Frau an. „Warum hältst du dich nicht heraus aus meinen Geschäften?“
„Wenn ich mich heraushalte, bringst du uns ins Unglück, du Hitzkopf“, entgegnete sie zornig. Sie trat dicht zu ihm hin und zischte: „Soll dieser Gewaltmensch sich gegen Marcel stellen? Soll er ihn beschatten lassen? Soll er ihn hetzen und vor die Inquisition bringen?“
Ozias Mormas wurde bleich.
Esther holte das vom Baron ausgesuchte Leder und breitete es auf dem Arbeitstisch aus.
„Für Marcel findest du ein anderes. Und jetzt fang an!“ Einlenkend setzte sie hinzu: „Sei doch nicht immer so unklug, Ozias! Mach ihm die Stiefel und verlang einen saftigen Preis dafür!“
Er gab nach und setzte sich an den Arbeitstisch. „Du bist falsch wie eine Schlange“, brummte er.
Esther lächelte. „Nein, klug wie eine Schlange.“
Jean d’Oppède eilte die Stufen hinauf. Seine Frau Anne stand am Treppenabsatz. „Jean …“
Er schob sie beiseite. „Jetzt nicht. Ist Nicolas in seinem Zimmer?“
Baronin Anne hob die Schultern. Sie musste ihn nichts fragen. Sein zorniges Gesicht sagte ihr genug. Sie trat zurück in den Wohnraum. Immer diese Auseinandersetzungen! Was er nur hat mit dem Jungen! Er könnte mit seinem Sohn doch zufrieden sein, Nicolas wird ja Jura studieren, nach den Wünschen seines Vaters. Und sonst – ist es nicht gut, wenn sich die jungen Menschen ihre eigenen Gedanken machen? Und da kam ihr plötzlich eine Erkenntnis über ihren Mann, die sie erschreckte: Jean will herrschen, er will uns alle beherrschen; er will nicht nur bestimmen, was wir tun und lassen, er will auch die Kontrolle über unsere Gedanken.
Sorgenvoll nahm sie die Stickerei wieder auf, an der sie gearbeitet hatte. Doch nach wenigen Augenblicken warf sie den Stoff beiseite. Ihre Hand war nicht ruhig genug für die zierlichen, feinen Muster. Groll auf ihren Mann keimte auf in ihr und eine wachsende Enttäuschung darüber, dass ihm das alles nicht genug war, was doch ihr Leben ausmachte: die Familie, das Beieinandersein, die Burg und der Ort Oppède. Sie lauschte an der Tür ins Treppenhaus hinaus, gefasst darauf, sogleich aufgebrachte Stimmen hören zu müssen. Aber es blieb still.
„Nicolas“, der Baron trat ins Zimmer seines Sohnes, „aus gegebenem Anlass ersuche ich dich, nicht mehr mit diesem Gerbersohn herumzuziehen.“
Nicolas fuhr auf. „Marcel ist mein Freund.“
Sein Vater machte eine wegwerfende Handbewegung. „Freund! Wenn du erst in Aix studierst, wirst du wahre Freunde finden, die dir ebenbürtig sind. Viele junge Adlige studieren in Aix, darunter Söhne aus den ersten Familien. Es ist deiner nicht würdig, dich mit einem Jungen aus der niederen Schicht abzugeben. Hörst du mir zu?“
Nicolas sah seinem Vater unentwegt ins Gesicht. „Ich höre Ihnen genau zu, Herr Vater.“
Der Baron musterte ihn misstrauisch. „Sollte es umsonst sein, in dieser Sache an deine Einsicht zu appellieren, sage ich dir gleich: Ich untersage dir den Umgang mit diesem jungen Mormas.“
Er wartete einen Augenblick, aber Nicolas gab keine Antwort. Seine hellen Augen musterten seinen Vater mit einer Aufmerksamkeit, als betrachte er interessiert ein Bild. Der Baron fühlte sich unbehaglich in diesem Schweigen.
„Das wär’s“, sagte er knapp und ging hinaus.
Nicolas blieb reglos auf seinem Stuhl sitzen. Er wusste, dass er in diesen Augenblicken eine Grenze überschritt, dass er dabei war, etwas für immer zu verlassen, und er wehrte sich nicht mehr dagegen. Schließlich stand er auf und holte seinen Umhang vom Haken. Ungesehen gelangte er zur Burg hinaus.
Vor der Gerberwerkstatt stand Esther Mormas und schwatzte mit ihrer Nachbarin. Die Frauen knicksten tief. „Guten Tag, junger Herr.“
„Ist Marcel da?“, fragte Nicolas kurz.
Esther Mormas streckte den Kopf in den Hauseingang. „Marcel!“, rief sie schrill. Die andere Frau verschwand im Haus nebenan.
Nicolas stand da und musste in peinigender Scham ihr lautes, falsch-freundliches Gerede mitanhören. „Es ist zwar mitten in der Arbeitszeit, Marcel, aber natürlich hast du jetzt frei, wenn der junge Baron nach dir verlangt. Und was den Verdienstausfall angeht – der junge Herr wird dich sicher angemessen entschädigen, da bin ich unbesorgt. Geh nur, Marcel.“
Marcel kam heraus und sagte leise mit verlegenem Gesicht: „Gehen wir!“
Unter den neugierigen Blicken der Dorffrauen hinter den Fenstern gingen sie hinüber zum Hohlweg. „Was ist denn los, Nicolas?“
Nicolas d’Oppède schwieg und beschleunigte seine Schritte. Ohne sich darüber verständigen zu müssen, schlugen sie den Fußweg zur Büßerkapelle ein. Dort oben vor dem baufälligen Kirchlein hatten sie sich öfters getroffen in den vergangenen Jahren. Es war still auf der Anhöhe. Sie setzten sich nebeneinander ins trockene Gras. Nicolas wusste: Es würde heute das letzte Mal sein für lange Zeit.
Leise sagte er: „Marcel, ich muss schon früher nach Aix gehen als geplant. Ich will nicht länger mit meinem Vater zusammenwohnen. Und er bleibt den ganzen Monat noch hier auf der Burg.“
„Ist etwas geschehen, Nicolas?“
Nicolas starrte finster vor sich hin. „Er war so wütend und ungerecht vorhin …“
Marcel nickte. „Ich kann mir denken, warum. Er war vorher in der Werkstatt, und mein Vater …“ Er legte seinem Freund den Arm um die Schultern. „Du weißt ja, wie die Väter sind. Reg dich nicht auf!“
Nicolas schüttelte den Kopf. „Es ist mehr als das, Marcel. Ich muss fort, ich halte es nicht mehr aus.“ Er sah seinem Freund ins Gesicht, und in seinen grauen geduldigen Augen stand Verzweiflung.
Marcel erschrak. „Warum sagst du mir nicht, was eigentlich los ist? Was hältst du nicht mehr aus?“
Nicolas war unschlüssig. Er suchte nach einem Anfang. Schließlich sagte er. „Weißt du, was eine Pyramide ist, Marcel?“
Marcel machte eine ungeduldige Bewegung. „Du hast mir doch Abbildungen gezeigt in deinen Büchern und mir wieder und wieder …“
„Gut. Ich gebrauche die Pyramide jetzt nur als Bild, verstehst du, als Symbol. Die Spitze oben ist sehr dünn. Da oben ist einer, nur noch einer, den alle tragen, der König von Frankreich oder der Papst. Dann folgen die Fürsten, die Kardinäle, die Erzbischöfe, der höhere und der niedrige Adel …“
„Gehörst du zum höheren Adel, Nicolas?“
Der wehrte ab. „Nein, nein. Dass mein Vater Vizepräsident des Parlaments der Provence ist, hat andere Gründe. Innerhalb der Pyramide gibt es eine Art Bewegung: die Oberen belohnen die, die weiter unten sind für besondere Dienste mit einem Platz weiter oben. Das heißt dann Karriere. Mein Großvater Accurse d’Oppède war Richter und hat in den Diensten des Papstes Karriere gemacht, zum Beispiel wurde er in den Senat der Universität in Avignon berufen. Er wurde Botschafter in Venedig, und schließlich hat er vom Papst Alexander VI. Borgia die Burg und den Ort Oppède als Freigut erhalten und dazu den Titel Baron.“
Marcel fragte interessiert: „Was waren denn seine besonderen Verdienste?“
Nicolas blickte finster drein. „Im Einzelnen – das weiß ich nicht, will ich gar nicht wissen. Im Allgemeinen: Er hat gehorcht. Er tat, was er tun sollte oder musste. Siehst du, das Gesetz dieser Pyramide ist unerbittlich. Du musst nach oben gehorchen und nach unten befehlen. Du kannst belohnt oder bestraft werden, und mit denen unter dir tust du dasselbe.“
Marcel sah ihn ungläubig an. „Ich dachte nicht, dass dein Vater auch jemandem gehorchen muss. Wem denn?“
Nicolas lachte bitter. „Offiziell dem König, oder dem Gesetz, oder dem Papst. Aber im Geheimen muss er all den Drahtziehern, Mittelsmännern, Beauftragten gehorchen. Und überall gibt es Spitzel. Es ist eine mächtige Organisation im Geheimen.“ Er schlug die Hände vor sein Gesicht. „Ich hasse es!“, stieß er hervor. „Ich hasse dieses ganze verrottete, korrupte System. Ich hab mich so gefreut, wegzukommen. Aber ich weiß, dass mein Vater in Aix alles schon festgelegt hat für mich: wo ich wohne, welches Fach ich studiere, wer mich einlädt, wer mich kontrolliert, wem ich zu Diensten sein soll …“
Marcel sagte nichts, doch sein offenes Gesicht zeigte seine Gefühle. Er versteht mich, dachte Nicolas, und empfand tröstlich die alte Vertrautheit. Still saßen sie nebeneinander auf dem warmen Heideboden. Nicolas lauschte dem Rauschen des Windes in den Pappeln am Weg, beobachtete das Spiel der schwankenden Schatten.
„Ich wollte, du könntest auch nach Aix, Marcel! Dann wären wir öfter zusammen.“
Marcel sagte stockend: „Ich hab dich oft beneidet, weißt du. Immer warst du derjenige, der fort kann, und ich der, der bleiben muss. Aber vielleicht … Und was du da gesagt hast, irgendwie …“ Er verstummte. Dann beugte er sich hinüber zu Nicolas und flüsterte nahe an seinem Ohr: „Vielleicht bleibe ich auch nicht in Oppède.“
Nicolas sah ihn fragend an, doch sein Freund verriet nichts Weiteres. Sie schwiegen.
Nicolas wartete. „Verstehst du mich?“, sagte er drängend.
Marcel warf den Kopf zurück und sah in den hellen Himmel. „Nicolas, ich bin eigentlich froh, dass ich ganz unten bin in der Pyramide. Ich kann nicht aufsteigen, aber an meiner Stelle bin ich vielleicht freier als du.“
Nicolas verzog das Gesicht. „O nein, ganz unten bist du nicht, Marcel. Du kannst sehr wohl fallen. Weißt du, wer ganz unten ist, hoffnungslos unten? Das sind die, die vor der Kathedrale der Heiligen Anna in Apt auf den Stufen sitzen und die Hand aufhalten, wenn sie dich kommen sehen. Das sind die Mädchen, die im Flussviertel in Cavaillon an der Straße stehen und sich verkaufen müssen, und wenn sie nicht genug Geld abliefern, werden sie von ihren Zuhältern verprügelt. Und weißt du, wer ganz, ganz unten ist, ganz in der Tiefe, so richtig in den Dreck getreten?“
Auf Marcels Gesicht stand eine gespannte Aufmerksamkeit. „Wen meinst du?“
Nicolas sah gequält über die sanfte Hügellandschaft mit ihren Kirschbäumen und Weingärten.
„Da drüben liegt Cavaillon. Cavaillon – ich hasse diese Stadt. Weißt du, was dort geschieht? Du hast gefragt, wen ich meine, wer die sind, die ganz unten angekommen sind. Die Verurteilten sind das, Marcel. Die, die sie Falschgläubige nennen. Man schleppt sie aus den Kerkern heraus der Menge zum Fraß, sie werden öffentlich erniedrigt, man spricht ihnen von Gott und Menschen aus alle Ehre ab und verbrennt sie dann wie einen Haufen Abfall. Ich war dabei, Marcel, dort in Cavaillon, mein Vater hat mich dazu gezwungen. Es ist abscheulich, abscheulich …“ Nicolas sprang auf und schlug mit seiner Gerte auf einen Feigenbusch ein. Die zerfetzten Blätter flogen auf und wurden auf den Boden geweht.
Marcel war zu ihm getreten. „Lass den Feigenbusch“, sagte er begütigend, „er gibt Feigen. Manche Menschen sind auf den Ertrag angewiesen.“
Nicolas warf die Gerte ins Gras und starrte mit brennenden Augen vor sich hin. „Und dann, Marcel … die Mönche singen das Miserere nobis, erbarm dich unser, o Herr – aber über den Verurteilten erbarmt sich keiner. Und alle, die Priester, die Henker, die Herren, die Knechte, sie alle alle dienen damit dem Höchsten, so sagen sie, dem dies alles wohlgefällig sei.“
Marcel sagte nichts dazu. Ab und zu riss er ein paar Grashalme ab und verrieb die Samen zwischen seinen Fingern. In seiner Ruhe machte er einen abwesenden Eindruck.
„Aber das glaube ich nicht mehr“, schrie Nicolas, „die haben einen anderen Gott als ich.“ Die ganze Bitterkeit der vergangenen Monate überwältigte ihn. Er ballte die Fäuste und schluchzte trocken auf.
Marcel trat an den Rand des Abhangs und wandte seinem Freund den Rücken zu.
„Hörst du mir überhaupt zu, Marcel?“
Marcel nickte wortlos.
„Und mein Vater ist an all dem beteiligt. Verstehst du, ich werde da hineingezwungen, Stück um Stück, und das Studium in Aix gehört dazu und …“
Marcel trat dicht vor ihn und sagte eindringlich: „Dann tu was!“
Nicolas stieß ein höhnisches Lachen aus. „Ich! Was kann ich denn tun!“
Marcel nahm ihn am Arm und sagte leise: „Hör zu. Ich habe ein Mädchen kennen gelernt …“
„Mein Gott!“ Nicolas riss sich los. Ein Mädchen! Eine heiße Welle des Zornes überkam ihn.
Marcel hielt ihn fest. „Hör mir doch erst zu! Ich will dir nicht wieder mit Liebesgeschichten auf die Nerven gehen, es ist etwas anderes. Du musst wissen: Dieses Mal ist es ernst.“
„Meinen Glückwunsch“, sagte Nicolas voller Hohn. Er begann, die ausgetretenen Stufen den Berg hinunterzugehen. Eine ungeheure Enttäuschung war in ihm. Er hat mich überhaupt nicht verstanden. Er versteht nichts. So ist das also, wenn Freundschaft abbröckelt.
„Gehen wir hinunter, du musst zur Arbeit“, sagte er kalt.
„Nicolas, bleib stehen!“ Eine ungewohnte Autorität lag in Marcels Stimme, ein drängender Ernst.
Nicolas wandte sich langsam um. Da stand er, sein Freund vieler Jahre, aber es war nicht mehr der schlichte, unbeschwerte, ein wenig leichtsinnige Kamerad, mit dem er so lange Zeit vertraut gewesen war. Eine neue Ernsthaftigkeit lag auf Marcels Gesicht, eine Härte fast. Er wirkte mit einem Mal um Jahre älter.
„Nicolas, es ist so: Sie heißt Rosette Conte und wohnt in Lacoste. Sie war es, die mich schon etliche Male mitgenommen hat zu einer Versammlung der Waldenser.“
Das letzte Wort hatte eine starke Spannung über sie gelegt.
Nicolas senkte seine Stimme. „Das ist doch diese Irrlehre von Mérindol.“
Marcel schnippte ungeduldig mit den Fingern. „Von der richtigen Lehre weiß ich nicht viel, deshalb kann ich auch mit Worten wie Irrlehre nichts anfangen. Aber der Mann, der gesprochen hat, hat ganz ähnliche Gedanken wie du, Nicolas. Er ist ja auch fast so gebildet wie du. Sagt dir der Name Eustache Marron etwas?“ Nicolas schüttelte den Kopf. „Diese Irrlehre, wie du sagst, würde dir aus dem Herzen sprechen. Warum gehst du das nächste Mal nicht mit? Die Versammlung ist in Roussillon, das ist weit genug entfernt, dass du nicht erkannt wirst.“
Sie sahen sich lange an, wortlos. „Wann?“, fragte Nicolas flüsternd.
„Morgen Abend.“
Einem gemeinsamen Impuls folgend, reichten sie sich die Hände in festem Druck. Das hatten sie noch nie getan. Aber in diesem Augenblick da oben an der alten Kapelle wussten sie, dass etwas anders geworden war in ihrer Freundschaft.
„Die Versammlung ist geheim.“
„Ich weiß, Marcel.“
„Und dein Vater?“
Mit harten Augen sah Nicolas hinüber zum Nordhang, wo der massige graue Turm der Burg Oppède hoch emporragte.
„Mein Vater und ich stehen nicht mehr auf derselben Seite.“