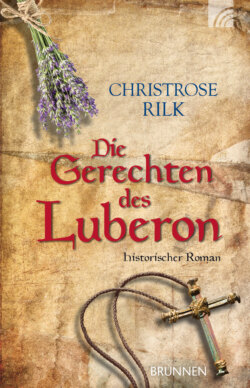Читать книгу Die Gerechten des Luberon - Christrose Rilk - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Familienbilder
ОглавлениеDer Hang war übersät mit kleinen weißen Narzissen. Wenn der Wind darüber strich, war es, als überliefen Wellen die grünweiße, duftende Aue. Unten am Hügel stand ein Mädchen, versunken in entzücktem Schauen. Eine Goldammer flog auf zum hellen Himmel. Das Mädchen kniete nieder zwischen die Flut von Narzissen, vorsichtig, um keine Blume zu knicken. Mit behutsamen Händen strich sie über die Blüten, beugte sich tief hinunter und sog den schweren süßen Duft ein. Es sah aus, als bete sie in demütig konzentrierter Haltung.
Der Boden war feucht und weich. Sie spürte die Nässe an ihren Knien und stand auf. Der Wind von den Höhen des Luberon wehte kühl und in leichten Böen. Sie streifte ihre Haube zurück und ließ ihr Haar im Wind flattern, spürte den erfrischenden Hauch auf ihrem Gesicht. Sie hörte die Hufschläge nicht auf der schmalen Straße.
Der Reiter zügelte sein Pferd und brachte es zum Stehen. Er hatte sie sofort erkannt und sah zu ihr hinüber, lange, als gäbe es nur sie. Eine Erscheinung wie aus einer anderen Welt, so stand sie da inmitten der Blumen, dieses Mädchen. Er nahm diesen Anblick ganz in sich auf; es war ein Augenblick intensiven Erlebens, obgleich er nicht ahnen konnte, dass er dieses Bild sein Leben lang mit sich tragen sollte: ein Meer von weißen Narzissen und dazwischen seine Tochter, mit geöffneten Händen, warmgoldenes Licht im braunen Haar, das Gesicht der Sonne zugewandt.
Er straffte die Schultern und rief sie an: „Cécile!“
Das Mädchen wandte den Kopf, und ein Lächeln trat auf ihre Züge. Sie hob mit beiden Händen ihren Rock an und rannte die Böschung hinauf.
„Papa!“
Er blickte ihr entgegen. Sie sah die Freude auf seinem Gesicht.
„Ich hab dich nicht gesehen. Wenn du jetzt an mir vorbeigeritten wärst!“
Er lachte und zog sie zu sich hoch auf das Pferd. Sie war leicht und elastisch und saß aufrecht vor ihm, wie sie das schon jahrelang zusammen geübt hatten.
„Reiten wir Galopp!“
Er lächelte über die kindliche Fröhlichkeit ihrer hellen Stimme. „Auf gar keinen Fall! Sieh, da sind schon die ersten Häuser. Wir müssen uns gut benehmen, Baronesse.“
Sie wandte ihm ihr strahlendes Gesicht zu. „Jawohl, Herr Vater.“
Sie zog die Haube wieder über ihr schimmerndes Haar und band die Bänder unter dem Kinn fest.
Der Ort Oppède am Nordhang des Luberon lag schon im Schatten. Die Steinhäuser standen in grauer Strenge, überragt von der wuchtigen Kirche auf dem Felsen. Cécile legte den Kopf zurück und schaute hinauf zur Burg. Nur auf dem Bergfried lag noch letzter Sonnenschein.
Die Wächter traten aus dem Torhaus und beugten sich tief. „Guten Tag, Herr Baron. Guten Tag, Mademoiselle.“ Cécile nickte huldvoll, wie sie das gelehrt worden war, aber ihr herzliches Lächeln milderte den Abstand zu den Leuten. Auch sie sah in wohlwollende Gesichter voller Freundlichkeit. Ein paar Kinder winkten ihr zutraulich.
Cécile lehnte den Kopf an ihren Vater. „Papa, hast du mir …“
„Cécile!“, mahnte er.
„Ich meine: Haben Sie mir aus Aix ein Buch mitgebracht, Herr Vater?“
Der Baron d’Oppède nickte.
„Wie heißt es, Herr Vater?“
Er lachte in sich hinein. „Es heißt: Das Leben der heiligen Cäcilie.“
„O nein“, rief Cécile laut, „das kenne ich doch längst. Ach, Papa!“ Dann merkte sie, dass er sich über sie lustig machte und zwickte ihn in den Arm. „Schämen Sie sich, Herr Vater.“
„Nicht so laut, Cécile! Übrigens, du solltest nicht so viel lesen.“
Sie lachte. „Weil ich ein Mädchen bin. Das hast du schon mal gesagt. Aber du hast mir trotzdem ein Buch mitgebracht?“
Jean d’Oppède drückte sie leicht an sich. „Ja.“ Das Burgtor wurde vor ihnen geöffnet, die Wachen salutierten.
Cécile ließ sich elegant vom Pferd gleiten und neigte den Kopf. „Ich danke Ihnen, Herr Vater. Die Frau Mutter wird über Ihr Kommen genauso entzückt sein wie ich.“ Dabei lagen zwei schelmische Grübchen auf ihren Wangen.
Er lächelte beherrscht und warf die Zügel dem Reitknecht zu. Dann nahm er seine Tochter am Arm, und zusammen stiegen sie die breite Treppe zum Wohntrakt hinauf, Jean Maynier d’Oppède, zweiter Baron von Oppède und seine jüngste Tochter Cécile.
Der Baron betrat seine Schreibstube. Vor der Tür stand wartend der Erste Diener.
„Louis.“
Der alte Mann verneigte sich. „Herr Baron.“ Er betrat hinter seinem Herrn den Raum.
Jean d’Oppède fasste ihn scharf ins Auge. „Berichte!“
Louis sagte leise: „Yves, der Pferdeknecht. Er hat abfällig gegen Sie gesprochen, Monseigneur. Und er kam zweimal zu spät zur Arbeit.“
„Er wird entlassen.“
„Sehr wohl, Herr Baron. Des Weiteren wurde der junge Mormas, der Gerber, gesehen im Gespräch mit einer verdächtigen Person aus Lacoste, genauer gesagt mit Paul Conte, der im letzten Winter in Mérindol zur Arbeit war.“
„Weiterhin im Auge behalten. Sonst noch was?“
Der Diener zögerte. „Ihre Frau Gemahlin …“
Jean d’Oppède sagte abweisend: „Das geht dich nichts an.“
„Sehr wohl, Monseigneur. Nein, sonst gibt es nichts weiter Auffälliges.“
„Gut. Du kannst gehen.“
Der Alte verneigte sich und wandte sich zum Gehen.
„Louis.“
„Ja, Herr Baron?“
Jean d’Oppède sah ihn prüfend an und las in dem zerfurchten Gesicht des Dieners eine kaum verdeckte Besorgnis. Sein Misstrauen wurde geweckt.
„Wage es nicht, mir etwas zu verheimlichen!“
„Bestimmt nicht, gnädiger Herr.“ Mit gesenktem Kopf verließ Louis den Raum.
Die Familie saß am großen Tisch beim Abendessen. Die Köchin Louise hatte sich zu Ehren der Heimkehr des Barons besonders viel Mühe gegeben. Jean d’Oppède schnitt ein Stück Lammbraten ab und kostete bedächtig. Er warf der Köchin, die abwartend neben seinem Stuhl stand, einen anerkennenden Blick zu. „Köstlich, Louise!“
Louises vom Herdfeuer gerötetes Gesicht nahm einen stolzzufriedenen Ausdruck an. „Danke, Herr Baron.“ Sie knickste und eilte in die Küche zurück.
„Wie lang ist Louise schon bei uns, Mama?“
Die Baronin blickte erstaunt auf. „Das weiß ich gar nicht genau, Cécile. Ich denke, sie ist länger auf der Burg als ich. Ich glaube, dein Großvater war es, der sie hergebracht hat.“
Jean d’Oppède sah seine Frau bedeutungsvoll an. „Anne!“ Das Wort klang wie ein ausgesprochener Verweis, und die Baronin wurde sofort unsicher.
„Weißt du, Cécile, ich meinte … vielleicht hat auch deine Großmutter …“ Sie verstummte. Der Baron runzelte verärgert die Stirn.
„Warum interessierst du dich so sehr für die Dienstboten, Cécile? Es war so: Louise kam in ihren jungen Jahren hierher in den Dienst, und mein Vater hat sie dann verheiratet mit seinem Kammerdiener Louis.“
Cécile stocherte träumerisch in ihrem Gemüse. „Louis und Louise, das klingt schön. Waren die beiden sehr verliebt?“
Der Baron warf ihr einen misstrauischen Blick zu. „Was hat denn das damit zu tun?“
Unvermittelt sagte die Baronin Anne mit klarer Stimme: „Louise hat einen Vater für ihr Kind gebraucht. Aber es starb dann kurz nach der Geburt.“
„Die arme Louise!“ Cécile war voller Mitgefühl. „Das wusste ich gar nicht.“
Der Baron sah missbilligend zu seiner Frau hinüber. Ihr Gesicht war ruhig, und sie senkte die Augen nicht vor seinem Blick. Er zuckte die Achseln.
„Wie dem auch sei“, sagte er streng, „die persönlichen Verhältnisse der Knechte sind kein Thema für uns.“ Er wandte sich seinem Sohn zu, der neben ihm saß. „Was mich interessiert, Nicolas: Wie sind deine Prüfungen ausgefallen?“
Nicolas blickte kaum auf vom Teller. „Gut.“
„Warum so einsilbig? In welchen Fächern hast du am besten abgeschnitten?“
Nicolas sah mit düsterem Blick vor sich hin und schwieg.
Cécile antwortete für ihn. „Er hat in Latein und Griechisch eine Auszeichnung bekommen und auch in Alter Geschichte. Monsieur Castagne sagt, Nicolas weiß einfach alles, er könnte in diesen Fächern ohne Mühe mit den Studenten höheren Semesters auf der Universität in Aix konkurrieren.“
Jean d’Oppède legte seinem Sohn wohlwollend die Hand auf den Arm. „Das freut mich sehr, Nicolas. Dann wird dir auch das Studium der Jurisprudenz keine Mühe machen. Denn alte Sprachen und Geschichte – das ist ja ganz schön, aber damit kann ein junger, aufstrebender Mann von Adel nicht gut Karriere machen. Du sollst schließlich kein Stubengelehrter werden, sondern zu gegebener Zeit einmal das politische Leben unseres Staates an entscheidender Stelle mitgestalten. Dein Großvater war ein bedeutender Jurist, und auch ich habe, wie du weißt, auf diesem Gebiet einige Verdienste aufzuweisen. Du studierst also Jura, mein Sohn.“
Nicolas zerkrümelte ein Stück Brot zwischen den Fingern. „Ich studiere Jura, was denn sonst.“
Ein verzweifelter Unterton in seiner Stimme ließ die Mutter aufhorchen. Sie legte die Hand auf seine und suchte seinen Blick. „Nicolas …“
Er sah sie schweigend an. Er hatte dieselben hellen Augen wie sie. Sie suchte nach Worten, aber er zog seine Hand zurück und stand auf.
„Kann ich gehen?“
Der Baron sah wohlgefällig auf seine Familie und sagte aufgeräumt: „Ich dachte, wir treffen uns nachher in der Bibliothek, und ich lese euch wieder einmal vor. Diesmal habe ich für euch das neue Schauspiel des Grafen Lusignan mitgebracht, das letzten Monat in Aix zur Uraufführung gekommen ist. Interessiert dich das, Nicolas?“
Der Junge zuckte die Achseln. „Ich bin verabredet.“
Nach einer fast unmerklichen Pause sagte der Vater ruhig: „Es ist gut, mein Sohn.“ Er versuchte, sich seine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen.
Grußlos verließ Nicolas den Raum.
Der Baron sah seine Frau an. „Ist er wieder mit diesem Gerbersohn unterwegs?“ Widerwillen stand auf seinem Gesicht. Niemand antwortete.
„Und du, Claire?“ Er wandte sich an seine ältere Tochter, die die ganze Zeit schweigend und wie abwesend dagesessen hatte.
Claire antwortete freundlich: „Mir macht es nichts aus, Herr Vater, wenn Sie lesen möchten. Ich kann sowieso nicht gut zuhören, denn meine Handarbeit erfordert viel Aufmerksamkeit.“
Der Vater sah ihr ins Gesicht. „Was interessiert dich überhaupt, Claire?“
Sein Ton war scharf geworden, aber sie lächelte ihm in kühler Höflichkeit zu. „Die Bücher in unserer Bibliothek sind sicher alle interessant und lehrreich, Herr Vater.“
„Aber lesen willst du nicht darin.“
Sie überhörte den spöttischen Ton. „Ich muss mich auf meine Heirat einstellen, Herr Vater. Es ist noch viel vorzubereiten.“
Die Baronin sagte schnell: „Natürlich, Claire, mein Kind.“ Sie sah auf das hübsche, helle Gesicht ihrer Tochter und überlegte, dass dieses erstgeborene Kind nie Schwierigkeiten gemacht hatte. Immer hatte Claire alles hingenommen und fraglos getan, was man ihr gesagt hatte. So hatte sie im letzten Jahr ohne Zögern eingewilligt in die Verlobung mit ihrem Vetter, dem jungen Baron von Lauris. Seitdem überwachte sie gewissenhaft die Anfertigung ihrer Aussteuer und stickte mit ausdauernder Sorgfalt an leinenen Tischtüchern. Sie war so anders als ihre beiden jüngeren Geschwister.
Einem plötzlichen Impuls gehorchend, griff die Baronin nach der Hand ihrer Tochter. „Heiratest du ihn nicht gern, Claire?“
Ein Anflug von Verwunderung trat nun auf die ebenmäßigen Züge ihrer Ältesten. „Aber doch, Mutter. Ich habe nichts dagegen, zu heiraten.“ Sie stand auf, knickste vor ihren Eltern und schritt anmutig aus dem Raum. Cécile begann zu lachen.
„Was ist denn jetzt wieder?“, fragte der Vater ungehalten.
Cécile sprang von ihrem Platz auf und lief um den Tisch herum, trat hinter seinen Stuhl und legte die Arme um ihn. „Armer Papa! Sie liest dir zu wenig, und ich lese dir zu viel. Kann man es dir recht machen? Weißt du, du musst einfach den Durchschnitt nehmen, dann kannst du zufrieden sein mit deinen Töchtern.“ Sie schmiegte ihre Wange an sein bärtiges Gesicht.
Er strich ihr leicht übers Haar. Dieses Kind! Aber sie hatte ihn wieder zum Lächeln gebracht. Er stand auf. „Dann lese ich euch beiden vor. Gehen wir also.“
Cécile lief voraus. „Ich zünde schon die Kerzen an.“
Die Bibliothek war ein hoher Raum mit schönen Proportionen. Dicke alte Folianten standen auf schweren Regalen bis zur Decke, aber der Baron Jean d’Oppède sorgte stets dafür, dass die Sammlung auch mit Neuerscheinungen der anerkannten Autoren gut ausgestattet war. Cécile liebte den zarten Geruch von Talg und Staub der alten Bücher und die gefasste Ruhe, die sie zu atmen schienen. Zu diesem Raum gehörte auch das milde Licht der Kerzen auf hohen Leuchtern und die genussvolle Erwartung, die sie jedes Mal überkam, wenn ein neues Werk aufgeschlagen wurde. Der alte Diener Louis hatte schon alles hergerichtet, die leise knackende Glut im Kamin und die bequemen Lederstühle. Cécile kuschelte sich in einen der mächtigen Sessel und wartete auf ihre Eltern. Sie hörte ihre vertrauten Stimmen an der Tür.
„… dass endlich etwas geschehen muss. Weißt du, Anne, es ist immer wieder dieses Mérindol, immer wieder dieser Ort.“ Sie traten miteinander ins Zimmer.
„Mérindol, Mérindol, du Stadt auf dem Berge, o mein Jerusalem …“, sang Cécile leise vor sich hin.
Mit schnellen Schritten war Jean d’Oppède bei ihr, fasste mit beiden Händen die Armlehnen ihres Sessels und sagte scharf: „Woher kennst du dieses Lied?“
Cécile zögerte. „Ich hab es mal gehört. Es hat eine hübsche Melodie …“
Er schnitt ihr das Wort ab. „Wo hast du es gehört, wo?“
„An verschiedenen Orten“, sagte Cécile vorsichtig. „Ich weiß nicht mehr, wo.“
Sie sah erschrocken, dass ihr Vater bleich geworden war vor Zorn und dass seine dunklen Augen finster blickten.
„Ich will diesen Singsang nie mehr hören in diesem Hause. Hast du mich verstanden?“
Cécile senkte den Kopf. „Ja, Herr Vater.“
„… wie Seine Majestät unser Herr König François I. im Februar 1541 mit eigener Hand …“ Der Parlamentssekretär hielt mit gewichtiger Miene das Dokument in seinen Händen. Er las schleppend mit unangebrachten Pausen. „… und so vergeben wir den Abtrünnigen ihre Vergehen gegen die heilige allgemeine Kirche. Wir üben Barmherzigkeit und setzen alle Verurteilungen aus, die das Parlament der Provence in Aix über sie verhängt hat, vorausgesetzt, dass innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses Gnadenerlasses die Falschgläubigen ihren Irrtümern absagen und abschwören und versprechen, katholisch zu leben …“
Jean Maynier d’Oppède hörte mit wachsender Ungeduld der eintönigen Stimme des Advokaten Guérin zu, der mit unbewegtem Gesicht den königlichen Gnadenerlass verlas. Die Falschgläubigen können sich freuen. Wieder einmal gehen sie gerechtfertigt davon. Denn wo es keine Strafe gibt, nimmt man auch das Vergehen nicht ernst. Der Baron war empört. Spottlieder gegen die heilige Kirche, Widerstand gegen die Staatsgewalt, gewaltsame Gefangenenbefreiung, Beleidigung der Priester … was soll denn alles noch geschehen dürfen, dass die Abtrünnigen endlich ihre gerechte Strafe erhalten!
„… und so wird gemäß des königlichen Erlasses das Gnadenedikt veröffentlicht durch mündliche Bekanntmachung in den Orten Mérindol, Lourmarin, Cabrières, St. Martin …“ Jean d’Oppède ballte seine Hände zu Fäusten. Das ist nicht die Gerechtigkeit, die die Ketzer verdienen. Er hob die Hand.
„Der Baron von Oppède erhält das Wort.“ Die Stimme des Präsidenten Barthélemy de Chassanée verbarg nicht seinen Widerwillen. Mit offensichtlicher Abneigung musterte er die hagere Gestalt des Barons, als ob er schon wüsste, was dieser Oppède jetzt vorbringen würde.
„Herr Präsident, hohes Parlament, ich gebe zu bedenken, ob es nicht klug wäre, diesen Gnadenerlass zunächst nicht zu veröffentlichen. Die Falschgläubigen könnten sich zu sicher fühlen.“
Der Präsident Chassanée sah aus dem Fenster. Der Himmel über Aix war in Unruhe, jeden Augenblick gab es Veränderungen. Jetzt sah er in kaltes Blau, aber von Westen umzog sich der Horizont zusehends, und grauweiße Wolkenfetzen jagten heran, Sturmboten.
„Monsieur“, sagte er abweisend, „als Präsident dieses hohen Parlaments und Spruchkammer der Provence muss ich Sie darauf hinweisen, dass der Gnadenerlass unseres Herrn König laut Ordonnanz vom 28. Februar alsbald zu veröffentlichen ist. Eine Einrede ist nicht möglich, wie Sie wohl wissen.“ Dabei sah er dem Baron mit kaltem Blick entgegen. Dann wandte er sich ab und gab mit müder Handbewegung das Zeichen, den Text weiterzulesen.
Der Baron d’Oppède fühlte sich gedemütigt. Er wusste, dass sehr wohl ein Handlungsspielraum für die Spruchkammer bestanden hätte. Und in der gewonnenen Zeit hätte man neue Verhandlungen in Gang setzen können. Die Ketzer mussten ja mächtige Fürsprecher am Königshof haben. Aber keiner der Räte schien sich darüber aufzuregen. Waren sie denn blind für das, was am Luberon im Gang war? Die heilige allgemeine Kirche war dabei, Schaden zu erleiden. Ungebildete Bauern maßen sich theologische Urteile an. Alles nur ein Deckmantel für Rebellion gegen die Fundamente der Kirche mitsamt dem Staat. So weit ist es gekommen! Mit Härte durchgreifen – warum verstehen diese verweichlichten Herren das immer noch nicht! Die verstricken sich noch bis zur Handlungsunfähigkeit in ihren diplomatischen Fäden, und die Zukunft der Region wird verschlossen. Niedergeschlagen starrte Jean d’Oppède vor sich hin.
Als er nach der Sitzung allein den langen Gang des Justizpalastes hinunterging, fasste ihn jemand leicht am Arm. „Messire?“ Der Baron sah eine wohl bekannte Gestalt in brauner Kutte, Pero Gelido, Mönch und Vertrauensmann des päpstlichen Legaten. Er misstraute diesem kleinen, dunklen Mann. Er wusste nie so recht, in welcher Funktion der auftrat, als Unterhändler oder Priester, als Ratgeber oder als kirchlicher Beobachter. Er verbeugte sich kühl.
Pero Gelido hatte eine sehr klare, leise Stimme. „Gehen wir den Gang auf und ab!“ Er sagte es beiläufig, aber es klang wie ein leiser, scharfer Befehl. „Ich habe Ihren Vorschlag in der Sitzung mit Interesse gehört. Finden Sie, es wäre günstig, das Amt eines zweiten Parlamentspräsidenten zu schaffen? Die Aufgaben sind immens. Ein zweiter Präsident könnte Entscheidungen des amtierenden Vorsitzenden mit vorberaten. Und sollte der Präsident, aus welchen Gründen auch immer, indisponiert sein, könnte der zweite Präsident ihn vertreten. Was meinen Sie?“
Der Baron nickte. Er hatte keine Ahnung, worauf der andere hinauswollte.
„Bischof Trivulce, der päpstliche Vizelegat, hat von Ihrer Treue zu unserer heiligen Kirche gehört. Er ist sehr angetan, Herr Baron, dass Sie damit in die Fußstapfen Ihres Herrn Vaters, des Baron Accurse d’Oppède treten. Wir in der Provence brauchen ein Parlament, das sich neben der Ergebenheit unserem Herrn König gegenüber ebenso stark den Interessen unserer heiligen katholischen Kirche verpflichtet weiß und die Rechte der Kurie wahrzunehmen vermag. Sie, Herr Baron, haben es diesbezüglich an Zeichen nicht fehlen lassen. Der Vizelegat spricht Ihnen durch mich seine Anerkennung aus.“
Der Baron verbeugte sich. „Ich halte mich in der Tat für einen treuen Sohn unserer Mutter Kirche.“
Der Mönch dämpfte seine Stimme noch mehr. „Messire, Sie wären gut geeignet für das Amt eines zweiten Präsidenten. Auch der Bischof von Apt ist dieser Ansicht.“
Mit freudigem Herzklopfen murmelte der Baron: „Es wäre mir eine große Ehre.“
Pero Gelido blieb stehen. Sein spöttischer Blick umfasste sein Gegenüber, dem Stolz im Gesicht stand und hoffnungsvoller Ehrgeiz. Er lächelte in sich hinein. Laut sagte er: „Ich sehe, Baron, wir verstehen uns“, und wandte sich zum Gehen.
Jean d’Oppède hielt ihn zurück. „Aber der Parlamentspräsident, Monsieur de Chassanée, wird nie zugeben, dass ich sein Vertreter werde. Und seine Anhänger im Parlament …“ Er brach ab, als er das kalte Lächeln des Mönches sah.
„Monsieur de Chassanée ist nicht gesund, Baron. Wir können nicht in die Zukunft sehen, die der Allmächtige uns verborgen hat.“
Er drehte sich um und ließ den Baron erstaunt zurück. Von einer Krankheit Chassanées war noch nie die Rede gewesen, und heute hatte der Präsident durchaus im Besitz seiner Kräfte gewirkt. Ein leises Gefühl der Unruhe beschlich ihn, er unterdrückte es. Zweiter Präsident des Parlaments – das wäre ein großer Schritt nach vorn. Und Chassanée ist ja wirklich nicht mehr der Jüngste. Der Mönch hat Recht, wir können nicht in die Zukunft schauen, aber vielleicht tun sich für mich ungeahnte Möglichkeiten am Horizont auf?
Nicolas d’Oppède klopfte seinem Pferd zärtlich den Hals. Er fasste mit der Hand in die derbhaarige, braune Mähne und spürte die Wärme und Lebendigkeit an seinen Fingern. Der Braune stampfte vorsichtig mit den Hufen und zeigte, dass er mit seinem Herrn hinauswollte. Bedauernd zog Nicolas die Hand zurück. „Du musst hier bleiben.“ In der Box daneben schnaubte der Rappe und schlug mit dem Huf gegen die Zwischenwand. „Ich werde ihn nehmen“, murmelte Nicolas, „er muss sich ja an mich gewöhnen.“
Da hörte er den Pfiff, dreimal kurz, einmal lang. Er trat schnell hinaus vor die Stalltür. Es war wirklich Marcel. Breitbeinig stand er im inneren Burgtor mit seinen lachenden Augen und seinem lockigen Haar.
Nicolas freute sich. „Du bist schon zurück?“
Marcel stieß ihn freundschaftlich in die Seite. „War kein Problem. Ich hab die Abkürzung über den Aiguebrun genommen, das Flussbett ist fast ausgetrocknet.“ Er zeigte Nicolas einen schwer gefüllten, alten Lederbeutel. „Alle Ware verkauft! Den Rest des Tages hab ich frei. Hast du Zeit?“
Nicolas nickte. „Ich wollte gerade einen Ausritt machen. Willst du meinen Braunen reiten?“ Sie gingen hinein in den Stall.
Marcel pfiff zwischen den Zähnen. „Gehört der deinem Vater?“ Wie gebannt starrte er auf den Rappen, der jetzt ungeduldig an die Holzwand schlug.
„Es ist meiner.“ Nicolas war verlegen. „Mein Vater hat ihn mir geschenkt, weil ich ja demnächst nach Aix gehe, zum Studium.“
Marcel nickte spöttisch. „Zum Neidischwerden! Der Herr Sohn kriegt ein neues Pferd, einfach so.“
„Ach komm“, Nicolas nahm ihn begütigend am Arm, „du nimmst den Braunen, und unterwegs tauschen wir.“
Sie sattelten die beiden Pferde und schwiegen eine Weile. Eine steile Falte stand zwischen Marcels Brauen. Der Verdienst auf dem Markt in Lourmarin war außergewöhnlich gut gewesen. Aber es würde sehr viele solcher Tage brauchen, um sich so ein Pferd leisten zu können. Und vorher wäre da immer etwas anderes, Nötigeres, das bezahlt werden musste. Nicolas las seinem Freund die Gedanken vom Gesicht ab. Immer wieder gab es solche Augenblicke, in denen ihnen beiden bewusst wurde, welch tiefe Kluft doch zwischen ihnen lag. Er, der Erbe des Adelshauses Maynier d’Oppède und Marcel Mormas, der einfache Gerbersohn aus dem Ort Oppède – und doch waren sie Freunde. Würde es so bleiben können?
Als sie die Pferde den Burgsteig hinabführten, sagte Marcel plötzlich: „Kannst du hier einen Augenblick warten, Nicolas? Ich muss erst meinem Vater das Geld bringen.“
Nicolas war erstaunt. „Aber wir können doch an eurem Haus vorbei und dann über die Heide reiten.“
Marcel warf ihm einen unbehaglichen Blick zu. „Mein Vater wird immer böse, wenn er mich mit dem Herrensöhnchen – damit meint er dich – gesehen hat. Ich hab keine Lust, mir sein Sticheln anzuhören. Bleib hier, es dauert bestimmt nicht lang.“ Schnell bog er um die Ecke.
Nicolas blickte über die grauen Häuser Oppèdes, am Hang zusammengedrängte Würfel aus Feldsteinen. Die Geschäftigkeit der Menschen, die ihm alle wohl bekannt waren, der Geruch von Holzfeuer und Schweinemist, der würzige Duft der Wiesen am Hang, das Singen der Vögel in den Hecken am Weg – all dies Heimatliche, Gewohnte, Sichere würde er bald hinter sich lassen und in der Großstadt Aix ein ganz neues Leben beginnen. Eine Beklommenheit legte sich auf ihn, für die er sich den Grund nicht eingestehen wollte. Denn all die vergangenen Monate hatte der Name Aix für ihn Freiheit und Ungebundenheit bedeutet – und die lang ersehnte Selbstbestimmung. Doch seit kurzem hatte sich eine neue, bittere Erkenntnis über die Vorfreude gelegt. Als er Marcel zurückkommen sah, fasste ihn zusätzlich ein leichter Schrecken. Was würde Aix für ihre Freundschaft bedeuten? Nicolas forschte nach Zeichen der Entfremdung im Gesicht des Freundes. Aber Marcel war zu ihm so herzlich wie immer.
„Reiten wir nach Lacoste?“, rief er Nicolas zu, und ohne die Antwort abzuwarten, sprang er in den Sattel und lenkte den Braunen in Richtung des Hohlweges. „Am Wegkreuz tauschen wir.“
Der Hohlweg war eng und steinig, Nicolas musste den Rappen hart zügeln. Er spürte die kaum zu bändigende Vitalität des jungen Tieres, sein ungestümes Drängen und seine Lust zur Bewegung. Und mit einem Mal sah er in dem Schwarzen so etwas wie eine Ähnlichkeit zu sich selbst: Auch er war ungeduldig darauf, wegzukommen aus der Enge seiner bisherigen Umgebung; auch er verspürte ein drängendes Sehnen nach Freisein und ahnte etwas von der Lebenslust, die mit dem Lösen der familiären Zügel aufkommen könnte. Die Weite des Lebens kam ihm so zum Greifen nahe vor wie die freie Heide hinter dem engen Hohlweg.
Und da waren sie schon, Nicolas ließ den Rappen endlich sich frei auslaufen. Er genoss das Vorbeizischen des Windes, die freigelassene Kraft des Pferdes, zwischen seinen Beinen den Rhythmus der ungebändigten Bewegung. Etwas Wildes sprang an in ihm, wie ein glühender Funke. Er duckte sich dicht an den Pferdeleib und flog in jagendem Galopp über die Heide, losgelöst von aller Schwere und Bindung. Er warf den Kopf zurück und stieß einen Schrei aus. Lust lag darin und Sieg und Befriedigung und eine ungestillte Sehnsucht nach der Weite des Lebens.
Am Kreuzweg zog er hart den Zügel an. Das Pferd kam widerstrebend und vor Ungeduld bebend zum Stehen. Von der Felsengruppe am gegenüberliegenden Berghang stieg ein Adler auf. Nicolas folgte ihm mit den Augen. Oppède, diesen Adlerhorst am Nordhang mit seinen kalten Mauern, den lasse ich bald hinter mir. Wenn ich doch auch so frei sein könnte wie ein Adler im Flug!
Marcel auf dem Braunen kam durch die Mulde geritten. „Bist du schnell gewesen, Nicolas! Ich habe euch gar nicht mehr gesehen.“ Er sprang ab und klopfte dem Braunen den Hals. „Können wir jetzt tauschen?“
Nicolas nickte und überließ den Rappen seinem Freund. „Aber sei vorsichtig. Er ist wild.“
Marcel lachte. Fest griffen seine Hände die Zügel, das Pferd reagierte sofort auf seinen Schenkeldruck. Sie jagten über die Heide, und Marcel duckte sich in die fliegende Mähne des Tieres.
Nicolas sah ihm nach. Der Rappe passt besser zu ihm als zu mir. Immer war er der Ungestümere, Kräftigere und auch der Unbeschwertere. Quälende Bedenken und Grübeleien sind ihm fremd. Er lebt einfach leichter. Vielleicht ist er die hellere Hälfte in unserer Freundschaft im Gegensatz zu mir. Ich werde ihn sehr vermissen … Marcel Mormas, den Gerbersohn aus Oppède, meinen einzigen Freund.
„Dich auch, du“, sagte er zu dem Braunen und legte die Stirn an den warmen Pferdehals.
Marcel sprengte heran. Noch bevor der Rappe tänzelnd zum Stillstand gekommen war, sprang er aus dem Sattel. „Unglaublich! Herrlich!“ Jauchzend reckte er ein paar Male seine Faust zum Himmel voller Begeisterung. „Ich beneide dich, Nicolas.“ Sie banden die Pferde an einen Baum und rieben sie ab. „Diese Muskeln!“ Bewundernd fuhr Marcel mit beiden Händen über den glänzenden Leib des Rappen. „Hast du ein Glück!“
Nicolas lächelte. „Ich weiß, er passt eigentlich eher zu dir als zu mir.“
Marcel verzog das Gesicht. „Er passt zu einem Herrn, nicht zu einem Knecht.“
„So hab ich uns beide nie gesehen, Marcel.“
Der nickte zustimmend. „Weiß ich doch. Aber warte noch ein paar Jahre, dann bist du der Herr, und ich sehe dich von weitem, wenn du von deinen hohen Ämtern in Aix oder in Avignon zurückkehrst, und wenn du an mir vorbeikommst, verbeuge ich mich: Guten Tag, Herr Baron, danke verbindlichst, sehr gütig, Herr Baron …“
„Hör auf!“ Nicolas spürte, wie ihm eine zornige Röte ins Gesicht stieg.
Marcel schwieg und starrte vor sich hin. Als er sich seinem Freund zuwandte, war alles Lachen aus seinem Gesicht wie weggewischt. „Und du, was meinst du, wie es weitergeht mit uns beiden?“
Die Frage blieb unbeantwortet in der Luft hängen. Über den hellen Tag war plötzlich ein Schatten gefallen.