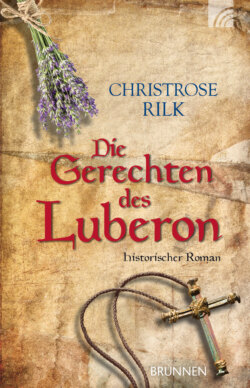Читать книгу Die Gerechten des Luberon - Christrose Rilk - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Stadt des Feuers
ОглавлениеJean d’Oppède nahm erleichtert zur Kenntnis, dass sich dieses Mal sehr viele Menschen eingefunden hatten zur Ketzerverbrennung. Obwohl erst letzte Woche ein Scheiterhaufen gebrannt hatte, mangelte es nicht an Zulauf. Sie sehen es ein, dachte er, endlich erkennen sie, dass es sie alle angeht. Ja, da müssen wir durch, wir, die wir Christen heißen. Das muss mitgelebt und mitgetragen werden, da gelten keine Ausflüchte.
Seht es euch nur an, seid dabei, wenn die Flammen emporzüngeln, die Leiber sich krümmen vor der Gluthitze … Schmerzgebrüll … sengende Haare und platzende Haut … und die reinigenden Flammen, Feuer des Gerichts, heilige, verzehrende Glut der Läuterung. Seht hin, ihr Unmündigen, dass es euch die Qual des Fegefeuers abkürze, dass ihr euch hütet vor der Irrlehre, dass ihr der unerbittlichen Strafe entgeht.
„Judex ergo cum sedebit
quidquid latet apparebit
nil inultum remanebit.“
Die Mönche von St. Veran hatten begonnen, die Sequenz zu singen, und Jean d’Oppède flüsterte die Worte mit: „Sitzt der Richter dann zu richten, wird sich das Verborgne lichten, nichts kann vor der Strafe flüchten.“
Ihre klingenden Stimmen kämpften gegen das aufpeitschende Kreischen junger Leute an; trotzdem war als dritte Stimme nicht zu überhören das wimmernde Schluchzen der Frauen, die dicht gedrängt unten an der Tribüne standen. Ihrer Tracht nach mussten es Dorfleute vom Luberon sein, Angehörige des Verurteilten wahrscheinlich.
Die Gesichtszüge Jean d’Oppèdes verhärteten sich. Da müssen sie durch, gnadenlos. Es wird sie zur Besinnung zwingen, dass sie sich abkehren von der Irrlehre.
„Es geht doch nichts über die abschreckende Wirkung des Scheiterhaufens“, sagte eine sonore Stimme hinter ihnen.
„Zwar nicht würdig ist mein Flehen, doch aus Gnaden lass geschehen, dass ich mög der Höll entgehen“, sangen die Mönche, und ein Gefühl großer Demut überkam den Baron. Der Allgewaltige würde hinsehen auf ihn und seine Familie. Nie sollte ein Mitglied des Stammes Maynier d’Oppède aus dem großen Schutzraum der heiligen allgemeinen Kirche ausbrechen in den Wahn der Irrlehre. Auch mein geliebter Sohn Nicolas nicht. Er soll die Fackel der Hingabe weitertragen, ein würdiger Kämpfer im heiligen Krieg. Er sah seinen Sohn von der Seite an. Fühlte er jetzt auch die Erhabenheit des Augenblicks angesichts des lodernden Feuers der Reinigung?
Nicolas saß zusammengesunken auf dem Platz neben seinem Vater. Er hatte die Ellbogen auf die Knie gestemmt und den Kopf in die Hände gestützt. Sein dunkles Haar fiel ihm über die Stirn. Als habe er den Blick seines Vaters gespürt, wandte er ihm sein Gesicht zu; es war von einer erschreckenden Blässe.
„Nicolas, halte dich aufrecht!“, stieß der Baron leise hervor. Sein Sohn sah ihn mit leerem Ausdruck an und reagierte nicht.
Eine Reihe vor ihnen saß der Marquis de la Fare mit seinem kleinen Sohn.
„Papa“, rief das Kind, „ich kann aber gar nichts sehen.“
Der Marquis wandte sich um zu Nicolas und fragte höflich: „Erlauben Sie, junger Herr, dass mein Sohn sich auf die Bank stellt? Dass er das schöne Feuer sehen kann, in dem der Ketzer brennt.“
Nicolas starrte ihn an und nickte.
„Verbindlichen Dank, junger Herr.“ Das Kind kletterte auf die Bank. „Jetzt kann ich alles sehen“, rief es fröhlich und klatschte in die Hände.
Plötzlich sprang Nicolas auf, blieb einen Augenblick schwankend stehen, zwängte sich dann ungestüm durch die enge Reihe und trat dabei rücksichtslos auf fremde Füße. Ein unwilliges Murmeln begleitete ihn. Sein Vater folgte ihm beunruhigt.
„Nicolas!“ Jean d’Oppède griff nach seinem Arm. „Bist du verrückt geworden?“
Nicolas schüttelte ihn ab und drängte jeden beiseite, der ihm im Weg war. Er bahnte sich mit Ellenbogen einen Durchgang die Stufen hinunter auf den Platz, drängte, schob, stieß weg. Niemand, der in sein Gesicht blickte, widerstand seiner verzweifelten Gewalttätigkeit. Als ob er sich durch die Fluten der Durance kämpfte, schoss es seinem Vater in den Sinn. Nicolas stemmte sich gegen die wogende Masse der erhitzten Leiber, gegen den üblen Atem der aufgerissenen, schreienden Münder.
Auf dem Kirchplatz war das Gedränge noch beengender. Ein Schrei brandete auf aus der Menge, einige klatschten Beifall.
„Der Ketzer hat keine Beine mehr“, brüllte ein schwitzender, grobschlächtiger Mann. Nicolas fuhr zurück vor dem weit aufgerissenen, geifernden Maul. Dann hob er die Faust und schlug sie hinein in die höhnische Fratze, sah mit wilder Lust das Blut aus der Nase schießen; da fasste ihn sein Vater hart am Arm, zog ihn weg und stieß ihn vorwärts.
Nicolas keuchte wie unter großer Anstrengung. Nun noch vorbei an den schluchzenden Frauen an der Ecke mit ihren grauen Kleidern und grauen Gesichtern, die auf ihn zuschwammen wie bleiche Wasserrosen. Endlich waren sie am Klosterhof. Nicolas rang nach Luft, stützte eine Hand auf die grauen Mauersteine, würgte und erbrach sich.
Der Baron stand peinlich berührt neben ihm und blickte unruhig nach beiden Seiten. „Bist du krank?“
Nicolas hörte ihn nicht. Der blutrünstige Schrei der Menge gellte noch in seinen Ohren, drang ein in sein wehrloses Inneres und füllte es aus. Es war ihm, als müsse er sich die Seele aus dem Leib kotzen.
„Miserere nobis, erbarm dich unser, o Herr.“ Der Gesang der Mönche erschien ihm jetzt als lästerlicher Missklang. Er hob beide Hände an die Ohren und ging schwankend einige Schritte abseits. Dann sackte er auf dem Boden zusammen. Er sah nicht das angewiderte Gesicht seines Vaters. Er starrte auf das Pflaster des Klosterwegs; eine zertretene, verwelkte Blüte lag auf dem Boden neben einem Haufen Hundedreck. So saß der junge Herr Nicolas Maynier d’Oppède im Staub der Gasse, und sein fahles Gesicht glänzte vor Schweiß.
„Hier“, sagte sein Vater knapp und reichte ihm ein weißes, frisch gebügeltes Tuch, „säubere dich! Und nimm dich zusammen!“
Ein Mönch kam durch den Torbogen und blieb stehen. Er erkannte den Baron und verbeugte sich. „Kann ich Ihnen behilflich sein, Messire?“
„Ein Becher Wasser“, sagte der Baron kurz. Der Mönch eilte in den Klosterhof.
„Ausgerechnet jetzt“, murmelte Jean d’Oppède ärgerlich. „Kannst du nicht wenigstens aufstehen!“
Der Mönch kam mit einem Becher Wasser zurück und reichte ihn dem Jungen. In seinen Augen stand Mitleid. „Gleich wird es Ihnen besser sein, junger Herr. Alles muss verkraftet werden, nicht wahr?“
Der Baron machte eine abwehrende Bewegung. „Zu viel gezecht gestern Abend, das ist es. Ja ja, die Jugend!“
Der Mönch schwieg.
Nicolas umklammerte den kühlen Becher und starrte auf die reine Klarheit des Wassers. Er stöhnte auf. Der Mönch beugte sich nieder zu ihm und führte ihm den Becher an die zitternden Lippen. Nicolas trank in tiefen Zügen.
„Danke“, sagte er stockend; und als er in das gütige, alte Gesicht sah, stiegen ihm die Tränen in die Augen. Der Mönch drückte sanft seine Schulter, und der Junge empfand die tröstende Berührung wie ein Geschenk. „Danke“, sagte er noch einmal.
„Der Herr sei mit dir, mein Kind“, flüsterte der alte Ordensmann und machte das Kreuzeszeichen über dem Jungen.
„Lass uns gehen“, drängte der Baron.
Nicolas sah seinen Vater an wie einer, der aufwacht aus tiefem Schlaf. Er sah die blank geputzten Schuhe, den tadellosen Sitz seines Anzugs; sein Blick blieb eine Weile lang haften an der weißen Manschette, der ruhigen Hand, und er dachte an die Unterschrift seines Vaters auf den Urteilen, Todesurteilen …
Jean d’Oppède wartete eine Weile ab. Dann sagte er in bestimmtem Ton: „Bist du jetzt fähig zu gehen?“
Nicolas nickte. Er stand auf und fuhr sich mit den Händen durch sein Haar.
Sein Vater musterte ihn prüfend von oben bis unten. „Wir sind beim Bischof eingeladen zum Mittagessen. Du solltest dich vorher noch frisch machen und deinen Anzug bürsten lassen. Am besten, wir gehen jetzt zur Herberge …“
„Nein!“ Es war wie ein Aufschrei.
„Was soll das heißen?“
„Das soll heißen, dass ich nicht mitgehe. Ich geh nicht mit. Geh du allein ins Palais oder mach, was du willst …“
Jean d’Oppède schlug ihm den Handrücken ins Gesicht. „Du verlierst jede Haltung. Mäßige deine Stimme und begegne deinem Vater mit der schuldigen Achtung!“
Nicolas presste die Lippen zusammen und verschränkte die Hände auf dem Rücken.
Der Baron sagte kalt: „So wie du aussiehst, ist es vielleicht wirklich besser, du gehst nicht mit. Ich werde dich entschuldigen müssen. Du hast nun einige Stunden Zeit, um dein Verhalten zu überdenken. Du kannst dich ja am Ufer der Durance aufhalten, die frische Luft wird dir wohl gut tun. Sei aber pünktlich um fünf Uhr am westlichen Stadttor.“
„Ja, Herr Vater.“
Der Baron konnte den Blick nicht deuten, mit dem sein Sohn ihn ansah. Ein Sichabwenden lag darin, ein Aufgeben fast. Die Enttäuschung schnürte ihm die Kehle zu. Kein hoffnungsvoller junger Herr stand vor ihm, sondern einer, der die Zeichen der Niederlage an sich trug. Ein Sohn, auf den man nicht stolz sein konnte.
Brüsk wandte sich Jean d’Oppède ab und ließ seinen Sohn an der grauen Klostermauer unter der sengenden Sonne stehen.
Auf einer Anhöhe zügelte der Baron sein Pferd und sprang aus dem Sattel. Hinter ihnen lag die Ebene der Durance, der Fluss schimmerte wie ein breites, silbernes Band. Vor ihnen stand das Bergmassiv des Luberon im milden letzten Sonnenlicht. Die Schatten zeigten die Konturen der Höhenzüge in bläulichem Licht.
„Nicolas“, rief Jean d’Oppède, „hier mache ich immer einen kurzen Halt, hier auf der Höhe über Cavaillon.“ Er schlang die Zügel um einen niedrigen Baum und verharrte im Anblick der Stadt zu ihren Füßen. Die späte Sonne ließ die Ziegeldächer rot aufleuchten.
Auch Nicolas war vom Pferd gestiegen. „Rot wie das Feuer“, murmelte er, „die Stadt des Feuers.“ Der Baron sah nicht den Ausdruck des Abscheus auf dem Gesicht des Jungen. Er nahm ihn am Arm und deutete hinüber zur Kathedrale.
„Cavaillon“, sagte er mit bewegter Stimme, „keine große Stadt. Aber eine Stadt, in der die Gerechtigkeit wohnt. Der neue Bischof Trivulce ist ein fähiger Verteidiger des rechten Glaubens, davon habe ich mich heute überzeugen können. Siehst du die Türme von St. Veran? Wie unerbittliche Wächter stehen sie, Hüter der Wahrheit. Der Drache des Irrglaubens ist aufgestanden. Aber er wird den Kampf verlieren. Das musst du heute auch gespürt haben. Du hast dich zwar unbeherrscht verhalten, aber ich freue mich, Sohn, dass du heute die Gelegenheit hattest zu sehen, wie der Feind der Seelen wirksam bekämpft und dereinst völlig besiegt sein wird. Gelobt sei Jesus Christus.“
Nicolas sah ihn starr an. Er war immer noch bleich, aber eine ungewohnte Härte lag auf seinem Gesicht. „Haben Sie Jesus Christus gesagt, Herr Vater?“
Jean d’Oppède sah ihn befremdet an. „Was soll das heißen?“
Nicolas formte seine Worte sehr langsam. „Sie haben den Namen unseres Herrn und Erlösers im Mund geführt. Ich frage Sie, Herr Vater: Hat Jesus Christus jemals einen Menschen verletzt oder hat er jemand zu Tode gebracht? Hat er auch nur ein einziges Mal gesagt, dass es erlaubt sei, einen anderen Menschen zu quälen und zu töten? Hätte er Bérard auf den Scheiterhaufen gebracht?“
Der Baron sah ihm lange ins Gesicht, dann zuckte er die Achseln. „Das sind theologische Fragen, die unsere heilige Kirche längst beantwortet hat. Dieser Bérard war ein Ungläubiger, ein vom Satan gebrauchtes Werkzeug. Es ist besser, einen solchen zu töten, als dass viele andere von ihm angestekkt werden und der ewigen Verdammnis anheim fallen.“
„Es ist besser, ein Mensch stirbt für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe.“ Nicolas Stimme war tonlos geworden und hatte etwas Bitteres. Er sah seinen Vater mit gequältem Ausdruck an. „Wissen Sie, dass das genau die Worte sind, die der Hohepriester Kaiphas gebraucht hat, damals in Jerusalem vor dem Hohen Rat?“
„Was meinst du damit?“
„Ich meine damit, dass der Hohepriester genauso über Jesus gesprochen hat, bevor man ihn zum Tod verurteilte. Erinnern Sie sich nicht? Sie bedienen sich der Argumente der verblendeten Hohenpriester, Herr Vater.“
Der Baron fasste ihn scharf ins Auge. „Ach, hast auch du angefangen, die Heilige Schrift auf eigene Faust zu lesen und auszulegen? Du bist kein Priester, Nicolas. Zu solchem Tun vermessen sich die Falschgläubigen. Die Bibel ist ein Buch mit sieben Siegeln. Du bist nicht befugt, sie zu öffnen. Ihre Auslegung steht dem Heiligen Vater und den geweihten Priestern und kirchlichen Amtsträgern zu, die in jahrhundertlanger, ununterbrochener Tradition und erfüllt vom Heiligen Geist uns uneingeweihten Sterblichen die Bedeutung der Schrift eröffnen, dass wir sie richtig verstehen. Vertraust du ihnen nicht?“
„Nein.“ Nicolas sprach sehr laut und erregt. „Nein, ich vertraue ihnen nicht.“ Er nahm einen Stein und schleuderte ihn gegen einen Findlingsstein. „Wie sollte ich Folterern und Mördern vertrauen!“
Der Baron packte ihn an den Schultern. „Sohn“, schrie er, „ich untersage dir solche frevlerischen Worte. Inquisitoren tragen dies Land und seine Fürsten mit und binden den Glauben aller. Sie allein können von innen dem Ungehorsam und Niedergang dieses Volkes widerstehen. Wage es nicht noch einmal, in meiner Gegenwart geweihte Würdenträger zu schmähen! Ich könnte dir ins Gesicht schlagen.“
„Warum tun Sie es nicht?“, fragte Nicolas kalt. Sie maßen sich mit den Blicken. Es war ihnen, als sähen sie einander ganz neu. Jean d’Oppède ballte die zitternden Hände. Er schaute beiseite, über die Dächer der Stadt, und er schwieg.
Nach einer langen Pause wandte er sich seinem Sohn wieder zu. „Nicolas, vielleicht verstehe ich dich. Du hast dem Burschen unten an der Tribüne ins Gesicht geschlagen. Gut. Das blutrünstige, primitive Geschrei der Masse, die niedrige Lust am Anblick gequälter Leiber – mir ist das alles auch höchst zuwider. Aber bedenke, die abschreckende Wirkung wird nur durch die Öffentlichkeit einer Hinrichtung erreicht. Mag das gemeine, unwissende Volk sich daran aufgeilen! Aber wir anderen, die wir um die Notwendigkeit drastischer Strafen wissen, wir müssen den furchtbaren Anblick mit Haltung ertragen. Wir müssen die Schreie mitanhören und die menschliche Erniedrigung miterleben ohne Ausflüchte. Ich habe richterliche Befugnisse. Du wirst Jura studieren. Für uns gilt es im Besonderen: Der Richter muss das Zugrundegehen des Verurteilten mit ansehen, das gehört zu der schweren Verantwortung, die auf ihm liegt. Er muss Härte besitzen ohne Grausamkeit, er muss strafen ohne Lust. Folter und Feuer sind ein Teil des göttlichen Gerichts. Wer diese Mittel verwaltet, trägt eine schwere Bürde. Aber er tut es stellvertretend für den Allmächtigen. Und jede Strafe, auch die schrecklichste, dient dem Heil der Seelen.“
Nicolas hatte unverwandt in das Gesicht seines Vaters geblickt. Jeder Zug von Güte war darin ausgelöscht, in seinen Blicken entdeckte der Junge etwas Dunkles, Zerstörerisches, das ihm einen Schauder über den Rücken jagte. Ein nadelfeiner Schmerz in der Brust ließ ihn ahnen, dass er nie mehr denselben Vater erkennen würde, dem er als Kind entgegengelaufen war, der ihm mit Geduld und Fröhlichkeit das Reiten beigebracht hatte … Er stöhnte auf: „Das ist Wahnsinn!“
Jean d’Oppède griff seinen Sohn hart am Arm, und als sie Blick in Blick standen, las Nicolas in den Augen seines Vaters Verachtung. Es war nur ein kurzer Moment, denn Jean d’Oppède wandte sich rasch ab. Nicolas sah seinem Vater nach, wie er hinüberging zu dem großen Findlingsstein und sich an ihn lehnte, als sei er erschöpft.
Der Junge setzte sich ins Gras. Seine Augen brannten, er hätte gern geweint. Etwas war zerbrochen, für immer. Die schmerzhafte Erkenntnis breitete sich in ihm aus wie der Winterfrost auf den Höhen des Luberon. Lange blieben sie so, einen großen Abstand zwischen sich.
Schließlich stand Nicolas auf und ging hinüber zu seinem Vater. „Ich wollte, Sie hätten mich nicht gezwungen, bei dieser Zurschaustellung dabei zu sein.“ Seine Stimme war belegt.
Jean d’Oppède legte ihm zögernd die Hand auf den Arm. „Du musst endlich erwachsen werden, Nicolas. Du musst erkennen, welch schwere und heilige Aufgabe es ist, die Irrgläubigen zu strafen und damit den wahren christlichen Glauben zu schützen.“
Der Junge trat abrupt einen Schritt zurück. Die Hand seines Vaters fiel ins Leere.
„Warum sind Sie so blind, Herr Vater!“ Es klang wie ein Stöhnen.
Der Baron sagte scharf: „Du benimmst dich wie ein Weib.“ Er ging hinüber zu seinem Pferd.
„Vater!“, rief Nicolas, und der flehentliche Unterton ließ den Baron seinen Schritt verhalten. Er blickte zurück. Im schwindenden Tageslicht sah Nicolas schmal und schutzlos aus.
„Was ist?“, fragte er barsch.
„Könntest auch du einen Menschen töten, nur weil er anders glaubt? Vater, könntest du das?“
Jean d’Oppède sah seinem Sohn ins Gesicht. „Ja“, sagte er laut und hart, „ja, selbstverständlich.“ Er wandte sich ab und schwang sich in den Sattel.
Nicolas folgte in großem Abstand. Sie ritten durch die fallende Dämmerung, als sei jeder für sich allein. Bald würde die Nacht kommen.