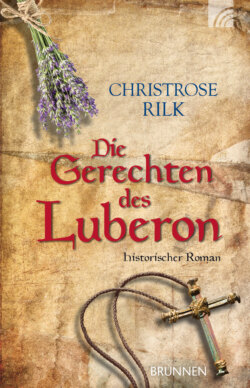Читать книгу Die Gerechten des Luberon - Christrose Rilk - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Es ist mein Weg“
ОглавлениеDie Lavendelfelder waren aufgeblüht; ihrer violettblauen Fülle entströmte das zarte Aroma, das Linderung und Ruhe und Heilkraft verheißt. Nicolas sprang vom Pferd und ging vorsichtig hinein zwischen die sorgsam angelegten Reihen des Feldes. Er zerbröselte einen blassblauen Blütenstand zwischen den Fingern und spürte den Duft seiner Kindheit, den Duft, den seine Mutter liebte und der in ihren Schränken hing und in ihren Kleidern. Ich werde meine Mutter verlassen und meine Schwester und mein Elternhaus. Nicolas pflückte die schönsten Stängel. Es würde das letzte Jahr sein für ihn, diese kindliche Geste beizubehalten.
Die Bienen summten, und er lauschte den Zikadenklängen des Mittags. Er wusste, dass über dieser Stunde der Hauch des Abschieds lag. Aber das Neue erschien ihm verheißungsvoller und lockender als das Vergangene und hielt das Bedauern gering, dass eine Zeit unwiederbringlich vorüber war. So stand er, geschützt von der Ahnungslosigkeit seiner Jugend, an einer Weggabelung seines Lebens und wusste nichts von der Größe des Verlustes, mit dem jeder neue Lebensabschnitt bezahlt werden muss.
Er saß auf und nahm das letzte Stück im Galopp, denn er sah von weitem auf der Anhöhe den Freund als dunkle Silhouette vor dem hellen Sommerhimmel.
Sie umarmten sich zur Begrüßung, der adlige Student und Baron und der junge Ehemann und Handwerker. Und beide staunten sie darüber, wie wenig sie miteinander ihre gegenwärtige Lebenswirklichkeit zu teilen vermochten.
„Hast du dich entschieden, Nicolas?“
Nicolas Maynier d’Oppède legte dem Freund seiner Kinder- und Jugendzeit die Hand auf die Schulter. „Ich habe mich entschieden, Marcel.“
Der atmete auf. „Wir Waldenser brauchen dich, Nicolas. Wir haben auf dich gewartet.“
In Nicolas’ grauen Augen stand Freude. „Es ist mein Weg“, sagte er ernst. „Und du, Marcel? Du lebst immer noch in Oppède, wie ich höre?“
Marcel zwinkerte ihm zu. „Meistens bin ich in Oppède.“ Auf Nicolas’ fragende Miene ging er nicht weiter ein. Er stand da in seiner gesunden Kraft, stämmig und unbeschwert, wie eh und je. „Wir haben nun einen Anbau am Haus“, berichtete er stolz. „Rosette erwartet unser erstes Kind.“
Sie lächelten sich an und waren beide um Worte verlegen. Die Zeit hatte schon begonnen, sich zwischen sie zu drängen; und sie spürten es beide und wussten doch nicht, wie sie es hätten verhindern können.
Anne d’Oppède stand früh auf. Nach einer Nacht voll unruhiger Träume und schwerer Gedanken war es ihr jetzt leichter ums Herz. Die sanften Strahlen der Morgensonne fielen schräg durch das Fenster ihres Zimmers und beschienen die Nische mit der kleinen Marienfigur. Der Holzschnitzer hatte ihrer Gestalt einen demütigen Ausdruck verliehen. Ihr Rücken war leicht gebeugt, die Hände hielt sie zum Gebet erhoben.
Anne d’Oppède trat näher heran. Das Gesicht der Jungfrau Maria erschien zu dieser Stunde lebendiger als sonst. Das Morgenlicht legte einen warmen Schimmer auf die gleichmütig abgeklärten Züge. Anne meinte sogar, ein wehmütig verstehendes Lächeln darin zu sehen.
„Heilige Maria, Mutter Gottes, du Mutter der Schmerzen, die du littest um deinen Sohn …“ Sie brach ab und sah der Madonna schweigend ins Gesicht. Unter diesen stillen Augen erkannte sie den Grund ihrer Unruhe. „Ja, es ist Nicolas. Mein Sohn Nicolas. Seinetwegen fand ich keinen Schlaf. Es wird etwas geschehen, das spüre ich.“ Sie kniete auf ihren Betschemel vor der Statue. „Unsere liebe Frau der Schmerzen“, murmelte sie, „Schmerzensmutter.“ Es war ihr, als würde sie eingehüllt in ein umfassendes Verständnis voller Trauer. Es tat ihr wohl, obgleich keine Zusage und kein Trost darin lag. „Notre Dame d’Allidon“, flüsterte sie, „Mutter der Schmerzen …“
Das Licht auf den Zügen der Madonna erlosch; die Morgensonne vergoldete nun den Wandteppich mit den verschlungenen Pflanzenornamenten, den ihr Jean vor vielen Jahren geschenkt hatte.
„In aller Trübsal, Angst und Not komm uns zu Hilfe, schmerzensreiche Mutter Maria.“ Einen Augenblick noch blieb sie knien. Es war ihr, als ob sie aus sich herausträte und sich selbst sähe wie eine andere: Du zusammengesunkene Gestalt auf dem Betschemel im blauen Kleid, was erbittest du dir Beistand von einer Mutter, die genauso hilflos war wie du?
„Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns … bitte für uns …“
Die Unruhe stieg wieder auf in ihr, hob sie hoch vom Betschemel und trieb sie zur Tür. Nicolas musste doch gewekkt werden. Er wollte heute Vormittag abreisen. Die Wochen, die er daheim verbracht hatte, waren anders gewesen als sonst. Ein Abstand war zu Tage getreten, eine unbestimmte, neue Fremdheit.
Als sie in sein Zimmer trat, stand er schon in Reisekleidung am offenen Fenster. Sein Bett war zugedeckt. Zwei große Satteltaschen standen fertig gepackt auf dem Boden. Das Zimmer war kalt und merkwürdig unpersönlich.
Er sah seine Mutter an mit einem sonderbaren Ausdruck in seinen hellen Augen. Dann schloss er sie wortlos in die Arme und hielt sie fest. Ihre Unruhe wuchs noch. Sie spürte einen Augenblick lang seine schnellen Herzschläge, und als sie den Kopf zurücklehnte, um ihm ins Gesicht sehen zu können, merkte sie, dass seine Augen feucht glänzten.
„Nicolas“, sagte sie drängend, „was wird sein?“ Er zwang sich zu einem Lächeln. „Ich setze mein Studium fort, Mutter. Ich werde eine Zeit lang nicht heimkommen. Ich muss ungebunden sein.“ Ihr Schweigen war beredter, als jede Klage es hätte sein können. „Mach dir keine Sorgen, Mutter.“ Nicolas wandte sich ab und machte sich am Verschluss einer Reisetasche zu schaffen. „Ich weiß schon, was ich tue.“
Sie verkrampfte die Hände ineinander. Es war ihr, als ob sich ein eiserner Reif um ihre Brust legte und ihr das Atmen schwer machte.
„Nico, Nico“, rief sie laut und sah, wie er erschrak vor dem gequälten Ton. Sie zwang sich zur Ruhe, holte tief Atem, und als sie sprach, hörte sie ihre Stimme fremd und hohl wie in einem leeren Raum. „Gehst du zu den Waldensern?“
Ein lastendes Schweigen legte sich auf Mutter und Sohn. Nicolas hielt den Kopf gesenkt.
Nach einer langen Pause sagte er leise: „Ja. Ja, Mutter.“
Sie ließ sich auf einen Stuhl sinken. Ich habe es gewusst, dachte sie, ich habe es ja längst gewusst.
„Versteh mich doch, Mutter, ich muss es tun. Es ist mein Weg.“
Sie nickte schwer. „Ich weiß.“
Die Kirchenglocke läutete zum Morgengebet. Sie lauschten beide dem hämmernden, metallenen Ton nach. Die Baronin bekreuzigte sich.
„Du gehst in die Gefahr, Kind.“
Er zuckte die Achseln. „Ich bin vorsichtig. Und ich weiß Bescheid über die andere Seite.“ Schmerzlicher Spott lag in seiner Stimme.
„Ich werde dich verlieren“, flüsterte die Baronin trostlos.
„Du verlierst mich nicht, Mutter“, sagte er fest, und sie fühlte sich seltsam getröstet.
Sie stand auf und trat neben ihn ans Fenster; über dem Tal des Calavon lag Morgennebel. Der vertraute Anblick seiner gebräunten Jungenhand auf dem Sims verursachte einen feinen, ziehenden Schmerz, der nicht zu besänftigen sein würde.
„Werde ich von dir hören?“
Er nickte. „Ich schicke dir Nachricht. Das verspreche ich.“ Seite an Seite stiegen sie die Treppe zur Halle hinunter. Der Baron hatte schon gefrühstückt. Doch setzte er sich mit seiner Frau und seinem Sohn noch einmal an den großen Eichentisch. Er ist stets korrekt, dachte Anne, und es war ihr, als ob sie einen Fremden beurteile. Sie schob die Schale mit dem frischen Brot weg von sich. Nicolas aß hastig ein Stück Brot und stand dann auf.
„Ich möchte früh wegkommen.“
Der Baron nickte zustimmend. „Ich wünsche dir gute und erfolgreiche Studien, mein Sohn“, sagte er in gemessenem Ton. „Auf dir ruhen große Hoffnungen.“
Nicolas verbeugte sich. „Leben Sie wohl, Herr Vater.“ Anne hörte den feindlichen Ton in seiner Stimme. Mit großer Anstrengung erhob sie sich und trat zu Nicolas.
Er legte die Arme um sie. „Mama“, flüsterte er in ihr Haar, und sie konnte kein einziges Wort hervorbringen, wie ein Schleier lag es vor ihren Augen, sie sah die Gestalt ihres Sohnes nur verschwommen, und als die Tür ins Schloss fiel, wusste sie, dass nun alles anders geworden war, das ganze Leben.
Ein leichter Wind wehte über die Höhe, schon frühherbstlich; golden das Land und noch nicht zum Sterben bereit. Ganz nach oben bis zum Bergvorsprung über Mérindol war Nicolas gestiegen. Das Städtchen lag unter ihm, die Steinhäuser eng aneinander gebaut den Berg herauf. Und er saß auf dem glatten Stein wie auf einem Thron.
Das ist das Leben, das echte, wahre Leben, wie ich es mir vorgestellt habe in Freiheit, in Reinheit. Der Mensch auf Gottes Erde vor dem Angesicht des Höchsten – das ist der größte Adel, den es geben kann. So hat Gott den Menschen gewollt, geschaffen auf ihn zu, dass er lebe vor seinem Angesicht. Was sollen da all diese menschgemachten Schranken und Stufen! Die Hierarchie in seiner Kirche ist dem Christus wie der entweihte Tempelvorhof mit den Tischen der Geldwechsler. Es ist Götzendienst, Selbstvergottung des Menschen. Aber der Höchste will allein das Herz, das nach ihm fragt, die reine Antwort, den Gehorsam des Glaubens, unmittelbar zu ihm hin. So nur wirkt sein Geist, mächtig, bewegend wie der Wind des Luberon hier auf der einsamen Höhe. Ach Vater, könntest du das verstehen! Dein Sitz, unser Sitz, dieses magere Oppède, welch ein Segen könnte von dort ausgehen! Macht von Gott genommen in demütige Hände, zum Schutz aller, die ihn mit Ernst suchen, sei es anders, aber wahrhaft – ach, Vater, und du willst das nicht erkennen. Der Atem der Freiheit könnte in Oppède erwecken, was dort verdorrt ist: Brüderlichkeit der Menschen vor Gott, Demut. Ein neues Regiment in der Armut Jesu Christi, und doch in seinem ganzen Reichtum.
„Gott“, sagte er inbrünstig, „nimm mich, Nicolas Maynier d’Oppède, als deinen demütigen Knecht. Fülle mich mit deiner Kraft, segne mich, sende mich.“
Lange blieb er dort oben sitzen auf der Höhe mit den hellen Kalkfelsen, sah über das Land hinweg bis zum silbernen Band der Durance und weiter bis zum sanften Dunst am Horizont. Friede zog in ihn ein und ein stilles Glück.
Es war Sonntag. Immer mehr Menschen gingen den Weg hinauf zur Kirche St. Anne in Mérindol. Oben auf dem Berg stand sie grau und schlicht; ihre alten Mauern hatten jahrhundertelang die Gebete der Menschen schützend umgeben. Nun war sie zum Zeichen einer neuen Zeit geworden. Der alte Abbé von Mérindol verkündete das Wort in waldensischem Geist, so wie es der große Lehrer Petrus Valdes gesagt hatte, und die Menschen strömten herzu; auch aus anderen Orten im Luberon kamen sie den weiten Weg her und lauschten in erstaunter Ergriffenheit der neuen Lehre.
„Ihr seid die Heiligen … “, die Stimme des alten Mannes im abgetragenen Priestergewand war durchzittert von lange entbehrter Begeisterung, „die Heiligen Jesu Christi, seine Geliebten, seine Jünger. Nichts soll euch trennen dürfen von eurem Herrn, keine Ämter, keine Macht, keine Würdenträger. Es sollen keine Schranken mehr sein, wie sie unsere Kirche unzählige aufgerichtet hat, zwischen dem Heiligen Geist und denen, die glauben. Ohne Umweg kann Jesu Geist in euch kommen, wenn ihr bereit seid. Öffnet eure Herzen, und er wird euch den Geist senden, den Tröster, den Geist der Liebe und des Friedens. Setzt euch diesem Geist aus, er weht wie der Wind des Luberon. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit dem Geist des Friedens.“
Er sah strahlend auf die Menschen vor ihm, auf ihre gebeugten Rücken, ihre von Arbeit und Mühsal gezeichneten Gesichter, ihre verarbeiteten Hände. Ihnen wollte er die Würde zeigen, die sie bei Gott hatten.
„Für euch wird Jesu Reich anbrechen mit Kraft und Herrlichkeit, ein Friedensreich. Ja, ihr sollt Menschen des Friedens sein und in seinem Frieden leben und seinen Frieden ausbreiten, da wo ihr lebt, in euren Dörfern, in unserem Land. Nehmt keine Waffen mehr in die Hand, werft sie weg, Jesus Christus will nicht, dass Menschen einander bekämpfen. Lernt von ihm, was es heißt, ohne Gewalt zu leben. Und er ist auf eurer Seite, der auferstandene Herr.“
Sein gebeugter Rücken richtete sich auf und sein weißes Haar leuchtete wie der Winterschnee auf dem Luberon. „Seid gewiss“, rief er, „das Licht Jesu Christi strahlt auf und setzt sich durch in aller Dunkelheit unserer Zeit.“
Und die Menschen, die abgearbeitet waren, besorgt, verängstigt wegen der zunehmenden Verfolgung, die sie nicht begriffen, diejenigen, die einen Verwandten, einen Freund im Gefängnis hatten, die Trauernden, sie alle atmeten auf, einen Augenblick lang, ein Gebet lang, in dieser einen Stunde am Sonntag, und sie fassten neue Hoffnung.
„Lux lucet in tenebris“, riefen sie einander zu, bevor sie wieder ihren beschwerlichen Rückweg antraten. „Das Licht scheint in der Finsternis.“
Sie wussten nicht, dass der unbekannte junge Mann in bäuerlicher Kleidung, der so versunken dem Abbé zugehört hatte, ein Späher der Inquisition war, und dass er noch an diesem Sonntag zu Protokoll geben würde, was er den alten Priester hatte sagen hören an lästerlicher Irrlehre.