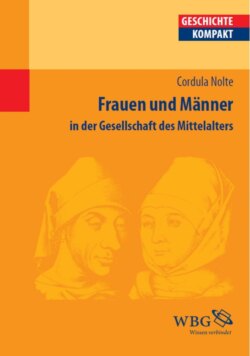Читать книгу Frauen und Männer in der Gesellschaft des Mittelalters - Cordula Nolte - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
b) Gesundheit – Krankheit – Geschlecht
ОглавлениеDie Sorge, gesund zu bleiben, und die Erfahrung, krank zu sein, begleiteten die Menschen des Mittelalters in ihrem Alltag als geradezu allgegenwärtiges Thema. Was sie zur Erhaltung und Wiedererlangung der Gesundheit tun konnten, unterschied sich in den diversen Milieus, abgesehen von religiösen Verhaltensweisen wie der Anrufung von Heiligen, Wallfahrten und Gelübden, die in allen Bevölkerungsschichten verbreitet waren. Das städtische und ländliche Umfeld, die geistliche oder weltliche Lebensform, Vermögensverhältnisse |25|und Bildung bestimmten mit, welche Maßnahmen zur Gesunderhaltung und Krankheitstherapie getroffen wurden. Dabei herrschte generell ein vielgestaltiges Nebeneinander von Krankheitskonzepten, Behandlungsmethoden, Heilmitteln und ärztlich tätigen Personen.
Entsprechend den unterschiedlichen Lebensbedingungen (Ernährung, Wohnen, Arbeitsbeanspruchung, Hygiene, Pflege) prägten sich auch viele Leiden schichtenspezifisch unterschiedlich aus. So breiteten sich unter den gedrängt zusammenlebenden Bewohnern ärmerer städtischer Quartiere Infektionen rasch aus. Rheumatische Erkrankungen waren Begleiterscheinungen des Hausens in feucht-kalten Wohnungen, aber auch des Unterwegsseins und Arbeitens draußen bei Wind und Wetter. Die üppige Ernährung in manchen Klöstern schlug sich in übergewichtsbedingten Skelettdeformationen nieder, und unter Adligen (genauer: adligen Männern) traten verschiedene Syndrome wie Gelenkbeschwerden, Steinleiden und „Melancholie“ so häufig auf, dass sie geradezu als „Hofkrankheiten“ (morbi aulici) eingeordnet wurden. Jede Lebensweise kannte somit eigene Risiken.
Welche Zusammenhänge bestanden innerhalb der verschiedenen Lebenskreise und Gesellschaftsgruppen zwischen Gesundheit, Krankheit und Geschlecht? Damit wird vordergründig danach gefragt, ob Frauen oder Männer auf der organisch-biologischen Ebene gesünder oder kränker als das andere Geschlecht waren und ob bestimmte Krankheiten sich unterschiedlich auf die Geschlechter verteilten. Seitens der Anthropologie und der Geschichtswissenschaft werden einhellig Morbiditätsunterschiede festgestellt, die indes abweichend interpretiert werden. So lässt sich die Annahme, dass Frauen genetisch bedingt gegenüber Infektionskrankheiten resistenter sind als Männer, am anthropologischen Befund nicht ohne Weiteres nachvollziehen. Skelettmerkmale, die sich erst nach der Überwindung von Infektionen und/ oder Mangelernährung bilden, wurden auf einigen Friedhöfen häufiger bei Männern als bei Frauen festgestellt. Daraus folgern manche Anthropologinnen und Anthropologen, dass unter den dort Bestatteten die vermeintlich weniger gesunden, weil infektanfälligeren Männer letztlich Krisen besser überstanden als die Frauen, die solche Stress-Situationen nicht überlebten. Ausgangspunkt für diese These ist das umstrittene „osteological paradox“, demzufolge es sich bei den Skeletten mit bestimmten pathologischen Veränderungen durchaus um die zu Lebzeiten gesünderen Individuen einer Bevölkerung handeln kann. Bei Schlussfolgerungen zum Gesundheits- und Krankheitszustand anhand von Skeletten ist im Übrigen grundsätzlich zu bedenken, dass diese nicht alle durchlebten Krankheiten dokumentieren. Kurz und heftig verlaufende Infektionskrankheiten beispielsweise hinterlassen ebenso wenig wie Erkrankungen der Sinnesorgane Spuren am Skelett. Auch über Schmerzempfindungen und das allgemeine Befinden geben Skelette nur wenig preis. Schriftliche Quellen wiederum benennen und beschreiben eine Vielfalt unterschiedlicher Krankheiten, Symptome, Begleiterscheinungen und Verhaltensweisen im Angesicht des Leidens. Aus medizinhistorischer Sicht sind retrospektive Diagnosen anhand der Texte jedoch irreführend: Selbst wenn einige der geschilderten Krankheitsbilder an heutige Krankheiten erinnern, sind sie nicht mit diesen identisch.
„Männerkrankheiten“
Infolge dieser Quellenprobleme, zu denen noch das Ungleichgewicht der schriftlichen Überlieferung zu Frauen und Männern kommt, sind nur zurückhaltende |26|Schlussfolgerungen hinsichtlich geschlechtsspezifischer Krankheitspanoramen möglich. Schichtenübergreifend scheinen zum Beispiel Leistenbrüche eine typische (wenngleich nicht ausschließliche) Männerkrankheit gewesen zu sein, die oft schon im Knabenalter auftrat. Funde von eisernen Bruchbändern des Frühmittelalters bezeugen die Verbreitung dieses Leidens ebenso wie bildliche Operationsdarstellungen, Wunderberichte, spätmittelalterliche Briefe und Selbstzeugnisse. Nachdrücklich hebt zum Beispiel Hermann Weinsberg hervor, wie folgenreich für sein ganzes Leben der Leistenbruch war, der ihn seit dem zehnten Lebensjahr plagte: Er wurde durch „dies heimliche Gebresten“ zu einem ruhigen, sesshaften Lebenswandel gezwungen, statt nach seinem juristischen Studium die diplomatische Laufbahn im fürstlichen Dienst einzuschlagen. Auch seine Heiratschancen sah er beeinträchtigt, war er doch „scheu gemacht junge Frauen zu nehmen“. Als eine unter Männern verbreitete „Alltagskrankheit“ rheumatischer bzw. gichtförmiger Art trat die sogenannte Gicht („Zipperlein“) bzw. die Fußgicht („Podagra“) auf. Die Betroffenen wussten aus Erfahrung, dass die Krankheit „vererbt“ wurde und sich vor allem im kalten Winter bemerkbar machte. Nach heutiger Kenntnis förderten wohl auch eine fleischlastige Ernährung und hoher Alkoholkonsum Gichtanfälle, die mit starken Schmerzen und Fieber einhergingen und bei einer chronischen Entwicklung der Krankheit die Beweglichkeit auch auf Dauer stark einschränkten. Von Leistenbrüchen über Lähmungen und Beingeschwüre bis zur Fußgicht: Die unteren Körperregionen scheinen bei Männern besonders häufig krankheitsbetroffen gewesen zu sein. Die dabei auftretenden Störungen der Motorik wurden vermutlich als Einbußen der Funktions- und Arbeitsfähigkeit besonders aufmerksam beobachtet. Dies gilt auch für Schlaganfälle und ihre Folgen, die dank ausführlicher Erfahrungsberichte tendenziell ebenfalls als Männerkrankheit erscheinen. Schließlich gehörten auch noch Steinleiden zum für Männer charakteristischen Krankheitsspektrum.
Q
Das Tagebuch des Lucas Rem
Das Tagebuch des Augsburger Kaufmanns Lucas Rem (1481 – 1542) liest sich streckenweise wie ein Krankheitsjournal. Rem notierte ausführlich, an welchen Beschwerden er litt, welche Ärzte er konsultierte und welche zum Teil strapaziösen Therapien diese anwandten (vor allem Reinigungen durch Abführmittel, Klistierung, Aderlass und Schwitzkuren).
Aus: Tagebuch des Lucas Rem, S. 15f., 27.
adi 8 Aug[usto 1510] rit ich von Augsburg. solt eilends gen Lion reitten. Kam gen Ravespurg adi. 9 dito, fast krank am gerechten fuos. Adi 12 dito erlahmt ich ganz und gar an al mein glider und leib. Ward je krank, je nit. (die krankhait) fuor hin und her. lidt unseglich gros schmertzen und leyden. Gab got eben ain wunderperlich glück, (dass) ich alda krank wardt. Dan da was Doctor Mathaeus, der beremptest arzt disser lender. Der tatt gros fleis mit purgieren, cristiren – unglaplich – und laussen, und zuoletzt schwitzen on mas. Bracht mich, daz nur haut und bain an mir, gar kein fleisch, bluot was. […]
adi 11. Julio [1535] abends, zwischen 3 und 4 ur, griff mich gott mit seim gwalt an, des man nennet den schlag, und erlamet mir mein gerechten Seitten, foran mein grechten arm fast, die hand gar, (ganz) schenckel und fuos gnuog. Doch begnadet er mich hoch, daz er mir mein vernunft ganz und guot, auch die sprach luos. Ungefar 4 tag hett ich daz potegran an der grechten hand heftig. Aber in meim zuofall und darvor was ich frölich, gar guotter ding.
„Frauenkrankheiten“
|27|Das Feld der unter Frauen verbreiteten Krankheiten zeichnet sich weniger deutlich ab. Dies mag, neben der spärlicheren Überlieferung, damit zusammenhängen, dass Frauenkrankheiten nicht so eindeutig an bestimmten Körperzonen lokalisiert und die Beschwerden seltener mit Krankheitsnamen bezeichnet wurden. Von gynäkologischen Erkrankungen abgesehen, gab es Unterschiede gegenüber den Männern in erster Linie bei der Häufigkeit, mit der einzelne Leiden auftraten. Dass Frauen zum Beispiel seltener an der Gicht litten als Männer, wurde bereits im Mittelalter von einer Empirikerin wie Hildegard von Bingen (1098 – 1179) beobachtet. Diese sah dabei die reinigende Kraft der Menstruation am Werk. Aus heutiger Sicht könnten Unterschiede in der Arbeitstätigkeit hier ins Gewicht gefallen sein, während geschlechtsbezogene Ernährungsunterschiede als mögliche Ursachen bisher nicht nachgewiesen worden sind. Auffallend hoch ist der Frauenanteil unter den Blinden in ausgewählten Mirakelberichten des frühen und späten Mittelalters. Mangels anderer Quellen lässt sich nicht erhärten, ob zur Erblindung führende Augenkrankheiten Frauen besonders häufig befielen, ob sie zum Beispiel unter den älteren Menschen mit inoperablen Formen des Star bzw. der „Altersblindheit“ überrepräsentiert waren. Dass blinde Frauen und Männer in Straßburg im 15. Jahrhundert gemeinsam zur ihrer Absicherung eine Bruderschaft der „armen blinden lute“ gründeten, spricht für die Betroffenheit beider Geschlechter. Ob beim breiten Spektrum geistig-seelischer Beeinträchtigungen und Auffälligkeiten Frauen in besonderem Maß betroffen waren, wurde vonseiten psychohistorischer Ansätze und der Hexenforschung diskutiert. Allerdings ist es gerade hier schwierig, über zeitgenössische Erklärungsmuster hinaus zu lebensgeschichtlichen Erfahrungen vorzudringen. Verschiedene Formen von Geistes- und Gemütsstörungen wurden im Mittelalter sowohl Frauen wie Männern zugeordnet, aber geschlechtsbezogen unterschiedlich interpretiert. Frauen wurden häufiger als „besessen“ eingestuft. Ihre Anatomie prädisponierte sie angeblich für bestimmte Formen der Verwirrung und Schwermut („Hysterie“, „Uterus-Melancholie“). Einigen Mirakelsammlungen zufolge wurden in der Mehrzahl Frauen von Zuständen geheilt, die nach heutigem Ermessen psychische Krankheiten waren. Der Eindruck aus Wunderberichten, dass Frauen vielfach im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett anfällig für seelisch-geistig-körperliche Schwächezustände waren, bestätigt sich in Mitteilungen, die Ehemänner in Briefen, Tagebüchern und Familienchroniken über das Befinden ihrer Frauen machten.
Krankheitserfahrung und Gesundheitspflege
Wer neben den biologisch-organischen Vorgängen auch die sozialen Aspekte von Krankheit ins Auge fasst, steht vor vielen derzeit noch kaum bearbeiteten Fragen. Beteiligten sich Frauen und Männer auf ähnliche Art oder eher arbeitsteilig an der Gesundheitsfürsorge für sich selbst und ihre Angehörigen? Wer übernahm in einer Zeit, in der eine Hospitalisierung von Kranken in der Regel nicht vorgesehen war, die häusliche Pflege? Erfuhren Frauen und Männer das Kranksein in unterschiedlicher Weise, weil sie verschieden mit der „Krankenrolle“ umgingen, weil ihnen die Zuwendung seitens ihres Umfeldes in unterschiedlichem Maß zuteil wurde und weil sich die medizinische Versorgung auch nach dem Geschlecht richtete? Antworten auf solche medizinsoziologischen Fragen können hier nur mit wenigen Stichworten angedeutet werden. Auf dem Feld der Gesundheitspflege waren |28|Frauen und Männer gleichermaßen aktiv. Als „Hausväter“ und „Hausmütter“ kümmerten sie sich um das häusliche Gesundheitswesen von der Medikation bis hin zu Hygienevorkehrungen unter dem Personal. Frauen und Männer suchten, oft samt ihren Ehepartnern und Kindern, Badestuben auf, sie reisten, wenn sie es sich leisten konnten, in Heilbäder und unterzogen sich regelmäßig vorbeugenden Prozeduren wie dem Aderlass bzw. dem für Frauen empfohlenen Schröpfen. Es war ferner üblich, auch von Haushalt zu Haushalt mit weiblichen und männlichen Verwandten und Freunden Ratschläge, Rezepte und gesundheitsfördernde Mittel auszutauschen. Während die meisten Gesundheitsratgeber auf Männer zugeschnitten waren, dominierten in der alltäglichen Praxis die Frauen. In ihren Händen lag offenkundig auch die Versorgung kranker oder gebrechlicher Familien- und Haushaltsmitglieder, ob es sich um die eigenen Kinder, Eltern, Dienstboten oder Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber handelte. Dazu kultivierten Frauen Heilpflanzen im Garten (der weiblichen Domäne schlechthin), sie stellten Hausmittel her und verabreichten sie, und sie kooperierten mit Ärzten und anderen heilkundigen Personen, die gegebenenfalls beigezogen wurden. Seitens der männlichen Angehörigen wurde ihre Sachkunde als häuslich praktizierende „Ärztinnen“ bereitwillig anerkannt.
Die Pflege gerade von langfristig und schwer erkrankten Angehörigen stellte für die meisten Familien eine erhebliche Belastung dar, vor allem wenn die Kranken nichts zum Lebensunterhalt beitragen konnten und hohe Behandlungskosten anfielen. Beim Fürsorgeaufwand scheint es kaum geschlechtsbezogene Unterschiede gegenüber weiblichen und männlichen Kranken gegeben zu haben. Ob im Krankheitsfall akademisch geschulte Doktoren, die ein hohes Honorar verlangten, preiswertere Wundärzte oder Heilerinnen konsultiert wurden, wurde vom Milieu, vom Familienvermögen sowie von der Art der Erkrankung bestimmt. Das Maß an materieller und emotionaler Zuwendung, das ein kranker Mensch erhielt, war zudem vorrangig an seiner (vom Geschlecht mitbestimmten) Position im Familien- und Haushaltsverband orientiert. Während erkrankte Haushaltsvorstände, die eigenen Ehepartner und Kinder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen, mussten Dienstboten im Fall einer längeren Krankheit damit rechnen, nach einer Schutzfrist entlassen zu werden.
Wie Frauen und Männer das Kranksein erlebten, hing schließlich auch davon ab, inwieweit ihre gewohnte soziale Rolle mit der „Krankenrolle“ vereinbar war. Je bedeutsamer Vitalität und körperliche Leistungsfähigkeit für die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Stellung waren, desto schwerer war krankheitsbedingte Schwäche zu akzeptieren. Am wenigsten konnten sich Bauern und adlige Männer in regierender Position offenkundige Hinfälligkeit leisten. So mancher fürstliche und königliche Herrscher verschwieg bezeichnenderweise denn auch in der Öffentlichkeit schwere Krankheiten und Verletzungen, um keine politischen Nachteile zu riskieren.