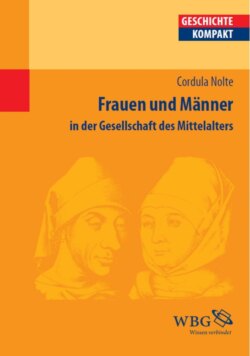Читать книгу Frauen und Männer in der Gesellschaft des Mittelalters - Cordula Nolte - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Arbeitsbelastung: Verschleiß, Unfälle und Invalidität
ОглавлениеAls Inbegriff schwerer Arbeit im Mittelalter gelten nach heutigen Maßstäben vor allem landwirtschaftliche und handwerkliche Tätigkeiten, die viel körperliche Kraft erforderten, unfallträchtig oder gesundheitsgefährdend waren. |29|Tatsächlich erlebten wohl die meisten Frauen und Männer, unabhängig vom Metier, ihren Arbeitsalltag als anstrengend und kräftezehrend. Aus dem Spätmittelalter sind entsprechende Äußerungen überliefert: Der Kaufmann Lucas Rem etwa führt seine Krankheiten auf Überarbeitung („überflisse fil flis“) zurück. Der niederadlige Kriegsmann Wilwolt von Schaumburg (um 1450 – 1510) und seine Gefährten bitten nach zweijährigem ununterbrochenem Feldlager um Urlaub, nachdem ihnen die Rüstungen und das Pferdezeug verdorben und die Kleider am Leib verfault sind. Alte, arbeitsunfähige Männer beantragen die Aufnahme in ein Spital, da sie durch „saure Handarbeit“ verschlissen seien. Frauen erklären in ihren Testamenten, ihr Kapital durch mühselige Arbeit erworben zu haben. In positiver Erinnerung hat Burkard Zink die Zusammenarbeit mit seiner Frau Elisabeth Störkler zu Beginn ihrer Ehe, als die beiden Tag und Nacht zu Hause schreiben bzw. spinnen mussten, um über die Runden zu kommen: „und gieng uns gar wol und gewunnen was wir bedorften“.
Die Arbeitszeiten im Handwerk und in der Landwirtschaft richteten sich nach dem Tageslicht. Bauarbeiter in Nürnberg zum Beispiel arbeiteten Mitte des 15. Jahrhunderts im Winter mindestens acht Stunden und im Sommer 16 Stunden lang, bei schätzungsweise sieben bis 13 Stunden reiner Arbeitszeit. Vorschriften zur Begrenzung der täglichen Arbeitszeit kamen erst gegen Ende des Mittelalters auf, ebenso die Fünftagewoche. Dank der Sonntage und der vielen kirchlichen Feiertage wurde im Spätmittelalter an rund 100 Tagen im Jahr nicht gearbeitet.
Zwar ist die Intensität mittelalterlichen Arbeitens nicht ohne Weiteres nachvollziehbar. Belastend konnten sich jedenfalls langfristig alle Formen körperlicher Beanspruchung auswirken. Auch manuelle Tätigkeiten, die mit geringem Kraftaufwand verbunden waren (etwa die Stickerei), führten auf die Dauer zu degenerativen Erscheinungen. Dagegen gab es keinen Schutz, während für besonders riskante Berufsfelder wie beispielsweise das Baugewerbe, die Gerberei und die Metallverarbeitung gezielte, jedoch unzulängliche Sicherheitsmaßnahmen gegen Stürze, Verletzungen, Vergiftungen und Erkrankungen der Atemwege entwickelt und zum Teil auch angewendet wurden. Allerdings litten unter den Belastungen durch die Gerberei und vor allem durch die Metallverarbeitung nicht nur die in diesen Bereichen arbeitenden Menschen, sondern die gesamte Umwelt.
Menschen, die durch Körperschäden infolge von chronischen Erkrankungen und (Arbeits-)Unfällen an der weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert wurden, suchten nach anderen Erwerbsmöglichkeiten. Vor allem im diversifizierten städtischen Handwerk eröffneten sich für körperlich Beeinträchtigte Chancen, ihren Lebensunterhalt zu erarbeiten. Gehbehinderte etwa fanden öfter ihr Auskommen als Schneider, auch Goldschmiede an Krücken und beinamputierte Schlosser sind belegt. In Memmingen wurde der Fleischerberuf ausdrücklich jenen vorbehalten, die aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigung „kein ander handwerk treiben“ konnten (1459). Wer seine Arbeitsfähigkeit völlig einbüßte, war auf den Unterhalt durch Angehörige angewiesen. Versorgungseinrichtungen von Zünften, Bruderschaften, Kirchen und Kommunen fingen einige von denen auf, denen ein familiales Netz fehlte. Diejenigen, die dort nicht unterkamen, mussten betteln gehen.
|30|Zeichnen sich bei den gesundheitlichen Folgen strapaziöser und riskanter Arbeiten geschlechtsbezogene Muster ab? Hierbei ist zu bedenken, dass eine dafür ursächliche geschlechtsspezifische Aufgabenteilung bei Weitem nicht alle Arbeitsbereiche charakterisierte. Viele Tätigkeiten wurden nach Bedarf sowohl von Frauen wie von Männern verrichtet. Zudem wandelten sich im Lauf des Mittelalters mit den Arbeiten selbst auch die Zuordnungen.
Arbeitsfelder von Frauen und Männern mit spezifischen Risiken
Die in einigen Tätigkeitsfeldern praktizierte Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern schlug sich in der Tat auch im Krankheits- und Unfallgeschehen nieder. Zahlreiche Wundererzählungen berichten über Unfälle von Männern bei der Waldarbeit, bei der Feldbestellung und bei Transportarbeiten mit Ochsen und Büffeln, beim Reiten und beim Umgang mit Pferden, beim Einzäunen von Feldern und beim Abernten von Obstbäumen. In der Landwirtschaft waren Männer demnach deutlich gefährdeter als Frauen.
Das Kriegshandwerk war ein Berufsfeld, in dem Männer der gesellschaftlichen Elite ebenso wie Söldner niederer Herkunft riskierten, verwundet und verstümmelt zu werden, selbst durch kleinere, unzureichend behandelte Verletzungen dauerhafte Schäden an Gliedmaßen und Sinnesorganen zu erleiden, von den in Feldlagern grassierenden Seuchen befallen und bei ausgedehnten Kriegszügen unter widrigen klimatischen und hygienischen Bedingungen aufgerieben zu werden. Im Zuge einer Kriegsführung, die eher auf Lösegeldzahlungen als auf die Tötung der Gegner setzte, wurden Kriegsgefangene und Geiseln vielfach unter Bedingungen gehalten, die ihre Gesundheit ruinierten. Neuere Forschungen zum spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kriegswesen aus geschlechter- und körpergeschichtlicher Perspektive heben in diesem Zusammenhang hervor, dass Frauen als Mitglieder des Tross ebenfalls von Gewalttätigkeit und Entbehrungen bedroht waren. Erst in jüngster Zeit wird thematisiert, wie sich Kriegsversehrtheit auf die Betroffenen und ihre Familien auswirkten, wie Invaliden, die für den Kriegsdienst nicht mehr taugten, ihren Lebensunterhalt gewannen bzw. versorgt wurden und wie sich der Verlust kriegerischer Männlichkeit auf ihr Selbstverständnis auswirkte.
Unter den Frauenarbeiten blieb die Textilherstellung während des ganzen Mittelalters, trotz aller die Männer einbeziehenden Spezialisierungs- und Professionalisierungsvorgänge, eine weibliche Domäne quer durch alle sozialen Schichten hindurch. Die damit verbundene intensive manuelle Beanspruchung spiegelt sich in Wunderberichten über Erstarrungen von Fingern, Händen und Armen ebenso wie in degenerativen Veränderungen der Handgelenke, die an weiblichen Skeletten festgestellt wurde. Die höhere Arthrosebelastung etwa, die die Handgelenke der auf dem sogenannten slawischen Fürstengräberfeld Starigard/Oldenburg (10. Jahrhundert) bestatteten Frauen im Vergleich zu den Männern aufwiesen, wurde mit Tätigkeiten im Textilhandwerk in Verbindung gebracht. Besonders unter den Spinnerinnen, die in einem für die Garne günstigen feuchten Raumklima arbeiteten, dürften rheumatische Erkrankungen verbreitet gewesen sein.
Generell scheinen sich belastend für Frauen eher die Dauer und Häufigkeit ihrer Verrichtungen ausgewirkt haben, während bei den Männern vor allem Unfälle und Kraftakte Spuren hinterließen. Während zum Beispiel Skelettbefunden zufolge Frauen in der hochmittelalterlichen Bevölkerung Schleswigs häufiger von Veränderungen der Bandscheiben (Spondylose) betroffen |31|waren, zeigen Männerskelette dort eher das Spät- bzw. Folgestadium dieser Degeneration (Spondylarthrose). Vermutlich waren diese Männer, wiewohl insgesamt seltener befallen, absolut höheren Belastungen ausgesetzt als die Frauen. Dass bei einigen der Schleswiger Bestatteten sich Knochenauflagerungen an den Schienbeinen gebildet hatten, könnte auf häufiges und langes Stehen, etwa beim Fischfang im kalten Wasser, zurückzuführen sein. Bemerkenswerterweise waren Frauen davon häufiger betroffen als Männer. Erkrankungen der Schulter-, Ellbogen- und Hüftgelenke verteilen sich auf verschiedenen Gräberfeldern mit leichten Abweichungen auf Skelette von Frauen wie von Männern und werden, unter Berücksichtigung von Konstitution und Altersstufe, durchgängig als Indizien für schwere körperliche Arbeit – das Reiten und Fahren eingeschlossen – gedeutet.
Bei der geschlechtsbezogenen Zuordnung von Arbeiten spielte die Frage des Kraftaufwands und der körperlichen Anstrengung zwar eine gewisse Rolle, sie stand aber nicht im Mittelpunkt. Typische Frauenarbeiten wie die Wäscherei oder das bis ins 11. Jahrhundert von Hand durchgeführte Getreidemahlen – beides eher Mägde- als Hausfrauensachen – erforderten viel physische Kraft, ebenso von Frauen und Männern verrichtete Arbeiten auf der Baustelle, in der Schmiede, im Wein- und Ackerbau. Das Tragen schwerer Lasten – Holzladungen, Eimer, Kessel – erscheint geradezu als ein Charakteristikum niederer Frauenarbeiten in Bildern und Texten.
Aus der höheren Unfallgefährdung von Männern könnte man schließen, dass sie und ihre Familien in besonderem Maß von Invalidität samt den unter Umständen gravierenden sozialen und ökonomischen Folgen bedroht waren. Doch auch die vielen Frauen, die für niedrige Löhne bzw. außerhalb der Zunftberufe arbeiteten, waren im Fall der Arbeitsunfähigkeit mit drohender Verelendung konfrontiert, fehlte ihnen doch in der Regel die Absicherung durch Zünfte und Genossenschaften. Alleinstehende Frauen und Ehefrauen gering verdienender Männer hatten es in einigen Städten schwerer als Witwen, die auf die Aufnahme in spezielle Fürsorgeinstitutionen hoffen konnten. Allerdings gab es an manchen Orten auch Armenhäuser und Hospitäler, die ausdrücklich eine Anzahl von Plätzen für unverheiratete, bedürftige Personen „beiderlei Geschlechts“ vorsahen, sowie Frauen vorbehaltene „Seelhäuser“ wie das von Mechthild Ruf in Augsburg 1353 zur Verfügung gestellte Haus für zehn ehrbare, „unversprochene“ arme Frauen. Der allgemeine Mangel an Plätzen – obwohl es in vielen Städten im Spätmittelalter mehrere hospitalartige Fürsorgeeinrichtungen nebeneinander gab, konnte mit deren Kapazitäten nur ein Bruchteil der bedürftigen Menschen versorgt werden – dürfte Frauen besonders empfindlich getroffen haben. Wie für Paris im 13. Jahrhundert nachgewiesen wurde, verbanden sich Frauen intensiver als Männer in nachbarschaftlichen Solidargemeinschaften, um sich in Situationen von langwieriger Krankheit und Arbeitsunfähigkeit gegenseitig zu unterstützen.