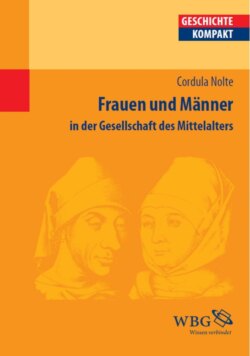Читать книгу Frauen und Männer in der Gesellschaft des Mittelalters - Cordula Nolte - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Klimatische und demographische Entwicklung
Оглавлениеfolgenreicher Klimawandel
Das Klima stellte in der agrarisch geprägten Lebenswelt des Mittelalters eine Umweltgröße von maßgeblichem Einfluss auf die gesamte gesellschaftliche Situation dar. Von ihm hingen die Ernteerträge und damit die Ernährung von Mensch und Tier mit Folgen für Gesundheit und Krankheit, Geburtenhäufigkeit und Sterblichkeit ab. Zahlreiche chronikalische Aufzeichnungen dokumentieren, wie genau das Wetter und seine Auswirkungen beobachtet wurden und wie existentiell bedrohlich Natur- und Witterungskatastrophen erschienen. Dabei herrschte in der Zeit von etwa 500 bis 1200 ein günstiges, relativ warmes Klima mit einem Optimum um das 11. Jahrhundert, das ungefähr der Warmphase in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entsprach. Die hohen Durchschnittstemperaturen dürften sich positiv auf den Ackerbau und die Ernährung ausgewirkt haben, da sie in der Regel mit längeren Sommern einhergehen und somit gute Voraussetzungen für die agrarische Arbeit bieten, während die Winter kürzer und niederschlagsreich sind, was ebenfalls die Fruchtbarkeit fördert. Tatsächlich setzten gerade in dieser Zeit starkes Bevölkerungswachstum, intensiver Landesausbau und landwirtschaftlicher Aufschwung ein. Auf die Wärmezeit folgte vom 13. Jahrhundert an eine zunehmend kältere Phase, die für die Zeit von 1550 bis 1850 sogar die „kleine Eiszeit“ genannt wird. Diese Klimaverschlechterung hatte vielfältige Konsequenzen für die allgemeinen Lebensbedingungen. Beispielsweise ging im Norden Deutschlands der Weizenanbau zurück, und in hohen Alpenregionen mussten Siedlungen aufgegeben werden. Überaus harte Winter führten zu Viehsterben, zum Erfrieren der Weinstöcke, zum Verderben der Wintersaat, zu Hungersnöten und Arbeitslosigkeit in Stadt und Land. Menschen erfroren im Schnee, und der Aufenthalt in Häusern oder auf Burgen, in denen bestenfalls einzelne Räume beheizt waren, begünstigte rheumatische Krankheiten. Katastrophale Folgen hatten auch kalte, verregnete Sommer, da das Getreide verdarb und der Wein, der im Spätmittelalter in Deutschland großflächig angebaut wurde und eine bedeutende wirtschaftliche Rolle spielte, nicht gedieh.
Zwar waren vom Klimageschehen alle Menschen betroffen, doch klimatisch mitbedingte Hochzeiten oder Notsituationen wirkten sich nicht nur schichten-, sondern auch geschlechts- und altersspezifisch unterschiedlich aus. Die mittelalterlichen Chronisten beobachteten denn auch, dass in Krisenzeiten Kinder die ersten Opfer waren. So berichtet Gregor von Tours (538 – 594) zum Jahr 580, dass auf Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben, Feuersbrünste und Hagelschlag eine ruhrartige Seuche folgte, die zuerst die Kinder befiel und dahinraffte. Ernährungsverbesserungen wie -mängel hatten für Frauen und Männer, selbst bei prinzipiell gleichem Zugang zu bestimmten Nahrungsmitteln, unter Umständen unterschiedliche Folgen, da Frauen zum Beispiel insbesondere während der Schwangerschaft und Stillzeit einen höheren Bedarf an bestimmten Spurenelementen haben. Nach einer seit den 1980er-Jahren diskutierten These begünstigten |3|allgemeine Veränderungen der Ernährungsweise seit dem Frühmittelalter daher Frauen noch mehr als Männer, weil sie von der damit verbundenen erhöhten Eisenaufnahme stärker profitierten. In Verbindung damit sei ihre Lebenserwartung gestiegen. Bei Skelettuntersuchungen erwiesen sich Eisenmangelanämien allerdings nicht als frauenspezifisch, und auch die Annahme, dass Frauen im Frühmittelalter eine besonders niedrige Lebenserwartung gehabt hätten, lässt sich schwer belegen.
Wetterzauber und Hexenverfolgung
Aus Sicht der Geschlechtergeschichte interessieren neben den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten von Klimaverläufen auch vormoderne Auffassungen und Erklärungen von Wetterphänomenen. Aus der Erfahrung, dem Wetter ausgeliefert zu sein, und den daraus resultierenden Ängsten entsprangen bis in die Neuzeit hinein Vorstellungen, man könne sich mit religiösen und magischen Mitteln schützen und es gebe Wetterzauber, ausgeübt von Frauen und Männern. In Zeiten von klimatisch bedingten Krisen, unter der Last von Missernten, Hungersnöten, Teuerung und sozialen Spannungen, wuchs anscheinend die Bereitschaft, Verantwortliche für Ungemach aller Art zu suchen und gegen sie mit dem Vorwurf der Hexerei vorzugehen. Die Kernzeit der Hexenverfolgung (1560 – 1630) fiel in eine Zeit der deutlichen Klimaverschlechterung und damit einhergehender Agrarkrisen. Das dabei erkennbare Wechselspiel zwischen klimatischen, sozialen und mentalen Faktoren spielte demnach eine maßgebliche Rolle bei der Verfolgung von Frauen und, wie die neuere Forschung unterstreicht, von Männern.
E
Geschlechtergeschichte (Gender Studies)
Entwickelt aus der Frauengeschichtsforschung (Women’s Studies) seit den 1970er-Jahren und mittlerweile erweitert um das Konzept der Männergeschichte (Men's History), versteht sich die Geschlechtergeschichte weniger als eine Teildisziplin, denn als eine Perspektive, die auf die gesamte Geschichte zielt. Dementsprechend erforscht sie – bezogen auf alle Lebensbereiche, Gesellschaftsstrukturen und Ausdrucksformen, anhand der gesamten Quellenüberlieferung und mit den verschiedensten Methoden, die der Geschichtswissenschaft und anderen historisch arbeitenden Disziplinen (Archäologie, Anthropologie, Kunstgeschichte Theologie usw.) zu Gebote stehen –, wie Frauen und Männer dachten und agierten, mit welchen Rollen und Verhaltenserwartungen sie aufgrund ihres Geschlechts konfrontiert wurden und wie sich die Beziehungen zwischen den Geschlechtern im historischen Wandel gestalteten.
Probleme der Demographie
Die Bevölkerungsdichte und die Bevölkerungsentwicklung in Europa insgesamt und in seinen einzelnen Regionen sind mit Zahlen nicht zuverlässig anzugeben, da die dazu erforderlichen seriellen Quellen (vor allem Kirchenbücher mit Tauf-, Heirats- und Sterberegistern) weitgehend fehlen oder sich, wie vorhandene Güterverzeichnisse, Steuer- oder Bürgerlisten, nur bedingt für bevölkerungsstatistische Auswertungen eignen. Die auf J. Cox Russell, den bevölkerungsgeschichtlichen Klassiker, zurückgehenden Zahlen, die auch in der neuesten Literatur weiterhin angeführt werden, beruhen daher weitgehend auf Schätzungen. Demnach sank die Bevölkerungszahl im Frühmittelalter gegenüber der Spätantike um fast ein Drittel (von 16,8 auf 11,9 Mio.) und stieg dann bis etwa 1000 kräftig an (auf 23,7 Mio.), um sich danach in steiler Kurve bis knapp zur Mitte des 14. Jahrhunderts sogar mindestens zu verdoppeln (53,9 Mio.). Danach nahm die Bevölkerung, vor allem |4|infolge der Pest seit 1348, deutlich ab (37,0 Mio.) und erholte sich erst allmählich wieder im Lauf des 15. Jahrhunderts.
Biologie und Geschichtswissenschaft: Interpretationen der Bevölkerungsentwicklung
Die Biologin und Anthropologin Gisela Grupe hat den Entwicklungstrend in eine einzige Kurve gefasst, dabei jedoch bewusst auf absolute Zahlen verzichtet, um lokalen Unterschieden in Europa gerecht zu werden und keine trügerischen „harten Daten“ zu suggerieren. Sie interpretiert den Verlauf aus biowissenschaftlicher Sicht ausgehend von den in der Tierökologie gültigen Regeln und ergänzt mit diesem Ansatz zu einer „historischen Ökologie“ die geschichtswissenschaftlichen Erklärungsversuche um wichtige Deutungsangebote.
Abb. 1: Modell der Bevölkerungsentwicklung in Europa, von 500 bis 1500. Aus: Gisela Grupe: Umwelt und Bevölkerungsentwicklung im Mittelalter, S. 27.
Nach diesem Modell stagniert die Bevölkerungsentwicklung im Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter bzw. ist sogar rückläufig – eine Annahme, die in der Forschung kontrovers diskutiert und mit unterschiedlichen Indizien begründet wird. In der Mitte des 6. Jahrhunderts ist ein rapider Einbruch erkennbar, der vermutlich auf Seuchenzüge zurückzuführen ist. Ob es sich bei dieser sogenannten „Pest des Justinian“ tatsächlich um die Pest handelte, ist nicht sicher. Für die Zeit ab etwa 600 verzeichnet Grupe ein anfänglich schnelles, dann sich allmählich verlangsamendes Wachstum. Sie verweist auf die Beobachtung, dass Bevölkerungen sich häufig nach demographischen Krisen dank einer kurzfristigen Steigerung der Geburtenrate rasch erholen. Grupe hält eine gegenüber „normalen“ Zeiten erhöhte Kinderzahl pro Elternpaar denn auch für den ausschlaggebenden Faktor bei dieser Phase des frühmittelalterlichen demographischen Aufschwungs. Ein solches zu sprunghaftem Geburtenanstieg führendes generatives Verhalten erscheint vor dem Hintergrund von Ersatzstrategien – beim |5|Tod von (erstgeborenen) Kindern verkürzt sich der Abstand zur Geburt eines weiteren Kindes gegenüber dem sonstigen durchschnittlichen Intervall – zwar auch für das Frühmittelalter plausibel. Wir wissen allerdings wenig darüber, inwieweit damals Eltern in „normalen“ Zeiten alle Möglichkeiten, Kinder zu bekommen, ausschöpfen konnten und wollten (vgl. S. 22). Eine Verhaltensänderung mit so weitreichenden demographischen Folgen muss daher hypothetisch bleiben. Andere Faktoren, wie etwa ein verbessertes Verhältnis zwischen vorhandenen Ressourcen und geschrumpfter Bevölkerung, müssten in jedem Fall ebenso berücksichtigt werden. Nach einer langsamen, aber stetigen Zunahme zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert steigt die Kurve bis etwa 1200 steiler und schnellt dann zwischen 1200 und 1300 noch rasanter nach oben. Diese Expansion fällt zusammen mit der Zeit der Städtegründungen, des inneren und äußeren Landesausbaus, bei dem neues oder weniger fruchtbares Ackerland erschlossen wurde, agrartechnischer Neuerungen, durch die die Produktivität gesteigert wurde, und landwirtschaftlicher Veränderungen. Durch die Zunahme der Getreidewirtschaft gegenüber der vorher dominierenden Viehzucht wurde die Nahrungskette verkürzt. Diese Veränderungen trugen dazu bei, dass mehr Menschen ernährt werden konnten. Um 1300 war dann nach Grupe die Kapazitätsgrenze des Ökosystems erreicht, die Bevölkerungszahlen stagnierten. Die schon erwähnte Klimaverschlechterung und die damit verbundenen Missernten, die Verknappung von Nahrung und anderer Ressourcen wie Holz führten zu deutlichem Bevölkerungsrückgang, markiert durch eine Kette von Hungersnöten zwischen 1309 und 1317. Ab 1348 raffte die sogenannte Pest in mehreren Zügen bei großen regionalen Unterschieden einen beträchtlichen Teil – schätzungsweise durchschnittlich 40% – der europäischen Bevölkerung dahin. Bis zur Mitte des 15. Jahrhundert blieb die Zahl niedrig. Erst etwa 100 Jahre nach der ersten Pestwelle verzeichnet Grupe eine ähnlich rasche Rekonvaleszenz wie nach dem Einbruch im 6. Jahrhundert, eine bis zum Dreißigjährigen Krieg dauernde Wachstumsphase. Warum die Erholung diesmal so spät, erst nach mehreren Generationen, einsetzte, lässt sich nach Grupe im biologischen Kontext nicht erklären, so dass sie nach psychologischen Begründungen sucht: Der von Katastrophen zermürbten Bevölkerung habe nicht die Möglichkeit, sondern der Wille zum Wachstum gefehlt. Eine solche Annahme passt zu älteren, mittlerweile modifizierten Vorstellungen von der allgemeinen Krise des Spätmittelalters, vor allem des 14. Jahrhunderts, ist aber spekulativ. Wahrscheinlicher ist, dass das ständig neue Ausbrechen von Pestepidemien, bevor die Seuche endemisch wurde (das heißt in einem bestimmten Gebiet verbreitet, woraufhin sich Resistenz entwickelt), das niedrige Gesamtniveau verantwortete. Zudem gab es in den auf den ersten Ausbruch folgenden Pestepidemien Verluste vor allem unter den jüngeren Menschen, die eigentlich für die Kontinuität der Bevölkerung gesorgt hätten. Während Überlebende der vorangegangenen Pest eine gewisse Immunität erworben hatten, starben jetzt viele der mittlerweile nachgewachsenen Kinder und Jugendlichen. Bezeichnend ist die Aussage Burkard Zinks (1396 – 1474 / 1475) aus Augsburg, das dortige Sterben 1462 / 63, vermutlich die sogenannte Kinderpest (1361 / 62), habe zwar unter Alten und Jungen gewütet, aber doch mehr Junge getroffen („es sturben man und frawen, die bei 60 jarn alt waren, aber es sturben dennocht mer jung dann |6|alter“). Auch Massengräber aus Pestzeiten („Pestfriedhöfe“) bezeugen, dass die Sterblichkeit der dort bestatteten Menschen sich nach Altersgruppen unterschied. Auf lokaler Ebene lassen sich im Gefolge von Pestzügen einerseits durchaus erhöhte Heirats- und Geburtenzahlen feststellen. Andererseits könnten Bevölkerungsverschiebungen im Gefolge der Pest (Zuzug vormals ländlicher Arbeitskräfte in die Städte) das Zahlenverhältnis von Frauen und Männern in einzelnen Regionen dahin gehend beeinflusst haben, dass dort die Familiengründungschancen sanken. Eine geschlechtsspezifisch unterschiedliche Sterblichkeit von Frauen und Männern in Pestjahren wurde bisher für die Zeit vor dem 16. Jahrhundert nicht ermittelt.
Die Wachstumskurve der mittelalterlichen Bevölkerung mit den beiden Tiefpunkten im 6. und im 14. Jahrhundert lässt sich dahin gehend interpretieren, dass die demographische Entwicklung im Mittelalter im Wesentlichen durch Infektionskrankheiten, bei denen vorher unbekannte, virulente Erreger auf eine Bevölkerung ohne Immunitätsschutz trafen, bestimmt wurde. Neuere Ergebnisse dazu, ob es sich bei den mittelalterlichen Epidemien tatsächlich um die vom Erreger Yersinia pestis ausgelöste Pest gehandelt hat, bleiben abzuwarten (nach neueren Untersuchungen erscheint dies eher zweifelhaft). Demgegenüber beeinflussten die streckenweise geradezu periodisch auftretenden Hungerkrisen die Bevölkerungsentwicklung insgesamt offenbar vergleichsweise wenig. Allerdings wirken die Komplexe Infektion und Ernährung vielfältig aufeinander ein. Mangelernährung und Hunger werden bei längerer Dauer von Krankheiten begleitet, in der Folge sinken die Fruchtbarkeit und das Sterbealter. Wenn die Bevölkerung Subsistenzkrisen im Allgemeinen einigermaßen überstand, so lässt sich dies im biologisch-anthropologischen Kontext damit erklären, dass in solchen Notsituationen vor allem kleine Kinder und alte Menschen starben, während Frauen und Männer „in der reproduktiven Phase“ eher überlebten. Die Verluste konnten daher durch eine kurzfristige Steigerung der Geburtenzahlen rasch ausglichen werden.
Landesausbau: von inselhaften Siedlungen zu dichten Ortsnetzen
Im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung veränderten sich die Siedlungsverhältnisse im Lauf des Mittelalters. Im Frühmittelalter war Europa insgesamt dünn besiedelt. Neben Gebieten mit größerer Bevölkerungsdichte wie Städten, Küstengebieten und Flusstälern gab es weite, siedlungsfreie Regionen. Bis ins 11. Jahrhundert hinein hat man sich Europa über große Flächen als Urwald vorzustellen. Weite Teile des heutigen Deutschlands waren von dichten, dunklen Wäldern bedeckt, besonders rechts des Rheins. Aber auch Kohlenwald (Nordfrankreich), Ardennen, Eifel bildeten geschlossene Waldgebiete. Selbst in gallischen Gebieten, die zur Römerzeit intensiv bebaut worden waren, wie etwa das Pariser Becken, waren die Wälder wieder vorgedrungen. Innerhalb dieser Wälder waren Siedlungen inselhaft verstreut.
Mit der Zunahme der Bevölkerung mussten neue Siedlungsräume erschlossen werden durch die Erschließung von Mooren, Küsten- und Gebirgsregionen und vor allem durch die Rodung von Wäldern. Rodungen im großen Stil setzten im ausgehenden 11. Jahrhundert ein. Diese mühselige Kultivierung veränderte über zwei Jahrhunderte hinweg die Lebensbedingungen, indem sie das Gesellschaftsgefüge, die Wirtschafts- und Herrschaftsformen verwandelte. Um dazu nur einige Stichworte zu nennen: |7|Dörfliche Siedlungen wurden ausgebaut und neu gegründet. Die Distanzen verringerten sich, und ein Straßen- und Wegenetz verband jetzt die vormals inselhaften Orte miteinander. Dadurch wurden die Menschen in Dörfern mobiler, was neben neuen Kommunikations- und Handelsmöglichkeiten auch die Chance zur Landflucht einschloss. Die Grundherrschaft veränderte sich: Anstelle von Diensten für den Fronhof leisteten die Bauern nun Abgaben, was voraussetzt, dass sie ihre selbstständig erwirtschafteten Überschüsse auf dem Markt verkauften, um Geld für den Zins zu erhalten. Damit lockerten sich einerseits Bindungen, andererseits entstanden neue Abhängigkeiten. Die Ausweitung der Siedlungsräume ermöglichte Bevölkerungsbewegungen insbesondere in Richtung der östlichen Teile Mitteleuropas und Osteuropas, wohin zahlreiche Menschen aus dichter besiedelten Gegenden West- und Mitteleuropas zogen.
Außerdem ergaben sich Verschiebungen im Rahmen eines intensiven Urbanisierungsprozesses. Bestehende Städte expandierten und eine europaweite Stadtgründungswelle setzte ein, die ihren Höhepunkt in Deutschland im 13. Jahrhundert erreichte. Um 1300 bestand ein so dichtes Städtenetz, dass die Entfernung von Stadt zu Stadt im Allgemeinen nur einen Tagesmarsch ausmachte. Die weitaus meisten Städte waren mit einigen Hundert oder auch ein-, zweitausend Einwohnern recht klein, es gab nur wenige „Großstädte“ mit mehreren Zehntausend Einwohnern. Auch im Spätmittelalter lebte der größte Teil der Bevölkerung nach wie vor auf dem Land. Der Bevölkerungseinbruch infolge der Pest machte sich im urbanen Lebensfeld allerdings überproportional bemerkbar, da das Zusammenleben auf engem Raum unter problematischen hygienischen Bedingungen die Ausbreitung von Infektionen beschleunigte.