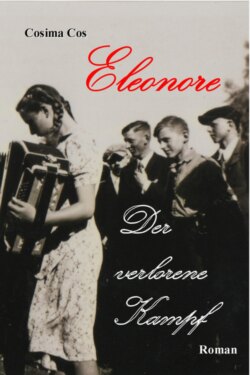Читать книгу Eleonore - Der verlorene Kampf - Cosima Cos - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Telefonanruf
ОглавлениеEleonore legte ihren Federhalter zur Seite, nahm den Roller mit dem Löschpapier und fuhr damit einige Male über den Brief. Ganze sechs Seiten hatte sie geschrieben. Was waren das damals für schreckliche Erlebnisse! Langsam tauchte sie aus der Vergangenheit auf und registrierte die Gegenwart. Sie nahm die beschriebenen Briefbögen, faltete sie, steckte sie in einen Briefumschlag, beschriftete diesen und klebte eine Briefmarke herauf. Gedankenverloren schaute sie ihren Hund an. Er lag neben ihr. Als er Eleonores Aufmerksamkeit für ihn spürte, blickte er sie von unten an, ohne den Kopf zu bewegen. Nur seine Augenbrauen hoben sich und ließen seine großen braunen Augen noch größer und treuer wirken. Eleonore sagte zu ihm gewandt:
„Na Rusty, du hast es vielleicht gut. Über all die Dinge musst du gar nicht nachdenken.“
Sie bückte sich und streichelte ihm liebevoll über Kopf und Rücken. Er legte sich sofort auf den Rücken und streckte alle Viere von sich, um am Bauch gekrault zu werden. Eleonores Hund war ein sehr schöner, weißer Schlittenhund. Er war ungewöhnlich intelligent und gehorchte perfekt. Eleonore hatte viel Zeit in seine Erziehung investiert und große Erfolge erzielt. Durch seinen unbedingten Gehorsam benötigte sie keine Leine bei den Spaziergängen. Rusty entfernte sich niemals unerlaubt. Während Eleonore ihn streichelnd verwöhnte und in ihre Gedanken versunken war, klingelte plötzlich das Telefon. Der Hund sprang erschrocken auf, bellte kurz und horchte. Er drehte dabei seinen Kopf und stellte die Ohren noch mehr auf, als sie ohnehin schon hoch standen. Er schaute Eleonore mit geneigtem Kopf an. Sie musste lächeln, tätschelte ihn etwas und besänftigte ihn:
„Ist ja gut, mein Lieber. Das ist nur das Telefon. Das Geräusch kennst du noch nicht so gut, nicht wahr? Es wird auch nicht zu oft zu hören sein.“
Das Klingeln schallte aus der Ferne und drang in den Raum:
„Ring - ring - ring …!“
Eleonore lauschte nun auch aufmerksam, während ihr Blick durch das Zimmer schweifte und an der Tür heften blieb. Ein klingelndes Telefon war für Eleonore genau so neu, wie für Rusty, denn erst seit drei Tagen gab es ein solches in diesem Gebäude. Das erklärte nun auch Rustys Unruhe, denn er bellte nur bei neuen ungewohnten Geräuschen. Eleonore stand auf und begab sich in Richtung des Telefons. Sie zögerte etwas und überlegte, wer sie denn anrufen könnte. Die Nummer ihres Telefonanschlusses konnte kaum einer kennen, denn sie hatte sie bisher nur ihren Eltern mitteilen können, später wollte sie sie auch an alle Schüler weitergeben. Eleonore wartete, ob das Klingeln endete, doch es läutete unentwegt weiter. Es klang so unwirklich. Sie fühlte sich ein bisschen wie in einem unrealistischen Zukunftsfilm und hoffte, es hätte sich jemand verwählt und würde wieder auflegen. Aber es klingelte kontinuierlich weiter. Dann war es wohl tatsächlich ein Anruf für sie und es konnten somit nur ihre Mutter oder ihr Vater sein.
Eleonore verließ das Zimmer und betrat den Flur ihrer Wohnung. Rusty ging schwanzwedelnd hinterher. Hier im Flur hallte das Telefon wesentlich eindringlicher, was Rusty verlockte, erneut energisch zu bellen. Eleonore beschleunigte ihren Schritt, denn sie war doch neugierig, wer am Nachmittag in ihrer zu dieser Zeit leeren Dorfschule anrief. Eigentlich war sie sich ziemlich sicher, dass es ihre Mutter war. Zügig eilte sie den langgezogenen Flur entlang, kam ins Treppenhaus des Schulgebäudes und stieg die steile Holztreppe hinunter. Nun befand sie sich im Eingangsbereich des Hauses. Rechts neben der Treppe war die große Eingangstür. Sie bestand aus zwei großen Holzflügeln, die Eleonore jeden Morgen weit öffnete. Es sah immer aus, als lade sie alle Kinder mit weit ausgestreckten Armen in ihre Schule ein.
Plötzlich war es ganz still. Das Telefon hatte aufgehört zu klingeln. Eleonore blieb stehen, verharrte und horchte. Kein Ton war mehr zu hören. Nun ärgerte sie sich, nicht schneller gelaufen zu sein, denn die Neugierde hatte gesiegt. Das Telefon hatte die übliche Ruhe genau so schnell zerrissen, wie es sie wieder herstellte. Eleonore schaute sich um, als erwarte sie jemanden. Dann besann sie sich, dass ja nur das Telefon und nicht die Türklingel geläutet hatte und ging zum Klassenraum, der sich direkt gegenüber der Eingangstür befand. Es war ein schönes, geräumiges Klassenzimmer mit vier Tischreihen. Jeweils zwei Reihen standen parallel aneinander, so dass sich die Kinder gegenüber saßen und anschauen konnten. Um zum Lehrerpult zu sehen, mussten die Schüler immer zur Seite blicken, was aber keines der Kinder störte. Auf den Tischen standen ordentlich die Stühle der Kinder. Es gab hier Platz für vierzig Schüler in dem einladend hellen Raum. Die Breitseite hatte vier große Fenster, durch die die Sonne gerne schien und die hellgelb gestrichenen Wände zum Leuchten brachte. An den Wänden hingen viele bunte Bilder der Kinder. Alles sah sehr fröhlich und verspielt aus. Ein schönes, braunes, altes Klavier mit gedrechselten Beinen und zwei Kerzenhaltern mit weißen Kerzen an dem Tastendeckel stand schräg in einer Ecke des Raumes. An dem aus vier Regalböden bestehenden hüfthohen Regal neben dem Klavier lehnten ein Geigenkasten und eine kleine Wandergitarre. Auf dem obersten Regalbrett befanden sich ein Triangel, Klanghölzer, ein Tamburin, eine Rassel aus Muscheln und zwei Schellen. In dem sich darunter befindenden Regalboden stapelten sich Massen an Notenbüchern. Die beiden unteren Regale waren mit diversen Büchern voll gestellt.
Direkt neben dem Klassenzimmer lag das Lehrerzimmer, gegenüber befanden sich die Mädchen- und die Jungentoilette.
Eleonore überlegte, ob sie wieder nach oben in ihre Wohnung gehen sollte, entschied sich aber anders. Sie begab sich in ihr geliebtes Lehrerzimmer. Da sie auf dieser Dorfschule die einzige Lehrerin war, hatte sie sich ihr Lehrerzimmer nach ihrem eigenen Geschmack einrichten können. Es war ein Raum von ungefähr 20 m² mit zwei Fenstern an der linken Wand. Betrat man den Raum, schaute der Besucher sogleich auf Eleonores Schreibtisch, hinter dem ein großer Schreibtischstuhl mit ausladenden Armlehnen Platz fand. Man konnte sich mit ihm drehen, was Eleonore gerne tat, um besser denken zu können. Um besonders abgespannten Schülern ab und zu eine Auszeit zu gönnen, hatte Eleonore vor eines der Fenster einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen gestellt. Dort durften die Schüler sich dann etwas erholen oder in aller Ruhe bearbeiten, was sie in der Klasse nicht schafften. Eleonore horchte auf. Hatte das Telefon nicht eben geknackt? Nein,- es blieb still. Sie verharrte, schaute sich um und versank in Gedanken.
Vor einigen Wochen hatte sie zwei große Gummibäume erstanden. Beide hatten bereits eine stattliche Höhe von zwei Metern erreicht. Sie standen im Lehrerzimmer jeweils in großen Übertöpfen rechts und links neben dem Tisch und breiteten großflächig ihre Blätter über ihn aus. Eleonore liebte Pflanzen, hatte aber kein Händchen für sie. Damit die Pflanzen bei ihr überhaupt eine Überlebenschance hatten, fand sie in der Not eine sehr gute Lösung: ihre Schüler hatten regelmäßig Gieß- und Versorgungsdienste für die Gummibäume. Sogar in den Ferien gab es freiwillige Pfleger. Vorteilhaft war natürlich auch, dass diese Gewächse sehr pflegeleicht waren.
An der rechten Zimmerwand hing eine afrikanische Maske aus Holz und unter dieser stand eine Buschtrommel, die den Kindern bis zum Bauch reichte. Die Kinder liebten es, in dieser afrikanisch, mystischen Atmosphäre in aller Ruhe Arbeiten zu verrichten oder einfach nur einmal abzuschalten und sich träumend hinzusetzen oder vorsichtig die Trommel auszuprobieren, was sie leise durften. Wiederholt fragten die Schüler Eleonore während des Unterrichts, ob sie in den „Erholungsraum“ dürften. Meistens erlaubte Eleonore es ihnen, allerdings war es immer maximal zwei Kindern erlaubt, sich dort aufzuhalten, es sei denn, sie bereiteten einen Vortrag vor. Dann gestattete es Eleonore auch drei oder vier Kindern gleichzeitig. Oft hörte sie die Buschtrommel leise klingen. Aber nie missbrauchten die Kinder ihre Freiheit in dem Lehrerzimmer, tobten dort herum oder stellten Unsinn an. Die Schüler wussten Eleonores Großzügigkeit zu schätzen.
Eleonore hatte den richtigen Weg gefunden, wie man Kindern Verantwortung übertrug, ohne dass sie es ausnutzten. Leider eckte sie mit dieser Idee des Erholungsraums bei den Eltern an. Sie waren den Frontalunterricht gewohnt und wollten ihn auch für ihre Kinder beibehalten. Ihre Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt im Nebenraum spielen dürfen. Diesmal schwor sich Eleonore allerdings, sich nicht unterkriegen zu lassen. Schon einmal hatte sie gekämpft und verloren. Jetzt war Schluss! Dieses hier war ihre Schule und sie wollte bestimmen, was darin geschah.
Mehrfach schon hatte Eleonore Gespräche mit den Eltern geführt, um sie von dem pädagogischen Wert dieses Erholungsraumes zu überzeugen. Das war aber nicht sehr einfach. Letztendlich hatte sie es auch nicht wirklich geschafft und den Kampf aufgegeben, alle überzeugen zu wollen.
Ebenso gefielen den Eltern ihrer Schüler auch nicht die von ihnen selbstständig ausgearbeiteten und vorgebrachten Vorträge. Die Eltern wollten, wenn ihre Kinder schon zur Schule gehen mussten und in der Zeit nicht im häuslichen Betrieb helfen konnten, dass ihre Kinder etwas lernten und zwar mit Disziplin und Ordnung. Kinder hatten still zu sitzen und der Lehrerin zuzuhören. Sie sei verantwortlich für den Unterrichtsstoff und die Art, ihn den Kindern zu vermitteln. Würden ihre Kinder die Vorträge selber vorbereiten, bräuchten sie ja nicht mehr in die Schule zu gehen! Das waren ihre Argumente.
Vor zwei Wochen kam Eleonore auf die Idee, einen Elternabend einzuberufen und den Eltern den pädagogischen Wert ihrer Lehrmethoden näher zu bringen. Sie ließ jedes Kind in Schönschrift eine Einladung schreiben und bat sie, den Eltern den Brief zu geben. Die Hälfte der Schüler kam am nächsten Tag wieder und äußerte, ihre Eltern hätten keine Zeit für Elternabende. Von der anderen Hälfte erschienen letztendlich fünf Eltern. Und das waren diejenigen, die Eleonores revolutionären pädagogischen Ideen schon zuvor gut fanden.
Das Schultelefon stand im Lehrerzimmer. Eleonore hatte es auf das große, dunkle, massive Eichenregal, welches an der Wand hinter ihrem Schreibtisch stand, gestellt. Da sie kaum Anrufe erwartete, und um den Versuchungen der Schüler entgegenzusteuern, hatte sie es ganz oben untergebracht. In dem Regal lagerten ebenso alle ihre Utensilien, die sie täglich für die Schule brauchte: Kreide, Stifte, Ordner, Tuschkästen, Schulhefte, Papier und vor allem viele, viele Bücher. Bücher waren ihr heilig und sie besaß mit ihrer 27 Lebensjahren eine beachtliche Sammlung. Ganze vier Regalbretter des fast drei Meter langen Regals waren mit Büchern gefüllt. Zu diesen Zeiten war das eine große Seltenheit, selbst Bücher für die Schüler waren eine Rarität. Noch immer waren die Folgen des Krieges deutlich zu spüren.
Eleonore ging zum Telefon und musste sich ordentlich strecken, um den Hörer zu erreichen. Sie nahm ihn ab, hielt ihn an ihr Ohr und dachte, dass vielleicht doch jemand am anderen Leitungsende zu hören war. Sie horchte kurz, sah den Hörer an, hielt ihn wieder an das Ohr und sagte:
„Hallo, ist da jemand?“
Natürlich kam keine Antwort, stattdessen ein monotoner Pfeifton. Ein bisschen enttäuscht legte sie den Hörer wieder auf die Gabel und wandte sich der Tür zu, um wieder zu gehen. In dem Moment klingelte das Telefon erneut. Eleonore wäre fast in Ohnmacht gefallen, so erschrak sie sich. Ihre Finger wurden ganz kalt und ihr Herz pochte wie nach einem Dauerlauf. Rusty, der ihr gefolgt war, schlug sofort an, lief auf das Regal zu, in dem das Telefon stand und sprang an ihm hoch. Eleonore befahl ihm, still zu sein. Als hätte Eleonore einen Ausschalter betätigt, erlosch sein Bellen augenblicklich und er legte sich mit dem Schwanz wedelnd vor das Regal. Eleonore griff rasch nach dem Hörer, hielt ihn an ihr rechtes Ohr und horchte. Es war still, kein Pfeifton, nur ganz leichtes Knistern war zu vernehmen. Vorsichtig, als käme im nächsten Moment etwas Unerwartetes aus dem Hörer, flüsterte Eleonore in der Hörer:
„Ja?! Hallo?“
Es knisterte weiter im Hintergrund, bis eine vorsichtige ebenfalls flüsternde Frauenstimme antwortete:
„Hallo?!“
„Ja, hallo. Wer spricht denn da?“
Eine kurze Pause entstand und dann hörte man:
„Müller! Alwine Müller aus Kiel! - Mutti!“
„Mutti?“, fragte Eleonore nun lauter.
„Eleonore,- bist du es?“, antwortete ihre Mutter nun auch mutiger.
„Ja, ich bin es. Was für eine Überraschung, dass du anrufst. Wolltest du mein neues Telefon ausprobieren? Oder wolltest du sehen, ob dein Telefon funktioniert?“
Es raschelte in der Leitung.
„Ja! Mmh,- nein! Ich... ich dachte, ich rufe 'mal an und frage, wie es dir geht und ob du uns wieder einmal besuchen kommst?“
„Ja, eigentlich wollte ich schon letztes Wochenende kommen, aber ich habe so viel zu tun!“, antwortete Eleonore.
Das entsprach der Wahrheit, aber sie hätte sich dennoch letztes Wochenende für einen Besuch freinehmen können. Parallel zu ihrer Tätigkeit als Lehrerin an ihrer Wittenberger Schule, arbeitete sie noch an einer zwei wissenschaftlichen Arbeiten.
„Aber Kindchen, du musst auch einmal abschalten können. Wenn du immer nur arbeitest, hast du ja keine Freizeit mehr.“
„Mutti,- ich bin doch glücklich mit meiner Arbeit. Sie ist für mich wie Freizeit.“
„So hast du doch nie Zeit, um einmal herauszukommen“, konterte Eleonores Mutter.
„Was soll ich denn machen, wenn ich herauskomme?“, fragte Eleonore und betonte dabei das Wort „herauskommen“ besonders.
„Man muss doch auch einmal neue Leute kennenlernen. Du kannst doch nicht ewig alleine in deiner Schule hocken. Was sollen denn dann die ganzen Leute von dir denken?“
Eleonore wurde etwas grantig:
„Mich interessieren die anderen Leute nicht so sehr wie dich. Sie haben mir jahrelang gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Jetzt möchte ich endlich in Frieden so leben, wie ich es für richtig halte!“
„Denk doch auch einmal an deine Eltern! Was sollen wir denn den Nachbarn, der Familie und den Freunden erzählen? Unsere Tochter sitzt immer nur in der Schule? Sie hat nur noch Zeit für ihre Schüler und nicht einmal mehr für ihre alten Eltern? Du musst doch auch einmal kommen und dich um uns kümmern!“, warf Alwine Müller ihrer Tochter vor.
Nun wurde Eleonore richtig ungehalten, denn sie war das Gejammer ihrer Mutter leid. Erbost antwortete sie:
„Welche Freunde meinst du denn?! Und welche Familie? Meinst du mit Familie Vati, der jeden Tag 12 Stunden arbeitet, dann in die Kneipe geht und nachts laut schnarchend betrunken ins Bett fällt? Oder meinst du Elfrida, die im weit entfernten Stuttgart als halb ausgebildete Krankenschwester Alkoholikern in der Zelle hilft, wieder nüchtern zu werden? Oder meinst du dich, die sich immer nur mit Wäsche und Putzen und Kochen beschäftigt? Aber nein, du meinst wahrscheinlich einen von Vatis acht Brüdern, deren Namen er selbst nicht alle nennen kann? Oder meinst du deine Schwester, bei der wir nach dem Krieg zwei Jahre gnädigerweise in ihrer Gartenhütte ohne Heizung und Wasser wohnen durften? Und das auch nur, weil ich mit Elfrida täglich die Wäsche ihrer fünf Kinder wusch und den Haushalt führte und du sie morgens, mittags und abends bekocht hast? Meinst du das etwa mit Familie?!“
Eleonore war überrascht von ihrer plötzlich aufkommenden Wut, sie bereute bereits das Gesagte und wollte sich gerade entschuldigen, als am anderen Ende nur noch ein Knacken zu hören war.
„Mutti?“, horchte Eleonore in den Hörer. So hatte sie noch nie mit ihrer Mutter geredet. Sie verstand gar nicht, was eben passiert war.
„ ... ach Eleonore“, hörte sie nun ihre Mutter seufzen. „Ich kann doch nichts für unsere Familie. Du weißt aber doch, wie ich es meine! Wir brauchen dich hier zu Hause. Ich muss mich um Anna kümmern und die Wohnung täglich sauber halten, kochen, bügeln und Wäsche waschen. Das schaffe ich kaum noch alleine! Anna ist noch viel zu jung, um mir zu helfen. Ich bräuchte so dringend Hilfe!“
Eleonore hatte gerade noch ihren Wutausbruch bereut, als sich nun ein neuer anbahnte, welchen sie nur schwer in Bann halten konnte:
„Mutti! Warum brauchst du Hilfe? Du hast doch nur ein Kind und eine winzige Drei-Zimmer Wohnung. Du musst nicht arbeiten, sondern hast den ganzen Tag Zeit! Ich kann dir nicht mehr helfen und ich will es auch nicht mehr! Ich führe hier in Wittenberg mein eigenes Leben und du führst in Kiel dein Leben. Ich bin nicht verantwortlich für dich und deine Arbeit, so wie du nicht für mich und meine Arbeit zuständig bist. Du kannst nicht mehr mit meiner Hilfe rechnen. Es geht nicht! Ich bin nur für mich verantwortlich und für meinen Unterhalt. Was habe ich überhaupt für ein Glück, Arbeit zu haben. Und dann auch noch eine Arbeit, die ich liebe. Es bleibt keine Zeit! Es tut mir Leid, aber verstehe das doch endlich!“
Nun wurde Alwine Müller ungehalten und sprach energisch in den Hörer:
„Nein, das verstehe ich nicht, Lori! Da habe ich dich jahrelang großgezogen mit viel Liebe und wir haben unser ganzes Geld in deine Lehrerausbildung gesteckt. Das war für uns auch kein Zuckerschlecken! Oft mussten wir unsere eigenen Bedürfnisse zurückstecken, nur um dir die Ausbildung zu ermöglichen. Immer haben wir versucht, dich zu unterstützen und jetzt, wo ich dich einmal brauche, weil ich mich jahrelang für dich verausgabte, da hast du keine Zeit für mich und Vati! Ich...“
Eleonore hörte ein Schluchzen, dann ein Räuspern. Sie verdrehte die Augen und wurde nun unsagbar wütend. Sie hatte sich geschworen, nie mehr das Gefühl der Dankbarkeit gegenüber ihren Eltern aufkommen zu lassen. Schließlich hatten sich die Eltern damals entschieden, Kinder zu bekommen. Bis auf Anna, sie war kein Wunschkind. Dennoch hatten ihre Eltern auch ihre Freude an ihren Kindern. Eleonore wollte sich nicht mehr ihren Eltern gegenüber verpflichtet fühlen. Sie war erwachsen und unabhängig. Das würde sie nie wieder aufgeben. Entschlossen antwortete sie:
„Ich führe mein Leben und ihr führt das eurige. Gerne komme ich euch einmal am Wochenende besuchen, aber ich habe keine Zeit mehr, um eure Aufgaben mit zu übernehmen. Es tut mir Leid!“
Sie hörte ihre Mutter mit sich ringen:
„Ich verstehe dich nicht mehr. Du hast dich in der letzten Zeit so verändert. Vati ist jetzt … arbeitet immer ... da ist, dann trinkt er viel, was ...“
Es raschelte jetzt unentwegt in der Leitung und Eleonore verstand nur noch Bruchstücke, wie:
„Oh, der Empfang … so schlecht. Ich wollte … für dich... Du erinnerst dich? … besprechen... vorbeikommen ...“
Sie wollte das Gespräch sowieso zu Ende bringen und sagte:
„Mutti, ich verstehe dich nicht. Irgendwie ist die Leitung so schlecht. Kannst du mich besser hören als ich dich?“
„Was hast du ….“, kam die Antwort. Dann erstreckte sich das Telefonat in einem Dauerrauschen.
Eleonore legte auf. Es war Sonntag und sie überlegte kurz, ob sie ihre Eltern in Kiel-Gaarden spontan besuchen sollte. Eigentlich wollte sie die aufgebaute Distanz zu ihren Eltern eher ausbauen als wieder abbauen und endlich ohne Vormund leben. Ihre Eltern hatten ihr ein Leben lang vorgeschrieben, was sie wann, wo, wie, wozu und weshalb zu tun habe. Nun wollte sie endlich zur Ruhe kommen, um ihr Leben selbst zu gestalten. Und das war ihr gerade recht gut geglückt. Leider schien es aber doch nicht so einfach, sich von ihnen abzunabeln. Ihre Eltern hatten ihr tatsächlich jahrelang eine Ausbildung als Lehrerin finanziert. Sie fühlte sich weiterhin zu Dank verpflichtet. Ihre Eltern forderten ihn auch permanent ein. Wie um alles in der Welt kam man aus dieser Zwickmühle heraus?
Für Eleonores Situation kam erschwerend hinzu, dass ihre Eltern der ein Jahr jüngeren Schwester Elfrida eine solche Ausbildung nicht ermöglichen konnten und wollten, obwohl diese liebend gerne den gleichen Weg eingeschlagen hätte. Elfrida hatte damals förmlich um Unterstützung gebettelt, aber ihre Eltern ließen sich nicht erweichen, da das Geld zu knapp war. Somit musste Elfrida nach dem Abschluss der Volksschule in einem privaten Kieler Haushalt als Haushälterin und Kindermädchen hart arbeiten, während Eleonore nach der Flucht die Ausbildung als Lehrerin in Kiel und Ahrensbök zu Ende bringen konnte.
Trotz der Umstände wollte Eleonore endlich das Gefühl der Dankesschuld gegenüber ihren Eltern ablegen. Sie wollte sich nicht weiter vorhalten lassen, zum Dank verpflichtet zu sein und deshalb das tun zu müssen, was ihre Eltern ihr vorschrieben. Eleonore ahnte, dass es erst möglich wäre, sich von den Eltern gefühlsmäßig zu trennen, wenn sie den Kontakt auf das Minimum reduzierte. Aber irgendwie konnte sie dann doch nicht so kaltherzig sein.
Das Schlimmste an der Situation war allerdings, dass sie noch Anna , ihre kleine fünfjährige Schwester hatte, die bei den Eltern lebte. Sie war sehr niedlich, hatte langes, glattes blondes Haar, das ihr die Mutter immer zu Zöpfen flocht. Ihr Gesicht war so süß mit der hohen Stirn und der entzückenden Stupsnase. Die blauen Augen strahlten viel Lebenslust aus und ihre vollen roten Lippen vollendeten das Bild des bezaubernden Mädchens. Vom Körperbau war Anna sehr zart und dünn. Eleonore liebte ihre kleine Schwester über alles und war sehr traurig, dass sie sie nach ihrem Umzug nach Wittenberg nicht mehr so oft sehen konnte. Auch Anna hing sehr an ihrer großen Schwester Eleonore und weinte erbärmlich, als Eleonore ihr erzählte, dass sie nun nach Wittenberg ginge.