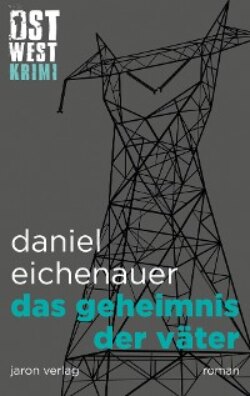Читать книгу Das Geheimnis der Väter - Daniel Eichenauer - Страница 11
Jakob Chrumm, 1981
Оглавление«Am nächsten Wochenende fahren wir nach Braunschweig», verkündete meine Mutter eines Tages und bereitete damit den Boden für das Unheil, das uns Jahre später heimsuchen sollte.
Am nächsten Wochenende fahren wir nach Braunschweig. Meine Großmutter sollte uns begleiten. Ich traute meinen Ohren nicht. Braunschweig? Ich wusste zwar, dass Onkel Leberecht – als Bruder meines Großvaters war er eigentlich nur mein Nennonkel – Gutsbesitzer in der Nähe von Braunschweig war, allerdings hatte sich die Kontaktpflege bisher auf eine Postkarte zu Weihnachten beschränkt. Das hatte seine Gründe. Onkel Leberecht legte größten Wert darauf, nicht als ein Bauer auf einem schnöden Hof abgestempelt zu werden. Er war etwas anderes, etwas Besseres. Eben Gutsbesitzer. Die Schöpfung hatte ihn nicht gerade mit Frohsinn verwöhnt, das Schicksal hatte ihm seine Gattin gesandt, und das Leben hatte den Rest erledigt. Als einziger Trost war ihm sein gefestigter Klassenstandpunkt geblieben, der ihn auf seinem Gut ein strenges Regiment führen ließ. Selbst mit zunehmendem Alter, bereits 82-mal hatte er Geburtstag gefeiert, war er nicht milder geworden. Das Verhältnis zu seinen beiden Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, war seit deren Kindheit unverändert schlecht geblieben. Doch an ihm lag das natürlich nicht! Diese undankbare, missratene Brut hatte es doch nur auf das Erbe abgesehen!
«Man kann sich seine Familie eben nicht aussuchen», schnaufte meine Mutter, während sie die Koffer ins Auto lud. Sie schlug die Heckklappe zu und schaute gequält. Meine Großmutter lächelte zaghaft.
Meine Freude auf die erste Reise, die mich aus Berlin hinausführen sollte, erlitt am Grenzübergang Dreilinden einen herben Rückschlag. Wir gerieten in einen endlosen Stau, und das graue Dach, das über den albernen Kontrollhäuschen des Grenzübergangs auf zahlreiche Metallstreben gespannt war, näherte sich nur unerträglich langsam. Meine Mutter schaltete nach allen paar Metern, die wir vorgerückt waren, den Motor aus. Gelangweilt beobachtete ich, wie einige der Fahrer neben uns ausgestiegen waren und ihre Autos schoben – Rentnerautomobile, an deren Heckscheibe unzählige Aufkleber von klingenden Orten wie Cochem oder Würselen prangten, und andere mit Atomkraft-nein-danke-Aufklebern.
Meine Mutter schaute abfällig zu ihnen hinüber. «Wer sein Auto liebt, der schiebt!», höhnte sie und startete wieder den Motor, um ein Stückchen vorzurücken.
Grenzer patrouillierten durch die Autoreihen vor den Häuschen und fragten jeden Fahrer in breitem Sächsisch: «Haben Sie Waffen, Funkgeräte?»
Nach einigen Stunden kamen wir endlich am ersten der mickrigen Kontrollhäuschen an. Meine Mutter ermahnte mich, dass dieses Hüttchen und ihre Bewohner ernst genommen werden wollten – auch wenn es schwerfalle. Der Wärter in Häuschen Nummer eins nahm unsere Pässe entgegen, schaute uns scharf an, legte die Dokumente beiseite und gebot uns weiterzufahren.
«Wo sind denn unsere Pässe hin?», wunderte ich mich.
«Die fahren jetzt auf einem Rollband in das nächste Häuschen, und da bekommen wir sie wieder», erklärte meine Mutter.
Die graue «Pass-Rollbahn» machte seltsame Geräusche. Das Dach über dem Rollband wirkte noch alberner als der Rest der Maschinerie. Der Wärter in Häuschen Nummer zwei gab uns schweigend die Pässe wieder, schaute sich aber zuvor unsere Namen und Gesichter noch einmal genau an.
«Und dafür mussten wir jetzt so lange warten?», fragte ich laut.
«Pst!», zischte meine Mutter.
Nachdem uns die Sphinx hatte passieren lassen, durften wir endlich die ersehnte Transitautobahn befahren. Das Tacktack-tacktack-tacktack der Autoreifen auf den Betonplatten machte mich zwar schläfrig, aber meine Neugier siegte. In unregelmäßigen Abständen standen auf den Parkplätzen kleine, raupenartige Baracken. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen.
«Das sind Intershops», erklärte meine Mutter. «Da kann man zollfrei Zigaretten, Alkohol und Ähnliches kaufen.»
«Bäh!», rief ich aus.
«Die haben auch andere Sachen.»
Mein Misstrauen aber war geweckt. Deutlich konnte ich mich an eine Szene erinnern, die sich in der Weihnachtszeit zugetragen hatte. Damals hatte ich meiner Großmutter einen Besuch abgestattet. Als ich ins Haus getreten war, hatte ich sie in der Küche hantieren gehört und zunächst durch den Türspalt gespäht. Ich traute meinen Augen kaum: Auf dem Holztisch in ihrer gemütlichen, alten Küche stand ein großes Paket, um das herum Schokoladentafeln, Päckchen mit Kaugummis und Gummibärchen und anderes, was ein gutes Weihnachtsgeschenk ausmachte, lagen. Strumpfhosen und Deo irritierten mich aber. Je länger ich nachdachte, desto seltsamer kam mir das alles vor. Meine Großmutter neigte üblicherweise nicht zu Übertreibungen, das hier aber war der Inbegriff des Überflusses. Was hatte das nur zu bedeuten? Offenbar bereitete sie eine Weihnachtsüberraschung für mich vor. Ich sollte ihr Zeit geben, die Sachen vor mir verstecken zu können. Vorsichtig schlich ich von der Küchentür zurück. Der alte Boden knarrte.
«Jakob? Bist du schon da? Wie schön! Ich bin in der Küche. Komm doch zu mir!»
Ich stutzte. Zaghaft öffnete ich die Tür. Als ich eintrat, ging meine Großmutter um den Tisch herum und sah konzentriert auf einen Zettel, den sie in der Rechten hielt. Die Linke hatte sie in ihre Hüfte gestemmt. Ihr weißes Haar war zusammengebunden. Sie murmelte etwas vor sich hin. Als sie mich sah, ließ sie den Zettel sinken, lachte und hob mich hoch.
Ich schaute auf den Tisch und heuchelte Überraschung. «Oh, so viel Schokolade, wie toll!» Ich befreite mich aus ihren Armen und wollte die Sachen genauer inspizieren.
«Finger weg, das ist nicht für dich!»
Wie bitte? Meine Traumblase platzte. Ich war entsetzt. Wie konnte sie nur so herzlos sein?
«Das ist für deinen Onkel Ortwin und seine Familie in Chemnitz.»
Genau genommen war auch Onkel Ortwin gar nicht mein Onkel, sondern einer ihrer Brüder. Ihre eigensinnige Wortwahl betraf nicht nur ihn, sondern auch seinen Wohnort: Den Namen «Karl-Marx-Stadt» durfte niemand von uns in den Mund nehmen.
«Aber … warum bekommt er all die schönen Sachen und ich gar nichts?», fragte ich enttäuscht. «Die kann er sich doch selbst kaufen wie alle anderen Erwachsenen auch!» Wahrscheinlich hatte ich meine Großmutter nur in einem ungünstigen Moment erwischt, und sie versuchte nun mit Ausreden, ihre Überraschung für Weihnachten zu retten, überlegte ich.
Doch sie beugte sich zu mir herunter und sagte im verschwörerischen Tonfall: «Du weißt doch, dass Onkel Ortwin drüben wohnt.»
«Und deswegen bekommt er alles und ich gar nichts? Das ist gemein!»
«Red keinen Unsinn!», wies sie mich zurecht und fügte streng hinzu: «Die Menschen da drüben bekommen gar nichts!» Energisch schnaufend legte sie eine Packung Kaffee ins Paket. «Deswegen schicken wir ihm ja diese Sachen. Onkel Ortwin kann nicht einfach in einen Laden gehen und sich Dinge kaufen, die er gerne hätte. Dinge wie diese bekommt man drüben eben nicht so leicht.»
Ich hatte das damals ungerecht gefunden und sogar noch ein Stofftier von mir für Onkel Ortwin dazugelegt.
Nun aber brachten die Raupenbaracken an der Autobahn die Wahrheit ans Licht: Dort konnte man doch alles kaufen! Ich fühlte mich belogen und betrogen.
«Im Intershop kann Onkel Ortwin nichts einkaufen, dort kann man nur mit D-Mark bezahlen», belehrte mich meine Mutter, als ich sie darauf ansprach, und blickte finster geradeaus auf die Autobahn.
«Die nehmen ihr eigenes Geld nicht?» Ich verstand das alles nicht. «Warum kaufen wir dann nicht dort ein, wenn da alles günstiger ist?» Ich wollte der Wahrheit auf den Grund gehen.
«Wir werden diesen Staat nicht unterstützen!», erwiderte meine Mutter knapp und ließ keine weitere Diskussion zu.
Schweigend sah ich aus dem Fenster. So würde ich nie erfahren, ob der Onkel dort tatsächlich nicht einkaufen konnte. Während ich grübelte, kam es mir so vor, als stünden fast ebenso viele DDR-Fahrzeuge am Rand der Autobahn, wie auf ihr unterwegs waren – meist mit geöffneter Motorhaube. Die fahrtauglichen Autos waren überwiegend voll besetzt, und ihre Insassen winkten mir stets freundlich zu, auch wenn sie in den kleinen Fahrzeugen arg zusammengequetscht wirkten.
Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als meine Mutter laut triumphierend «Da ist wieder einer!» rief und auf den Straßenrand zeigte, an dem ein mit Tarnnetzen abgedeckter Polizei-Lada stand. Kurz darauf, vor dem nächsten Parkplatz, führte ein Volkspolizist am Rand der Autobahn ein seltsames, aber beeindruckendes Tänzchen auf, bei dem er so gekonnt mit einem schwarz-weiß gestreiften Stock herumfuchtelte, dass man sich gar nicht daran sattsehen konnte. Ein Verkehrssünder sollte zur Strecke gebracht werden. Meine Mutter hielt sich genauestens an die zugelassene Höchstgeschwindigkeit, denn auch in dieser Hinsicht wollte sie «diesem Staat kein Geld in den Rachen werfen».
Das war auch nicht nötig, denn nach einer Weile erreichten wir die Grenze. Die westdeutsche Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung erschien mir wie ein Werbetrick: Nach der stundenlangen «Hunderterei» in der Zone sollte der freie Bürger auch endlich freie Fahrt haben. So flogen wir durch Niedersachsen, und nachdem wir die Autobahn verlassen hatten, führte uns eine Landstraße durch zahlreiche kleine Örtchen.
«Toll, dass hier vor jedem Dorf steht, wie es heißt», freute ich mich.
«Jetzt mach dich nicht dümmer, als du bist!», sagte meine Mutter ärgerlich.
Meine Großmutter kam mir zur Hilfe. «Woher soll der Junge die gelben Schilder denn kennen? In Berlin brauchen wir so etwas schließlich nicht!»
Bald erreichten wir eine kleine Anhöhe, von der aus man eine prächtige Einfahrt sehen konnte. Ein großes schmiedeeisernes Tor thronte zwischen zwei hohen Säulen, die den Weg zu einem kleinen Schloss bewachten.
«Da wohnt Onkel Leberecht», flüsterte meine Großmutter.
Wir passierten das mächtige Tor und fuhren über das alte Kopfsteinpflaster an hohen Scheunen vorbei auf das große alte Gutshaus zu. Es war hell gestrichen, hatte ein rotes Dach und kleine Gauben. An den Hausecken rankten Rosen empor. Die grünen Fensterläden waren geöffnet, und eine kleine Treppe führte zum Eingang, über dem ein prächtiges Vordach thronte.
Onkel Leberecht öffnete die Tür. «Der Junge ist ja groß geworden, groß geworden, ni wa, ni wa!», rief er zackig aus und schüttelte mir die Hand. Wie hätte er wohl gestrahlt, wenn ich die Hacken zusammengeschlagen hätte!
«Und das ist alles deins?», fragte ich staunend. «Ich will auch Bauer werden!»
Von der Diele, die die arme Haushälterin täglich mit kochendem Wasser schrubben musste, führte eine breite Treppe aus dunklem Holz hinauf ins Obergeschoss, das schon lange keine Rolle mehr im täglichen Leben meines Onkels spielte und nur noch selten von Gästen genutzt wurde. Onkel Leberecht ging voran, um uns die Zimmer zu zeigen. Düstere Bilder hingen an den Wänden. Und die Ahnen beobachteten uns finster aus ihren Holzrahmen, als wir die knarrende Treppe emporstiegen. Es fiel kaum Licht in den Flur, der Fußboden ächzte. Das Zimmer, das mir der Onkel zuwies, war ebenso trostlos wie dunkel. Alte Tapeten klebten an den Wänden, die staubigen Vorhänge waren zugezogen. Aus der Mode gekommene Möbel der frühen Fünfzigerjahre waren in diesem Raum abgestellt und warteten auf eine neue Verwendung. Es roch muffig. Hier war man lebendig begraben. Seufzend setzte ich mich auf die Bettkante. Ich hörte meine Mutter im Nebenzimmer fluchen.
«Im Dorf ist am Wochenende Schützenfest, Schützenfest, ni wa, ni wa!», schmetterte Onkel Leberecht, als wir gemeinsam Kaffee tranken.
Meiner Großmutter fiel fast die Kaffeetasse aus der Hand. Entsetzt sah sie den Onkel an. Meine Mutter ließ die Kuchengabel sinken und schaute wiederum ihre Mutter verblüfft an.
«Hurra!», rief ich und freute mich.
Es war noch früh am Abend, vielleicht gegen achtzehn Uhr, als wir zum Festplatz gingen, doch die ersten Betrunkenen wankten uns bereits entgegen. Schon von Weitem hörte man die Musik aus dem Festzelt. Onkel Leberecht steuerte auf einen Bierwagen zu, vor dem zwei Männer im Alter meiner Mutter standen. Einer von ihnen trug ein gelbes Sakko und eine schmale schwarze Lederkrawatte.
«Bitte nicht!», flehte meine Mutter leise.
Schon beim Kaffeetrinken hatte Onkel Leberecht unverhohlen die Meinung geäußert, dass meine Mutter endlich einen vernünftigen Mann finden solle. Einen vom Lande. Einen aus gutem Hause. Seine Familie solle schließlich guten Umgang haben. Und nun stellte sich heraus, was er damit meinte. Den Mann mit dem gelben Sakko machte er uns als Thomas Deuchter bekannt. Mit dessen Vater Eberhard sei er bereits seit Kindertagen befreundet, tönte er. Warum Eberhard Deuchter mit Onkel Leberecht befreundet war, wusste niemand mehr, jedoch war seine Familie für Onkel Leberecht ohne jeden Zweifel «guter Umgang».
Thomas Deuchter schien sich darum allerdings nicht zu scheren. Er war nicht einmal umgänglich. Ein Gespräch kam kaum in Gang, aber Onkel Leberecht bekümmerte dies nicht. Familie ist Familie. Punktum! Die abweisende Haltung Deuchters war förmlich mit den Händen zu greifen. Einzig sein Freund Georg Chrumm hielt das Gespräch am Leben, nicht zuletzt, weil er in Berlin arbeitete. Aber was genau er dort machte, begriff ich trotz all seiner Erklärungsversuche nicht. Dass er im Hahn-Meitner-Institut, einem Forschungsreaktor in Wannsee, irgendetwas mit Atomen zu tun hatte, war das Einzige, was ich damals verstand. Chrumm war ein zurückhaltender und vornehmer Herr, gut gekleidet und höflich, ein Mensch, zu dem man schnell Vertrauen fasste – das genaue Gegenteil von seinem Freund Thomas Deuchter.
Da Onkel Leberecht keinen Widerspruch duldete, waren Thomas Deuchter und Georg Chrumm am nächsten Tag zum Abendessen eingeladen. Nach dem Essen wollte ich mir die Traktoren anschauen. Meine Mutter war jedoch dagegen, und so schlich ich mich verstohlen aus dem Haus. Das Licht schien nur spärlich durch das halboffene Tor in die riesige Scheune. Eine Schwalbe flatterte im Giebel umher. Plötzlich hörte ich Stimmen. Ich erschrak.
«Warum hast du so lange gewartet, verdammt?», zischte eine Männerstimme.
Vorsichtig tastete ich mich an den großen Traktor heran und versteckte mich dahinter. Ölgeruch stieg mir in die Nase.
«Kannst du ihm vertrauen?»
«Ja, natürlich!», flüsterte ein anderer.
«Du unternimmst nichts weiter, verstanden? Ich veranlasse alles Notwendige.»
Ängstlich blickte ich an dem großen Motorblock vorbei. Im Dämmerlicht konnte ich die Gesichter der beiden Männer nicht erkennen. Ich sah nur, wie der eine dem anderen etwas in die Hand legte. Dann drehten sich die beiden um. Vor Schreck trat ich einen Schritt zurück, doch ich blieb mit dem Fuß an etwas hängen. Hektisch versuchte ich mich zu befreien, als auf einmal einige Schaufeln und Forken scheppernd zu Boden krachten. Ich schrie leise auf.
«Was war das?», raunte der eine.
«Wer ist da?», rief der andere drohend.
Ich zog meinen schmerzenden Fuß unter den Geräten hervor und wollte wegrennen. Doch als ich mich umdrehte, stieß ich gegen einen Mähdrescher und fiel hin.
«Komm heraus, wir wissen, dass du da bist!»
Unter der Maschine hindurch sah ich die Füße der beiden Männer auf mich zukommen.
«Was hast du denn hier zu suchen?», fuhr mich Thomas Deuchter an.