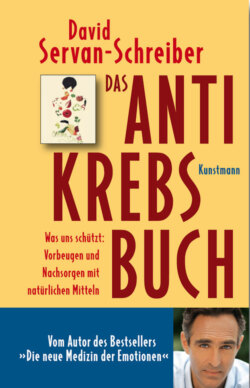Читать книгу Das Antikrebs-Buch - David Servan-Schreiber - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 5
DIE SCHLECHTE NACHRICHT ÜBERBRINGEN
ОглавлениеEINE SCHWERE KRANKHEIT KANN furchtbar einsam machen. Wenn eine Affenhorde in Gefahr gerät und die Affen Angst haben, drängen sie sich instinktiv zusammen und beginnen, sich gegenseitig hektisch zu lausen. Dadurch wird die Gefahr zwar nicht gebannt, aber zumindest fühlen die Tiere sich nicht mehr so allein. Unsere westlichen Werte mit ihrem Kult um konkrete Ergebnisse lenken manchmal unseren Blick ab von dem grundlegenden, animalischen Bedürfnis nach Nähe, wenn wir in Gefahr oder unsicher sind. Sanfte, konstante, verlässliche Nähe ist oft das schönste Geschenk, das uns unsere Familienangehörigen und Freunde machen können, aber leider wissen das nur die wenigsten.
Ich hatte einen sehr guten Freund in Pittsburgh, Arzt wie ich, mit dem ich in unerschöpflichen Diskussionen die Welt neu erfand. Eines Morgens ging ich in sein Büro und teilte ihm mit, dass ich Krebs hatte. Bei meinen Worten wurde er blass, zeigte aber kein Gefühl. Als Arzt wollte er instinktiv Behandlungsvorschläge machen, wollte mir etwas Konkretes bieten, eine Entscheidung, einen Plan. Aber ich war bereits bei den Onkologen gewesen, in dieser Hinsicht konnte er mir nicht weiterhelfen. Weil er mir unbedingt konkrete Vorschläge machen wollte, verkürzte er unser Gespräch ungeschickt. Er hatte mir mehrere praktische Ratschläge erteilt, aber er hatte mich nicht spüren lassen können, dass ihn meine Mitteilung berührte.
Als wir viel später noch einmal darüber sprachen, erklärte er ein wenig verlegen: »Ich wusste nicht, was ich sonst hätte sagen sollen.« Aber vielleicht ging es auch gar nicht darum, überhaupt etwas zu sagen.
Manchmal bringen uns die Umstände dazu, die Bedeutung der Nähe neu zu entdecken. Dr. David Spiegel berichtet von einer Patientin, Leiterin eines Unternehmens, die mit dem Leiter eines anderen Unternehmens verheiratet war. Beide waren Workaholics und daran gewöhnt, ihr Leben bis ins kleinste Detail durchzuplanen. Als sie krank wurde, sprachen sie ausführlich über Behandlungsmöglichkeiten, aber kaum über ihre Gefühle. Eines Tages war sie nach der Chemotherapie so erschöpft, dass sie im Wohnzimmer auf dem Teppich zusammenbrach und nicht mehr aufstehen konnte. Zum ersten Mal weinte sie. Ihr Mann erinnert sich: »Alles, was ich sagte, um sie zu beruhigen, machte es nur noch schlimmer. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also setzte mich schließlich zu ihr auf den Boden und weinte mit ihr. Ich dachte, ich hätte völlig versagt, weil ich nicht mehr für sie tun konnte. Tatsächlich aber fühlte sie sich gerade dadurch besser – weil ich nicht mehr versuchte, das Problem zu lösen.«
In unserer Kultur, in der Kontrolle und aktives Handeln einen so hohen Stellenwert besitzen, hat bloße Anwesenheit stark an Wert verloren. Wenn Gefahr oder Leid droht, treibt uns eine innere Stimme weiter: »Steh nicht rum. Tu etwas!« Doch in manchen Situationen würden wir den Menschen, die wir lieben, gern sagen: »Hör auf, unbedingt etwas tun zu wollen. Bleib einfach da!«
Manche Menschen finden die richtigen Worte und sagen das, wonach wir uns am meisten sehnen. Ich fragte eine Patientin, die während ihrer langwierigen, anstrengenden Brustkrebsbehandlung sehr gelitten hatte, was ihr am meisten geholfen habe, stark zu bleiben. Sie überlegte mehrere Tage und schickte mir dann folgende E-Mail:
Ganz am Anfang meiner Krankheit gab mein Mann mir eine Karte, die ich mir bei der Arbeit an meine Pinnwand vor den Schreibtisch hängte. Ich las sie immer wieder. Darauf stand:
Vorne: »Öffne diese Karte und halte sie an dein Herz. Jetzt drück sie.« Innen hatte mein Mann geschrieben:
»Du bist mein Ein und Alles – mein Lichtblick am Morgen (auch an den Tagen, an denen wir keinen Sex haben!), mein sexy, warmherziger, lachender Vormittagstagtraum, du bist bei mir in der Mittagspause, auch wenn du nicht da bist, meine Vorfreude am Nachmittag, meine Beruhigung und Freude, wenn ich nach Hause komme, meine Muntermacherin beim Fitnesstraining, mein Sous-Chef in der Küche, meine Gefährtin, meine Geliebte, mein Alles.«
Auf der Karte stand weiter: »Alles wird gut.« Darunter hatte er geschrieben: »Und ich werde dir immer zur Seite stehen. In Liebe P.J.«
Und er stand mir die ganze Zeit zur Seite. Seine Karte bedeutete mir so viel und gab mir während der langen Behandlung Hoffnung.
Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
Mish
Besonders schwer fällt es uns, den Menschen, die wir am meisten lieben, die Nachricht der Erkrankung zu überbringen. Bevor ich selbst an Krebs erkrankte, hatte ich in meinem Krankenhaus jahrelang ein Seminar für Ärzte gehalten mit dem Titel: »Wie man schlechte Nachrichten mitteilt«. Schon bald musste ich erkennen, dass die Aufgabe viel schwieriger ist, wenn es um einen selbst geht.
Tatsächlich fürchtete ich mich so sehr davor, meiner Familie von meiner Krankheit zu erzählen, dass ich es immer wieder hinausschob. Ich war in Pittsburgh, meine Familie in Paris. Die Nachricht war für sie mit Sicherheit ein Schock, und mit diesem Schock mussten sie dann leben. Zuerst sprach ich mit meinen drei Brüdern, einem nach dem anderen. Zu meiner ungeheuren Erleichterung reagierten sie auf eine einfache, direkte Art. Sie wurden nicht panisch; sie versuchten nicht, mich oder sich mit ungeschickten Phrasen zu beruhigen. Sie sagten nicht: »Das ist nicht so schlimm. Du wirst es schon überstehen.« Abgedroschene Worte, die ermutigend klingen sollen, aber von jedem gefürchtet werden, der sich fragt, welche Überlebenschancen er hat. Meine Brüder fanden die richtigen Worte, verliehen ihrem Schmerz Ausdruck, zeigten mir, dass sie Anteil an dem nahmen, was ich durchmachen musste, und dass sie mir beistehen wollten. Und das war es, was ich wirklich brauchte.
Als ich meine Eltern anrief, hatte ich trotz der »Vorübungen« mit meinen Brüdern keine Ahnung, wie ich ihnen die schlechte Nachricht beibringen sollte. Ich hatte schreckliche Angst. Meine Mutter war in Zeiten der Not stets eine Quelle der Stärke, doch mein Vater war alt geworden, und ich spürte seine Verwundbarkeit. Obwohl ich damals noch kein Kind hatte, wusste ich, dass es viel schmerzlicher sein kann, von der Krankheit eines Kindes zu erfahren als von der eigenen.
Als mein Vater auf der anderen Seite des Atlantiks den Hörer abhob, konnte ich hören, wie er sich über meinen Anruf freute. Das Herz wurde mir schwer. Ich hatte das Gefühl, ich würde ihm einen Dolch in die Brust stoßen. Schritt für Schritt befolgte ich die Regeln, die ich meinen Kollegen beigebracht hatte: Zuerst soll man einfach die Fakten darlegen, ohne Drumherumreden: »Papa, ich habe Krebs, einen Gehirntumor. Alle Untersuchungen bestätigen das. Es ist ziemlich ernst, aber nicht die schlimmste Form. Es bestehen gute Aussichten, dass ich noch einige Jahre weiterleben werde und dass das Leiden nicht zu schlimm sein wird.«
Und dann soll man warten. Man soll die entstandene Pause nicht mit leeren Phrasen füllen. Mein Vater räusperte sich, als ob es ihm die Kehle zuschnüren würde. »Oh David, das kann doch nicht …« Wir hatten nicht die Angewohnheit, über solche Themen Witze zu machen. Ich wusste, dass er verstanden hatte. Ich wartete noch ein bisschen, stellte ihn mir an seinem Schreibtisch vor, in der üblichen Haltung, die ich so gut kannte: wie er sich aufrichtete, um das Problem direkt anzugehen, wie er es sein Leben lang getan hatte. Er war nie einer Auseinandersetzung ausgewichen, auch nicht unter schwierigsten Bedingungen. Aber diesmal würde es keinen Kampf geben. Er musste keinen Schlachtplan entwerfen, keinen flammenden Artikel schreiben. Ich ging zu Phase drei über und sprach über konkrete Maßnahmen. »Ich werde einen Chirurgen suchen, der sobald wie möglich operiert. Und je nachdem, was die Ärzte bei der Operation finden, entscheiden wir, ob danach eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung kommt.« Er hörte zu, er hatte die Nachricht aufgenommen.
Bald darauf erkannte ich, dass die Krankheit mir die Chance gab, so etwas wie eine neue Identität auszuprobieren, die durchaus auch ihre Vorteile hatte. Ich hatte lange Zeit befürchtet, dass ich die Hoffnungen, die mein Vater in mich setzte, nicht erfüllen konnte. Ich war sein ältester Sohn, und ich wusste, dass er Großes von mir erwartete. Obwohl er es nie so deutlich gesagt hatte, wusste ich, dass er enttäuscht war, weil ich »nur Arzt« geworden war. Er hätte es gern gesehen, wenn ich wie er in die Politik gegangen wäre und vielleicht dort Erfolg gehabt hätte, wo er seinen eigenen Erwartungen nicht gerecht geworden war. Und nun wurde ich mit 30 Jahren schwer krank – die Enttäuschung konnte nicht größer sein. Doch auf einmal spürte ich auch eine gewisse Freiheit. Die Verpflichtung, die mich seit meiner Kindheit belastet hatte, war schlagartig verschwunden. Ich musste nicht mehr Klassenerster sein oder der Beste an der Universität oder auf meinem Forschungsgebiet. Ich war befreit von dem ewigen Wettstreit, musste mich nicht mehr mit anderen messen, meine Fähigkeiten und meinen Intellekt unter Beweis stellen. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, ich könnte die Waffen niederlegen und frei atmen. In jener Woche spielte Anna ein Lied für mich, das mich zu Tränen rührte, als ob ich mein ganzes Leben lang auf diese Worte gewartet hätte:
I’m gonna lay down my heavy load
Down by the riverside
I ain’t gonna study war no more
Gonna lay down my sword and shield
Down by the riverside
Ain’t gonna study war no more …