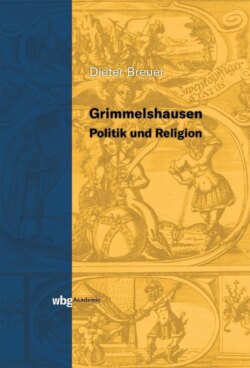Читать книгу Grimmelshausen - Dieter Breuer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеGrimmelshausens Histori vom Vortrefflich Keuschen Joseph in Egypten ist wie alle Schriften dieses Autors gegen die Gattungsnorm der Zeit geschrieben. Ein Vergleich mit dem Joseph-Traktat des oberdeutschen Erfolgsautors Jeremias Drexel, seit 1643 in deutscher Übersetzung benutzbar, macht bei manchen Gemeinsamkeiten im Verständnis der Gattung „Historia“ doch deutlich, daß Grimmelshausen die biblische Vorlage (1. Mos. 37–50) sehr eigenwillig umakzentuiert hat, allerdings nicht, wie bisher geurteilt wurde, in Richtung auf „das Familiäre“, das angeblich „vor den hohen Staatssachen“ rangiere.69 Die Familiengeschichte ist im Gegenteil auf ein Minimum reduziert, die politischen Momente jedoch, die die biblische Vorlage bietet, überproportional und in aktualisierender Weise herausgearbeitet.
Das beginnt – in der Erstfassung von 1666 – bereits beim Obertitel: „Exempel Der unveränderlichen Vorsehung Gottes. Unter einer anmutigen und ausführlichen Histori“. Diese Formulierung deckt sich nur scheinbar mit der geistlichen Argumentation Drexels. Drexel faßt die Joseph-Historia als Darstellung einer mustergültigen christlichen Lebensführung auf. Seine den Erzähltext begleitende Kommentierung („Betrachtung“) berührt alle ihm wichtig erscheinenden Bereiche christlicher Lebensführung, wobei er sich übrigens wie auch sonst auf überkonfessionelle Aspekte beschränkt; er schreibt einleitend:70
Die Historia deß Josephs schicket sich wol auff alle Menschen/weß Stands sie seyen/hohen/niedrigen/reichen/armen/verheurathen vnd vnverheurathen/alten/jungen Männern/Weibern gar wol. Hie finden sie/was Alters/Geschlechts vnd Verstands sie auch nur seyen/lehren genug/sie finden zubetrachten vberflüssig. Der verkauffte Joseph ist ein Meister vnd Spiegel der grössesten Tugenden […]: Von Joseph werden wir all vnterrichtet.
In der Bibel gibt es seiner Meinung nach „keine Histori vnd Geschicht/die zu Einrichtung eines heiligen vnd wol gezierdten Lebens dienlicher“; zu diesem „warhafftigen Controfeyt der herrlichen Gedult/grossen Lieb/wunderbaren Keuschheit/sonderlichen Standhafftigkeit“ gehört nach Drexel u.a. auch vorbildliches Verhalten im politischen Bereich: Joseph ist auch „ein rechtes Muster der hohen Obrigkeit/eines rechtschaffenen Fürstens Controfeyt“.71 Zum Nutzen dieser Historia gehört aber darüber hinaus die vorbildliche Veranschaulichung des Zusammenwirkens von göttlicher Vorsehung und menschlichem Planen und Handeln:72
Diese Historia allein setzet vns die Vorsehung Gottes/als ein rechte Schiltwacht/so nicht vberrauschet [sic] noch vbergangen könnte werden/gantz vor Augen.
Mit einiger Genugtuung macht Drexel den Leser darauf aufmerksam, daß die Joseph-Historia „gleichsamb ein Schrein vnd Behalter bey nahe aller deren Lehren [ist]/welche ich von der Ehnlichkeit vnd Confirmation deß Menschlichen gegen Gottes Willen in meinen Schriften an Tag geben“.73 Soweit Drexel.
Grimmelshausen nun schränkt die bei Drexel noch vorhandenen vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten der Joseph-Historia auf einen speziellen Gesichtspunkt ein, eben den politischen. Der Hinweis auf die „providentia Dei“ im Obertitel steht dieser Auffassung keineswegs entgegen, sondern verweist einerseits wie bei Drexel auf die Zweckbestimmung der Gattung „Historia“, andererseits aber auch, anders als bei Drexel, auf das zentrale Argument gegen die machiavellistische Begründung der Staatsräson und führt damit mitten in die zeitgenössische Auseinandersetzung um die politische Moral im absolutistischen Staat.
Hinweise auf die „göttliche Vorsehung“ finden sich durchgängig in fast allen Episoden der Histori.74 Sie ist Garant für Josephs „künfftige Hochheit“ (14, 17, 19), und an ihr orientiert Joseph sein Handeln als Politiker im Stande der „Hochheit“: „Gott thut Vorsehung in allen Dingen/und hilfft denen zu aller Zeit/die sich auf ihn verlassen.“ (105) Er erkennt sich und seine Gegenspieler in allem, was er und sie auch tun, als Vollstrecker der göttlichen Vorsehung; so äußert er als Regent rückschauend gegenüber seinen Brüdern:
Dann ich bin dessen nunmehr genugsam versichert/daß euer böser Rahtschlag/mich zu verderben/nicht aus Trieb angeborner böser Eigenschafft entsprungen: Sondern durch die Göttliche Vorsehung also verordnet worden/damit ich zu dieser hohen Würde gelangen/und euch und die eurige in dieser grossen Theurung erhalten möge. (113)
Wie wichtig Grimmelshausen diese Überlegung zur religiösen Fundierung politischen Handelns ist, geht auch daraus hervor, daß er sie dem Leser gleich zweimal vorlegt: auch Asaneth macht „den Schluß bey ihr selbsten/daß sie [die Brüder] von der Göttlichen Vorsehung hierzu gemüssigt worden wären/damit Josephs Tugenden der gantzen Welt offenbahr: und so wol sie/als das Egyptische Königreich durch ihn erhalten würden“ (106). Aus dieser Einsicht in die metaphysische Bedingtheit allen Handelns resultieren Josephs unablässige Bemühungen, in Übereinstimmung mit der göttlichen Vorsehung zu handeln. Mittel dazu sind ihm Traumdeutung und Astrologie, die somit wie alle übrigen Prognostikmethoden religiös legitimiert werden,75 sowie „sonderbare göttliche Gnad und sein eigenes scharpffes Nachsinnen“ (18), Gebet und rigorose Affektbeherrschung.
Meine Schlußfolgerung aus diesen Beobachtungen ist einfach: Wenn Joseph, nach religiösen Maßstäben handelnd, als ein überaus erfolgreicher Regent dargestellt wird, dann folgt Grimmelshausen damit ganz der antimachiavellistischen Argumentation, wie sie, richtungweisend für die Staatslehre im 17. Jahrhundert, zuerst von Adam Contzen vorgetragen und von zahlreichen Staatslehrern der Zeit mit Bezug auf ihn übernommen worden ist.76
„Vnica salus est imperantis, ex Dei lege gerere Rempublicam, iustitiam, aequitatemque tueri“ –, auf diese Formel hatte Contzen seine Auseinandersetzung mit dem von ihm so bezeichneten „Pseudopoliticus“ Machiavelli gebracht, übrigens in einer Dedicatio (1628) an sein „Beichtkind“ Kurfürst Maximilian I. von Bayern,77 in dessen militärischen Diensten ja auch Grimmelshausen zeitweilig gestanden und dem der Dichter in Cap. 18 des Springinsfeld ein literarisches Denkmal gesetzt hat.78
Welchem Staatstheoretiker der Contzenschen Richtung Grimmelshausen hinsichtlich des religiösen Fundierungsprinzips der Politik gefolgt ist, ist vorerst noch nicht auszumachen. Gewiß ist nur, daß er 1670 einen ganzen Traktat (Zweyköpffiger Ratio Status) in den Dienst der antimachiavellistischen Argumentation gestellt hat. Die Staatsräson bleibt für ihn an moralisch-religiöse Prinzipien gebunden. „Der“ (!) Ratio Status, so heißt es im einleitenden grundsätzlichen Diskurs dieses Traktats, besteht „principaliter nur in zweyerley Gestalt/nemlich in gut und böß/je nach dem er etwan von rechtmässigen/frommen/Gott und der Welt gefälligen Regenten/oder aber von ungerechten/gottlosen Tyrannen/[…] beherbergt/und ihme Folge geleistet wird“.79 Die lipsianische „prudentia mixta“, die Contzen in seiner Staatslehre (1620) gleichfalls zurückgewiesen hatte, läßt Grimmelshausen ebensowenig gelten: „Dann wo er [„der“ ratio status] mittelmässig/das ist lau/oder halb wild/halb zahm erscheinet; da könnte ich nicht glauben/daß er die Mittel-Straß so genau treffe/daß er sich nicht mehr auff die eine als die andere Seite lencken sollte“.80 Und er kommt zu einem Ergebnis, das ihn als Anhänger der theologisch fundierten frühabsolutistischen Staatslehre der Contzenschen Richtung ausweist:81
Ich wollte sagen/daß er („der“ ratio status) entweder mehrers der Erlaubten ja gebottenen selbst Erhaltung/darzu alles von Gott und der Natur verbunden/sich ereignet/oder den gottlosen Machiauellischen Staats-Regeln zu viel beypflichtet und denen nachöhmet.
Die nachfolgenden Diskurse über die biblischen Bücher Samuelis, auf die sich die frühabsolutistische Herrschaftstheorie stets bezogen hat, dienen Grimmelshausen ausschließlich dazu zu zeigen, „wie gar nichts der Machiauellische Ratio Status gegen denen vermöge/die sich auf Gottes Hilf verlassen und nach seinem heiligen Willen leben“.82
Ist mit dem Titel der Joseph-Histori also bereits der begriffliche Horizont angedeutet, in dem Grimmelshausen sich bewegt, so behandelt die Histori selbst spezielle Probleme monarchischer Herrschaft aus der Sicht der theologisch fundierten frühabsolutistischen Herrschaftstheorie.
Grimmelshausen beginnt seine Histori mit einer Aufzählung von Josephs natürlichen „Gaben“: körperliche Schönheit, ein hoher, scharfer und fähiger Verstand, gutes Gedächtnis und rasche Auffassungsgabe, ein ausgeprägter Lernwille, der sich auf Astronomie bzw. Mathematik, Magia bzw. Philosophia naturalis, Traumdeutung, Arzneikunde, Ackerbau, die „Wissenschaft wol Hauß zu halten“, also die Ökonomie, und fremde Sprachen erstreckt. Hinzu kommen moralische Qualitäten: Joseph ist „sehr demütig/fromb/auffrichtig/redsprechig/freundlich und holdseliger Geberden“, er ist „von Gott selbst zum höchsten beliebt“ (11), „vom gütigen Himmel so erschaffen: Und durch das Gesetz der Natur also unterwiesen/daß er nichts anders als Tugend würckte“ (10), und er vertraut auf das Wirken der göttlichen Vorsehung,
Alle diese tugendhaften Anlagen verweisen auf eine hohe Standesperson, sind zum Teil die traditionellen Voraussetzungen des idealen Regenten.83 Aber dieser hohe Stand ist vorerst nur in den Traumdeutungen seines Vaters als Hoffnung auf „künfftige Hochheit“ (14), „künfftige Würdigkeit“ (17) und Regentenamt ersichtlich. Joseph ist nicht schon geburtsmäßig „ein grosser Herr“, sondern soll es erst noch werden (17). Er verfügt über Regenteneigenschaften und bildet sich im Bewußtsein der „prophezeyten Herrlichkeit“ (19) darin ständig weiter; ist aber sozial gesehen von allen Möglichkeiten des Regierens, – zunächst als Nachgeborener, dann als Leibeigener – abgeschnitten. Damit aber ist die Joseph-Histori auf die Frage des sozialen Aufstiegs eines Tugendhaften, der nicht dem hohen Stand angehört, zugespitzt, – ein Problem, das, wie Koschlig gezeigt hat, auch die Person Grimmelshausen selbst betrifft.84
So ist es nicht verwunderlich, daß im Mittelpunkt der Joseph-Histori die Erörterung der Frage steht, welche politischen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit sich dieser durch göttliche Vorsehung festgelegte, also letztlich nicht aufhaltbare Aufstieg vollziehen kann. Da Grimmelshausen hierbei alternativ vorgeht, können wir auch eine Antwort auf die Frage nach der für den nicht privilegierten Tüchtigen besseren politischen Ordnung erwarten.
Grimmelshausen spielt Josephs Möglichkeiten in zwei unterschiedlichen monarchischen Systemen durch; er stellt dem Regime des alten Pharao das neue Regime des jungen Königs Tmaus gegenüber, welches letztere sich an den Staatszweckbestimmungen der frühabsolutistischen Staatsreform orientiert.
Das Eintreffen Josephs in der „Königlichen Residentz-Stadt Thebe“ (36) gibt Gelegenheit, das alte Regime zu kennzeichnen. Der alte Pharao, „ein abgelebter eyfersüchtiger Herr“, der „der alten geitzigen Art nach/die Baarschafft liebet“, folgt undiszipliniert und unberaten seinen Launen und Abneigungen, seinen vom Eigennutz bestimmten Affektantrieben. Ähnlich verhalten sich die in der Histori erwähnten Inhaber der Hofämter, was vor allem am Beispiel des „Königlichen Kuchenmeisters“ Potiphar illustriert wird; dieser nutzt sein Amt zur persönlichen Bereicherung aus, indem er „etliche Königliche Güter“ zu sich zwackt (71), und betreibt gegen vernünftige Erwägungen und gegen einen warnenden Orakelspruch eitel, „wie alle alte vergeckte Buhler zuthun pflegen“ (39), seine auch politisch motivierte Heirat mit der jungen Selicha.
Noch deutlicher wird die Problematik des alten Regimes in der Figur der Selicha. Diese, „des Königlichen Hoffmeisters Dochter […] die Mutter halber aus Königlichem Stammen geboren war“ (39), entspricht in ihrem affektgeleiteten Verhalten noch weniger als die übrigen hohen Standespersonen den Anforderungen ihres hohen Standes. Gegen „hohe Vernunfft“ und „Tugend“ (48) überläßt sie sich ganz ihren Affekten. Die Ehe mit dem alten Potiphar ist sie nur mit dem stillen Vorbehalt eingegangen, Potiphars Verwalter Joseph für sich zu gewinnen. Anreizen „zum Wollust“, Ausspielen ihrer sozialen Überlegenheit, Mißachtung der höfischen Umgangsformen, Drohungen, Intrigen sind ihre Mittel, um Joseph von seiner Treuepflicht gegenüber seinem Herrn abzubringen, und als nichts fruchten will, rächt sie sich ebenso unbeherrscht an Joseph. Sie ist auch nicht in der Lage, ihre Affekte zu verbergen; man sieht ihr an, „wie Zorn und Lieb in ihrem Gemüth rumorten“ (51; 63), sie muß daher in der Furcht leben, „daß die stumme Wänd auch Ohren haben“ (47). Die göttliche Vorsehung ist für sie nur als beklagenswertes „Verhängnuß“ erkennbar (45f.). Sie stirbt denn auch an einer Gemütskrankheit,85 und da ihr Tod zeitlich mit dem des alten Pharao zusammenfällt, erhält er Sinnbildcharakter für die von Joseph bereits prognostizierte Selbstzerstörung des nicht an „Vernunft“ und „Tugend“ orientierten alten Regimes.
Vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Staatslehre kann nicht überraschen, daß Grimmelshausen den Konflikt zwischen Joseph und den Vertretern des alten Regimes als einen Konflikt um den sozialen Aspekt des Tugendbegriffs (virtus socialis) besonders herausarbeitet. Diese Auseinandersetzung spiegelt sehr genau die Schwierigkeiten wieder, die bei der Durchsetzung der rigorosen neustoizistischen politischen Ethik des Justus Lipsius auftraten, durch die die Souveränität und Machtfülle des absoluten Herrschers vor der Vernunft überhaupt nur gerechtfertigt werden konnte – ein Vorgang, für den G. Oestreich den Begriff der Disziplinierung von Fürst, Beamtenschaft und Untertanen geprägt hat.86
Selicha versucht Josephs Tugendargument zu entkräften, indem sie den Standesunterschied zwischen ihr und ihm ausspielt:
Was! Tugenden? Sagte sie/gehorsam solt sein gröste Tugend seyn/damit er mir verbunden ist […]. (54). Schau nur/wann du gleich aller Welt Tugenden hättest/so werden sie dir doch nicht anstehen/oder zu deiner Beförderung an dir wargenommen werden/und also dir nichts helffen können/weil du ein leibeigner Knecht bist; wann du aber nach meinem Willen lebest/welches du ohne das zu thun schuldig bist/so könnte ich dich frey und glückselig machen/welches dir deine Tugenden nicht leisten können […]. (58)
Damit ist der soziale Status Josephs aus der Sicht des alten feudalen (auf einer ständischen Gesellschaftsordnung beruhenden) Regimes gekennzeichnet: er ist abhängig von der Willkür privilegierter Standespersonen, die ein nicht auf Eigennutz, sondern auf das Wohl der ganzen Sozietät gerichtetes Wertbewußtsein nur so lange gelten lassen, wie es die eigenen Vorrechte nicht stört.
Unverhältnismäßig schroff, wohl weil es auch um die eigene soziale Situation geht, läßt Grimmelshausen Joseph Argumente der frühabsolutistischen Adelskritik vortragen:
Gnädige Hochgebiedente Frau/ich weiß wohl daß ich ein armer verkauffter Knecht bin/aber eben darum muß ich mich um so viel desto mehr befleissen/desto reicher an Tugenden zu seyn; ich weiß wohl/daß ich meiner hochgebiedenten Frauen in Unterthänigkeit zu gehorsamen schuldig bin; aber darneben ist mir auch nicht verborgen/daß sich mein Gehorsam nicht weiter erstreckt/als in billichen Dingen/und nicht in solchen Sachen/die meinem Herren zum Schimpff gereichen; und wann mich schon die Tugenden zu nichts befördern […] so nutzen sie doch meinem Herren/in dem sie mich lernen/ihme treu zu seyn/worzu er mich vornemlich erkaufft hat […]. (59)
Als Nichtprivilegierter kann Joseph nur mit Hilfe seiner Tugenden, seiner moralischen und praktisch-politischen Qualifikation sozial aufsteigen; entsprechend der frühabsolutistischen Staatslehre hat die Gehorsamspflicht des Untergebenen ihre Grenze am natürlichen und göttlichen Recht, und wenngleich das Tugendverhalten des Untergebenen nicht zur persönlichen „Beförderung“ dient, also nicht anerkannt wird, so dient es doch dem größeren Zweck des Gemeinwesens bzw. hier des Hauswesens.
Das ist stoizistisch gedacht, und der Verwalter Joseph ist tatsächlich als pflichttreuer, leistungsbewußter Funktionsträger im neustoizistischen Sinne dargestellt. Unablässiger Fleiß, Gelehrsamkeit mit ständiger Weiterbildung in den Wissenschaften, Freundlichkeit gegenüber seinen Untergebenen und kluge Menschenführung mit dem Ziel, „sonst auf nichts/als auf seines Herrn Nutzen zu gedencken“ (39), dazu Vertrautheit mit den modernen höfischen Umgangsformen und Bescheidenheit und Demut als Berater seines Herrn, – alle diese Tugenden haben ihr Zentrum in seiner Selbstdisziplin, in der Fähigkeit, sich im Vertrauen auf die göttliche Vorsehung „gegenüber allem Vernunftwidrigen fest zu verhalten“,87 bzw., in den Begriffen der neustoizistischen Tugendlehre ausgedrückt, in seiner constantia oder fortitudo. Joseph bleibt, seine Affekte beherrschend, „in Glück und Widerwertigkeit ohnverändert“ (41). Das Ausrufezeichen hinter dem Satz: „Aber sein Vorsatz fromm [d.h. hier: nützlich, rechtschaffen] zu seyn/überwand doch!“ (57), ist ein bezeichnender Autorkommentar im Sinne hartumkämpfter Vernunftorientierung und Selbstdisziplinierung.
Unter dem alten Regime, das führt nun der Autor vor, kann Joseph als nichtadeliger Vertreter der neuen stoizistischen Pflichtenethik nicht reüssieren; er wirkt hier wie ein Fremdkörper, und nicht der soziale Aufstieg, sondern Verleumdung, Gefängnishaft und Morddrohung sind das Ende, das freilich von Joseph stoizistisch als neue Bewährungsprobe aufgefaßt wird (72). Das hierbei auftretende Theodizeeproblem, daß nämlich „die Tugenden endlich auch selbst durch die Laster zerscheidert würden“ (68), löst Grimmelshausen, ganz im Sinne der frühabsolutistischen Staatslehre, durch einen Regimewechsel: der Staat, in dem Joseph ein seinen Fähigkeiten angemessenes Amt findet, muß erst noch geschaffen werden, und zwar entsprechend der absolutistischen Staatsreform, durch Umstrukturierung der bestehenden Gesellschaftsordnung. Die Initiative für die Reform geht dabei, wie üblich, vom (durch Erbfolge legitimierten) neuen Herrscher aus (Reform von „oben“).
Der junge König vertritt wie Joseph die neue, am Gemeinwohl orientierte Staatsauffassung. Er entfernt noch vor seiner Krönung eigennützige, „pflichtvergessene“ Hofbeamten aus ihren Ämtern (78). Vor allem aber geht er – im Sinne der frühabsolutistischen Staatslehre, etwa Contzens – davon aus, daß pietas, die demütige Unterwerfung unter die göttliche Vorsehung, und prudentia, die vorausschauende, auf das Wohl des ganzen Staates bedachte ratio status, untrennbar verbunden sind.88 Dies ist ein Grund für die Glaubwürdigkeit von Josephs Prognose, derzufolge „Gott nicht allein offenbahrt [hat]/daß er [Pharao] Egypten beherrschen soll; sondern auch das wichtige nicht verhalten/so unter seiner Regierung geschehen wird; damit er deswegen bey Zeiten weißliche Vorsehung thue/und Land und Leut im Wolstand erhalte“ (86). Daß Joseph glaubwürdig, weil „zierlich“89 und kenntnisreich, die religiös fundierte Staatsräson vertritt, ist dem König Grund genug, nach kurzer Beratung mit den vornehmsten „Reichs=Ständen“, ihm die Regierungsgewalt zu übertragen:
Wir haben so wohl aus deiner Weißheit und Wissenschaft: als auch aus deinem offenhertzigen Gemüt genügsame Hoffnung geschöpfft/du werdest die Stell des jenigen am besten vertretten können/den du uns zu suchen gerathen hast; Darum nun so sihe/wir übergeben dir des Reichs Siegel/und mit demselben allen Gewalt über gantz Egypten; nichts wird mein Person von sich behalten/als den Königlichen Titul: Zepter/Cron und Thron: hier stehen die Vornemste des Reichs dir zu Gebott/und glauben/du werdest solchen Gewalt/den wir dir geben/nicht mißbrauchen/sondern zu unserer Nation Aufnehmen: Nutzen und Erhaltung anwenden; als welcher Glückseligkeit du dich alsdann auch selbst zu erfreuen hast/vornemlich/wann du ihr also vorstehest/wie wir ein Vertrauen zu dir haben. (87)
Noch deutlicher formuliert der König das Prinzip des religiös fundierten politischen Handelns bei der offiziellen Amtsübergabe:
Befleisse dich derowegen/deiner Weißheit nach/so regieren zu helffen/daß weder die Götter/noch die Völcker der Egyptischen Cron an uns etwas zu tadelen finden mögen. (91)
Diese Übertragung des höchsten Staatsamtes zwischen König und Reichsständen an einen kaum rehabilitierten Nichtadeligen, dazu seine rasche Verheiratung mit der dem Hochadel angehörenden Asaneth – eine politische Heirat, die zugleich Liebesheirat ist –, das liest sich wie ein Märchenschluß und ist auch, gemessen an den sozialen Aufstiegsmöglichkeiten zur Zeit Grimmelshausens, unwahrscheinlich. Dennoch bewegt sich Grimmelshausen auch hier im Umkreis der frühabsolutistischen Staatslehre, der es darum geht, die königliche Zentralgewalt gegenüber den Privilegien der Stände durchzusetzen und die dazu die Institution des dem Gemeinwohl verpflichteten, von den höheren Ständen unabhängigen Beraters vorgeschlagen hat. Allerdings ist meines Wissens das Postulat, den Berater ausschließlich nach seiner (religiös verankerten) prudentia auszuwählen, selten vertreten worden.
Zu dieser Beobachtung paßt, daß sich auch im Teutschen Friedens-Raht, im Kapitel „De Consiliariis. Von Rähten“, eine einschubartige Stellungnahme zu dieser Frage findet, die ähnlich schroff formuliert ist:90
Et paulo post: Es soll auch ein Fürst/das vermögen/geschlecht/oder vorschrifften nicht ansehen/sonder allein den Verstand und geschicklichkeit/dann die ämpter sollen mit personen/und nicht die Personen mit ämptern bestellt werden. Das ist man soll nicht nach favor oder gunst/noch wegen geschenck die dienst verleihen/sonst pflegt man zu sagen/Hat man Geld/so ist er ein Held. Der mit guldenen Äpffeln werfen könnte/der ist ein gewesener Mann.
Wie man diese Stellungnahme auch bewerten mag, Grimmelshausen hat sich in seiner Joseph-Histori auf seine Art mit dem Problem des sozialen Aufstiegs des Tugendhaften auseinandergesetzt: Denkbar erscheint ihm dieser Aufstieg, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, offenbar nur im Rahmen der frühabsolutistischen Staatsreform.
Die positive Bewertung der religiös verankerten absolutistischen Staatsordnung geht auch aus dem weiteren Verlauf der Histori hervor. Joseph kann sich als zielstrebiger Reformpolitiker bewähren. Ausgehend von seinen Prognosen über die künftige wirtschaftliche Entwicklung des Reiches, setzt er gegen den Widerstand der „alten Reichs-Räte“ (93) eine zentral gelenkte Wirtschaftspolitik durch, die durch eine Vorratswirtschaft großen Stils die zukünftige Versorgung des Reiches sichern soll. Gemäß seiner „neuen Ordnung“ (93) läßt er nach einer Visitationsreise, bis zur Erschöpfung der königlichen Schatzkammern, Getreidespeicher anlegen und alles kaufbare Getreide „um landläufigen/und zwar damals sehr wolfeilen Preiß“ (93) aufkaufen. Für den Leser des 17. Jahrhunderts ist dies eine höchst aktuelle Überlegung, da ja bis hin zur Französischen Revolution Mißernten und Hungersnöte oft zu schweren Staatskrisen geführt haben.91 Der Verkauf der Vorräte während der folgenden siebenjährigen Teuerung stellt einmal die Versorgung der Bevölkerung sicher, zum anderen bewirkt er eine völlige Veränderung der Eigentumsverhältnisse zu Gunsten der Krone:
Joseph aber gab niemand kein Getraidt/als um paar Geld/und als solches auch nach und nach/um Früchten/zu des Königs und Josephs Handen kommen war/musten silberne und güldene Geschirr/allerhand Kleinodien/Perlen und Edelgestein/die sonst viel Jahr lang wohl aufgehebt worden/hervor; also/daß bey nahe kein güldner noch silberner Ohren- oder Finger-Ring im Land verblieb/welcher nicht dem Pharao zu Theil wurde; es mochte aber alles nicht erklecken/also/daß die arme Leut/ihr Leben vorm Hunger zu erretten/in den fünff letzten Jahren erstlich ihr Vieh und ligende Güter/ja endlich ihre eigne Leiber zu ewiger Dienstbarkeit/um Proviant dem Joseph verkaufften; Derohalben wurde der König ein Herr über alles/was sich in Egypten befand; nur die Priester/darunter auch Josephs Verwandten verstanden werden/behielten ihre vorige Freyheit und Aecker […]. (120f.).
Um nach Normalisierung der Lage die Bewirtschaftung des neuen Kronlandes sicherzustellen, richtet Joseph „unveränderliche Mäyerhöfe“ ein, die er an Königsleute verpachtet – „in aller Maß und Form/wie man noch heutigs Tags den Bauern die Land-Güter zu verleihen pflegt“ (121), so fügt der Autor aktualisierend hinzu. Auch den außenpolitischen Auswirkungen der „neuen Ordnung“ weiß Joseph zu begegnen; er verhindert den drohenden Krieg mit den gleichfalls von den Mißernten betroffenen Nachbarstaaten durch eine geschickte Außenhandelspolitik, mit dem Ergebnis, „daß Egypten damals seines gleichen Königreich/weder an Macht der Mannschaft/oder Geldmitteln noch Proviant in der Welt nicht hatte“ (104f.). Am Ende steht demnach der nach innen gefestigte und nach außen abgesicherte zentral gelenkte monarchische Machtstaat.
Wie die frühabsolutistischen Staatslehrer sieht auch Grimmelshausen in der zentralen staatlichen Planung und Lenkung des Wirtschaftsprozesses die entscheidende Voraussetzung der Machtbildung im Interesse des Gemeinwohls. Und analog zu jenen versucht er mit seinen erzählerischen Mitteln den Nachweis zu erbringen, daß ein derartiger Prozeß der Machtbildung im Vertrauen auf die providentia Dei nicht unmoralisch verlaufen muß, sondern iustitia und aequitas erst gewährleistet.
Offenbar während der Arbeit am Teutschen Friedens-Raht sind ihm jedoch Bedenken an der Vorbildlichkeit von Josephs Wirtschaftspolitik gekommen. Dort wird nämlich im 3. Teil (cap. 17) die Frage diskutiert, „ob deß Fürsten Schatz besser und sicherer bey seinen Unterthanen/oder in seiner Fürstlichen Schatzkammer seye“.92 Der Autor entscheidet sich gegen die Politik der Schatzbildung, wie sie noch Contzen vertreten hatte,93 und für die Vermehrung des Geldumlaufs; es sei „besser und sicherer/deß Fürsten Schatz sey bey seinen Underthanen“:94
Gleich wie es eine ungestalt eines Menschen/und daß umb denselben nicht wohl stehe/noch lang mit ihm währen könne/ein gewisses Zeichen ist/wann der kopf übernatürlich groß/dick/und geschwollen ist/der leib aber und alle desselben gliedmassen gantz dürr/gar mager/und außgeschmachtet seind: Also stehet es nicht wohl umb das Land/dessen Regent alle der Underthanen Güter und vermögen an sich zeucht/oder dieselben mit ungebürlichen aufflagen außsäuget/und sie arm/sich aber reich machet.
Eine solche Schatzbildungspolitik läuft nach Meinung des Autors Gefahr, den Zweck des Fürstenstaates, die bessere Sicherung des Gemeinwohls, zu verfehlen; der Fürst habe zu bedenken,95
daß ihn Gott umb der Underthanen willen geschaffen habe; Underthanen könten auff allen fall ohn Fürsten wohl leben/und sein/Aber Fürsten können keine Fürsten sein/sie müssen Underthanen haben. […] Dann Gott uns alle eben frey und einem den anderen gleich erschaffen/die Regenten sein allein zu der Underthanen nutz erschaffen/damit sie desto leichter die menschliche und Burgerliche Societät erhalten.
Diese Argumentation greift nun Grimmelshausen in der Fortsetzung der Joseph-Histori, dem Musai (1670) auf. Pharao hat die „schläfferige Andacht“ der Bevölkerung bei einer staatlichen Kultfeier beobachtet und, in Kenntnis der politischen Funktion der Staatsreligion, als Indiz für eine Gefährdung seiner Herrschaft interpretiert:
[…] sollte die Andacht des Volcks samt den Göttlichen Diensten/die sie meinen Vorfahren zuerzeigen gewohnet seyn/fallen; So wäre zubesorgen/daß mein Königlicher Gewalt endlich auch einen Stoß nehmen dörffte. (163)
Joseph, der die Ursache des bedrohlichen Popularitätsverlusts klären und beseitigen soll, berät sich mit seinem Schaffner und Ökonomen Musai, und dieser fordeß dert nun unter Berufung auf göttliches und natürliches Recht mit Vehemenz, die Politik der Mehrung des Staatseigentums zu revidieren:
Ha! Antwortet Musai/was bedarffs vieler Nachgründung? Die arme Tropffen seynd von aller Reichthum und Barschafft durch die Königliche Cammer dergestalt ausgesogen und in Armuth gesetzt worden/daß ihnen Freud und Muth wohl vergehen muß; […] warum hätt er hiebevor dem Pharaone ein Rath geben/dardurch alle Reichthüm der halben Welt in seine Schatz-Cammer zusammen geflossen? Sehet mein Herr! Darum trauret das erarmte Land; dessen Inwohner weder eigne Aecker/noch Häuser/noch Viehe/noch Geld besitzen/noch eigne Herren über ihre eigne Leiber mehr seyn/denen doch Gott und die Natur solche so wohl als dem König den Seinigen zum Eigenthum angeschaffen; Warum liegen die Kauffmanns-Händel allerdings vergraben? Darum/daß dem seuffzenden Volck keine Mittel übrig gelassen worden/gleich: und mit anderen Nationen zu handeln; das arme Volck hat kein Gelt und Pharao läßt es hingegen übereinander verschimlen; Weßwegen ohne Zweiffel mancher arme Tropff Rach über dich schreyet […]. Ich könnte nur zuverstehen geben/daß mich bedunckte/du habest dem Gesetz der Natur nicht so gar gemeß gehandelt/daß du so viel und grosse Schätz allein dem Pharaone zugeeignet/die doch von der Natur gegeben worden/daß nit nur der König/sondern alle Menschen deren geniessen und sich ihrer erfreuen sollten. (163f.)
Josephs Staatsschatzpolitik, die doch ursprünglich nur die zentrale Machtbildung im Interesse und zum Schutze des Gemeinwohls und gegen ständische Partikularinteressen sowie gegen Bedrohungen von außen sichern sollte, hat ihre Eigengesetzlichkeit entwickelt und ist in Konflikt mit dem Gemeinwohl und damit mit den natürlichen Rechten der Untertanen geraten; sie mindert auch nicht mehr die Kriegsgefahr, sondern erhöht sie:
wann ein kriegerischer König auffstünde/der heut oder morgen solchen Schatz zu Waffen und Soldaten anlegte; könnte er nicht als dann die gantze Welt mit Krieg/Mord und Brand betrücken? (164)
Diese von Musai vorgetragene harte Kritik an der Politik des Regenten Joseph gibt insofern Rätsel auf, als sie auch den zunächst selbstverständlichen Vorbildcharakter Josephs in Frage stellt. Die Kritik veranschaulicht, wie ich meine, daß Grimmelshausen seine Auseinandersetzung mit der absolutistischen Staatsauffassung konsequent weitergetrieben hat. Erzählerisches Mittel ist ihm die Figur des Musai. Schon daß Musai religiös weniger stark gebunden ist als Joseph, daß er erst spät (wie übrigens auch Asaneth) durch Josephs Einwirken zum „einigen himmlischen Gott“ (151) konvertiert ist und konfessionelle Toleranz übt (139), daß er sich zeitlebens mit der Magia naturalis beschäftigt und die „Göttliche Allmacht und Wunder an den schönen vielfarbigen Blumen und andern neugebornen Erdgewächsen zu betrachten“ weiß (173), kennzeichnet ihn, von autobiographischen Bezügen einmal abgesehen,96 als Vertreter des neuen irenischen, frühaufklärerischen Denkens, wie es nach 1650 sich im oberdeutschen Raum etwa am Hofe des Mainzer Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn herausbildete.97 Dem entspricht sehr genau die naturrechtlich orientierte Kritik an Folgeerscheinungen der frühabsolutistischen Herrschaftspraxis, die Grimmelshausen seiner Musai-Figur in den Mund legt.
Die politische Argumentation der Joseph-Histori korrigierend, macht Grimmelshausen auf das Dilemma aufmerksam, in das Joseph, der scheinbar so erfolgreiche Vertreter des frühabsolutistischen Machtstaates, ebenso übrigens wie die frühabsolutistischen Staatslehrer Lipsius und Contzen, ungewollt geraten sind. Wie diese Theoretiker die Vermehrung des fürstlichen Aerariums gefordert hatten, um (über die Finanzierung einer Heeresreform) die seinerzeit von innen und außen bedrohte Sicherheit des neuen, am Gemeinwohl orientierten Staates garantieren zu können, – und Maximilian I. von Bayern hatte, ihnen folgend, als erster deutscher Fürst eine solche Politik betrieben, – so rechtfertigt auch Joseph seine Schatzbildungspolitik mit der Abwendung einer staatsbedrohenden Hungerkatastrophe:
du wollest aber auch bedencken/daß anfänglich bey Eintritt der wolfeilen sieben Jahr meine Meynung nicht gewesen/das Volck ins künfftig auszusaugen und unter ein solches beschwerlichs Joch zu bringen; sondern solches in den folgenden 7. Theuren Jahren vor dem Hunger zu bewahren […]. (165f.)
Joseph sieht insofern auch keinen Ausweg, als alle wirtschaftlich vernünftigen Investitionen den Staatsschatz nur vergrössern würden. Nur mit Widerstreben läßt er sich auf den Vorschlag Musais ein, die aufgehäuften Schätze in ein monumentales Bauprogramm zu investieren, um auf diese Weise das stillgelegte Geld in Umlauf zu bringen, den Wohlstand im Lande zu heben und künftige kriegerische Abenteuer zu verhindern. Doch erweist er sich auch darin als ein Vertreter der älteren kameralistischen Lehre, daß ihm das Denken in den Kategorien einer dynamischen, auf möglichst schnelle Geldzirkulation zielenden Wirtschaftspolitik schwerfällt; er hält Musais Monumentalbauten für „eitele Thorheit und unnütze Verschwendung“ (167). Er kann offenbar die Anforderungen der neuen Situation, eine Politik der öffentlichen luxuria zu betreiben, mit seiner religiös fundierten politischen Moral nicht recht in Einklang bringen. Er sieht das moralische Dilemma, in das die absolutistische Staatsauffassung mit Notwendigkeit führen muß, und paßt sich widerstrebend an, während Musai in den Fürstenstand aufsteigt.