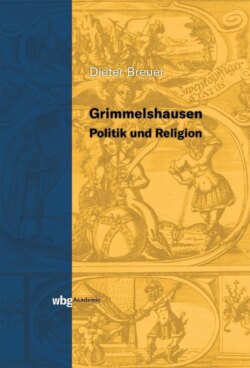Читать книгу Grimmelshausen - Dieter Breuer - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Grimmelshausens Inselutopie I
ОглавлениеDer Traum von der Wiedererlangung des Paradieses auf Erden ist in der frühen Neuzeit oft geträumt worden. Immanuel Kants Appell „Sapere aude! – Habe Mut, deinen Verstand zu gebrauchen!“ faßt auf dem Höhepunkt der Französischen Revolution dreihundert Jahre der Hoffnung auf die positiven, kreativen Seiten der Menschennatur zusammen, mit ebendiesem Ziel: eine Lebensform zu finden, die die traditionelle biblische Vorstellung vom Paradies in die Wirklichkeit überführt, als eine Neuschöpfung menschlichen Forschergeistes jenseits aller engen Traditionen und Konventionen: eine Lebensform des Friedens, des Einklangs mit der Natur, des Glückes und Wohlstandes aller Menschen auf der Basis von Freiheit und Gleichheit.228
Eine der Gattungen für derartige Versuche war die literarische Utopie.229 Der englische Humanist und Politiker Thomas Morus gab ihr 1516 das neuzeitliche Gesicht. Nach der von ihm erdachten Insel Utopia ist die Gattung benannt, an der von ihm erdachten staatlichen Organisationsform der Utopier orientieren sich die Autoren der Folgezeit, auch wenn sie andere Wege gehen, wie Caspar Stiblin in seiner Macaria (Basel 1555), Johann Valentin Andreae in seiner Christianopolis (Straßburg 1619), Denis Vairassse d’Alais Sévarambes (1677, dt. 1689) oder Johann Gottfried Schnabel in der Insel Felsenburg (Nordhausen 1731). Die frühneuzeitlichen Utopien sind eine Reaktion auf die Entdeckung der Neuen Welt sowie der Inselwelt des Pazifischen und Indischen Ozeans, schließlich Australiens (1605), und sie begleiten kontrapunktisch die reale Staats- und Gesellschaftsordnung der Alten Welt, sie orientieren sich aber auch an sozialen Experimenten wie in Paraguay, wo während des 16. Jahrhunderts unter Leitung der Jesuiten ein – gemessen an europäischen und kolonialen Lebens- und Herrschaftsverhältnissen – neuartiges Gemeinwesen entstand.230
Vom Standpunkt der mittelalterlichen Theologie aus, die in der Frühen Neuzeit keineswegs am Ende war, vielmehr im Zeichen des Kirchenvaters Augustinus im 16. und 17. Jahrhundert eine neue Blüte erlebte, mußte all dies als verwerfliche curiositas verstanden werden, als aberwitziger Wunsch zu sein wie Gott.231 Für Sebastian Brant (Narrenschiff, 1494) waren die Entdeckungsreisen nach Übersee Narrheit, Überheblichkeit.232 Ebenso streng urteilt die Historia von Doctor Johann Fausten (1587) über Fausts Versuche, auf seinen Forschungsreisen das Paradies wiederzufinden; dies sei die sündhafte curiositas eines dem Teufel Verfallenen.233 Es kommt uns heute seltsam vor, daß noch im Zeitalter eines Galilei, Descartes und Leibniz das biblische Geschichtsverständnis, das starre Ordodenken mit seinen Konsequenzen für die Gliederung der Gesellschaft und das starre vorkopernikanische Weltbild mit der Erde im Mittelpunkt des Alls die Vorstellungswelt der meisten Literati und Illiterati bestimmte, daß tatsächlich erst die Zeitenwende der Französischen Revolution und des napoleonischen Kaisertums die endgültige Verabschiedung dieser Traditionen brachte. Die frühneuzeitlichen Utopien entstehen in dieser Situation des geistigen Konflikts zwischen überlieferten Normen und neuen Erfahrungen. Die Utopisten lassen der curiositas freien Lauf, sie ersinnen neuartige Gemeinwesen, die gegenüber der Außenwelt abgeschottet, wirtschaftlich autark, nach dem Prinzip der gleichen Rechte und Pflichten meist städtisch-bürgerlich organisiert sind. Sie verwenden dazu, auch aus Sicherheitsgründen, zunächst nur die lateinische Sprache der Gelehrten.
In dieser, für die frühe Neuzeit typischen Konfliktsituation hat Grimmelshausen seinen Simplicissimus-Roman verfaßt. Dessen Held erleidet wie in den Utopien seit Morus auf seiner Seereise Schiffbruch und wird auf eine bis dahin unbekannte Insel verschlagen. Der Autor hat seinen Helden Simplicius als einen hochbegabten Menschen mit außergewöhnlich starker Einbildungskraft, scharfem Verstand und ebenso außergewöhnlicher Wißbegierde ausgestattet, die ihn zu immer neuen Erfahrungen drängt. Er hat ihm aber auch gewisse christlich religiös fundierte Maßstäbe mitgegeben: eine ebenso ausgeprägte Eigenschaft, Erfahrenes, meist leidvoll Erfahrenes kritisch zu reflektieren, zu „betrachten“, den Wahrheitsgehalt, den religiös-allegorischen Sinn des Erfahrenen herauszufinden, was diesem Helden um so leichter gelingt, als er außerhalb der ständischen Gesellschaft steht.
Die Dialektik von Erfahren und Betrachten treibt die Entwicklung des Helden und den Erzählprozeß voran.234 Sie bewirkt seit den ersten Erfahrungen des Mißverhältnisses zwischen christlicher Lehre und mörderischer Realität eine zunehmend skeptische Haltung: eine Ahnung zunächst von der Unverbesserlichkeit der Menschenwelt. Diese wird als eine Gesellschaft im Kriege erfahren und im sog. Traum vom Ständebaum (ST I) illusionslos und kritisch reflektiert. Die skeptische Einstellung kommt auch in der vor dem Hanauer Gubernator aus dem Gedächtnis reproduzierten Regentenkritik (Von dem müheseeligen und gefährlichen Stand eines Regenten) zum Ausdruck.235 Diese Kritik an den gegenwärtigen schlimmen Herrschaftsverhältnissen wäre eigentlich schon eine gute Voraussetzung für einen utopischen Gegenentwurf, zumal wenn man Einbildungskraft und Wißbegierde des jungen Simplicius in Rechnung stellt. Doch es kommt anders.
Grimmelshausen bringt, wie oben gezeigt, im Fortgang des Romans das humanistische utopische Denken von der Verbesserbarkeit der Gesellschaftsordnung ein und desillusioniert es Schritt für Schritt. Von besonderem Gewicht ist dabei die Inselutopie in der Continuatio (Kap. 19–23) mit der angehängten Relation des Jean Cornelissen, also die letzten vier Kapitel der Continuatio. Zu fragen ist abschließend nach der Bedeutung der Inselutopie im Kontext der Simplicianischen Schriften.
Grimmelshausen kennt die Friedensschriften des Erasmus, sie sind die Folie, vor der er die chaotische Welt des Teutschen Krieges inszeniert.236 Die Suche nach der eigenen Identität ist für Simplicius mit zunehmender Bewußtheit zugleich die Suche nach Möglichkeiten eines friedlichen Zusammenlebens: Jupiterepisode (III, 3–6), Mummelsee-Episode (V, 12–16), die Reflexionen über die Lebensform der Ungarischen Wiedertäufer (V, 19), der Traum vom höllischen Reichstag (Cont. 2–8) führen Simplicius zunächst nur zu der resignierenden Einsicht, daß auf ein friedliches Zusammenleben der Christen in Europa wie der Menschheit insgesamt nicht zu hoffen ist und ein christliches Leben unter glücklichen Umständen „gantz wunderbarlicher weiß“ nur dem Einzelnen, dem Einsiedler, möglich ist, fernab von der unverbesserlichen Kriegsgesellschaft. Doch ist die Warnung am Beginn der Continuatio zu bedenken: „Wann einer wähnt er steh/so muß er fürter gehen“.237 Das bedeutet zunächst: Simplicius gibt die Einsiedelei, die er als Selbstbetrug durchschaut, zugunsten einer Pilgerreise auf.