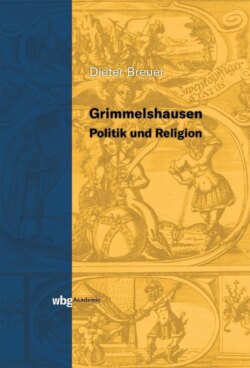Читать книгу Grimmelshausen - Dieter Breuer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorbemerkung
ОглавлениеWas über die Jahre seit 1976 an Versuchen über das literarische Werk Grimmelshausens entstand, habe ich zu einem Buch zusammengefügt. Es sind Versuche über die beiden großen Diskurse der Frühen Neuzeit, Politik und Religion, in die sich dieser Autor satirisch-kritisch und stets auf unterhaltsame Weise eingemischt hat und zu Antworten gelangt ist, die uns in ihrer Menschenfreundlichkeit über die Jahrhunderte hinweg immer noch berühren und ermutigen können.
Dementsprechend habe ich die einzelnen, unabhängig voneinander entstandenen Arbeiten in zwei jeweils zusammenhängende Abfolgen gebracht. Beide betreffen den inhaltlichen „Kern“ seiner Romane und Traktate, weniger die poetisch-satirische „Schale“, um zwei zentrale Begriffe seiner Erzählpoetik zu nennen. Wiederholt hat Grimmelshausen seine Leser und Kritiker gemahnt, über dem kurzweiligen Feuerwerk seiner Sprache, Schreibart und „Stücklein“ nicht zu überlesen, was er „aigentlich“ sagen wolle. Zwar wird man im konkreten Fall nicht immer unterscheiden können, was noch „Kern“ und was schon „Schale“ ist. Aber das rechtfertigt nicht die heute beliebte Methode, seine Erzählwerke als ein groß angelegtes Sprachspiel zur Dekonstruktion jedes ernsthaften „Kerns“ anzugehen. Grimmelshausen ist kein Clemens Brentano, kein Romantiker avant la lettre, auch wenn diese ihn wiederentdeckten.
Was aber ist nun „Kern“ seines Werkes? In seiner ersten Schrift, dem Satyrischen Pilgram, bestimmt der Dichter als sein Ziel, „von der Beschaffenheit allerhand; Ja der meisten Dingen in der gantzen Welt […] Gut und Böß zuschreiben wie ich Sie in Büchern befunden und selbsten gesehen und erfahren habe“. Dies mit dem Zusatz: „Gleichwie Außerhalb GOttes […] in der gantzen Welt nichts vollkommenes erfunden wird/daß nicht seine Mängel habe; Also ist auch hingegen kein Creatur noch Ding […] so schlimm noch nichts würdig/das nicht etwas Sonderbahres an sich hette/so zuloben were.“ Diese „Dinge“ bzw. „Materien“ hat er kritisch nach Für und Wider geprüft, beurteilt und in Lebensgeschichten, Traktaten, Kalendern oder Flugschriften dargeboten. Zu ihnen gehören zentral Materien aus Politik und Religion, zwar nicht in systematischer Breite, sondern in den für die damalige Gesellschaft neuralgischen Punkten, für die z.T. bis heute noch keine besseren Lösungen gefunden worden sind: Vertrauen in den positiven Verlauf der Weltgeschichte, Reform der staatlichen Ordnung zu mehr Gerechtigkeit, Ächtung des Krieges, Friedenspolitik, Aufklärung über Vorurteile gegen Minderheiten, besonders gegenüber den Juden, soziales Engagement statt Resignation und Rückzug aus dem Weltleben, Widerstand gegen unverantwortliche politische Entscheidungen; überkonfessionelle christliche Frömmigkeit, Bekehrung als didaktisch nicht planbare innere Glaubenserfahrung, Tolerierung andersartiger Lebensentwürfe, Überwindung religiöser Intoleranz, Verhältnis von Schicksal bzw. göttlicher Vorsehung und Willensfreiheit.
Die 18 Kapitel über das politische und religiöse „Kerngeschäft“ des Dichters können jeweils einzeln für sich, aber auch im Zusammenhang gelesen werden. Vor Grimmelshausens breit gefächerten Kenntnissen des damaligen Weltwissens muss sich der heutige Leser nicht fürchten. Alle Quellenforschung hat immer wieder die Selbständigkeit und Offenheit seines Denkens und Urteilens und die sprachlich faszinierende Darstellungskunst bestätigt: ein „edel Ingenium“, dessen vom Krieg unterbrochener Werdegang zwar keinen gelehrten Hochschulabschluss vorweisen kann, dafür aber die größere Nähe zur vielfältigen Lebenswirklichkeit der Menschen seiner Zeit für sich hat. Im großen Roman Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch hat Grimmelshausen einen solchen Werdegang zum Dichter dargestellt, und nur hier, in der Dichtung, war es ihm möglich, sein Ideal, „eine freye Person/die niemand unterworffen“, aufscheinen zu lassen.