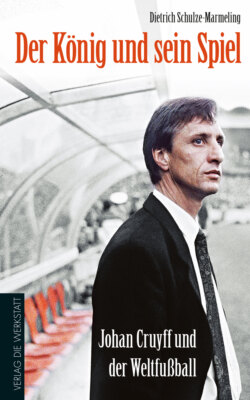Читать книгу Der König und sein Spiel - Dietrich Schulze-Marmeling - Страница 27
Mokum
ОглавлениеAls am 15. Mai 1940 die Deutschen in die Niederlande einfielen, war der Osten Amsterdams noch stark jüdisch geprägt – wie Amsterdam überhaupt, das auch als „Jerusalem Westeuropas“ firmierte. Die Metropole galt als „judenfreundlichste“ Stadt und die Niederlande für Juden als der sicherste Staat im Westen Europas. Vor dem Holocaust lebten ca. 140.000 Juden in den Niederlanden, davon ca. 80.000 in Amsterdam, wo sie 13 Prozent der Bevölkerung stellten.
Die Seele des jüdischen Amsterdamer Lebens bildete das alte Judenviertel mit der Jodenbreestraat (im Haus Nr. 4 lebte Rembrandt) und ihrem berühmten Markt, dem Deventer Houtmarkt (heute Jonas Danel Meijerplein), und dem Waterlooplein. Hier lebte das vorwiegend in den Diamantschleifereien beschäftigte jüdische Proletariat, und hier standen die großen Synagogen wie die heute noch existierende portugiesische (sephardische) am Mr. Visserplein. Die wohlhabenderen Juden residierten im Plantage Viertel mit der Plantage Middenlaan als Hauptader. 1925 war jeder zweite Einwohner des gediegenen und ordentlichen Viertels Jude.
Auch im rund drei Kilometer entfernten Betondorp lebten viele Juden, um die 400 dürften es gewesen sein, von denen viele als Straßenhändler ihr Geld verdienten. In der Tuinbouwstraat 26b stand eine Synagoge, 1928 errichtet vom jüdischen Architekten Abraham Oznowicz, der selbst in der Ploegstraat lebte. Jede Straße des Viertels weist Häuser auf, in denen vor ihrer Deportation und Vernichtung Juden lebten. Von den 80.000 Amsterdamer Juden überlebten keine 15.000 den Holocaust. Aus Betondorp wurden 227 Juden in Auschwitz und Sobibor ermordet. 18 von ihnen kamen aus der Akkerstraat, wo Cruyffs Elternhaus stand. Die meisten Opfer zählten mit 39 bzw. 62 die benachbarten Ploegstraat und Veeteeltstraat. Bei John Cruyffs Geburt war es gerade einmal dreieinhalb Jahre her, dass die deutschen Besatzer ihre letzten großen Razzien in Amsterdam durchgeführt hatten, um die Juden zu inhaftieren und später in die Vernichtungslager zu deportieren.
Als ein Verein, der im Amsterdamer Osten beheimatet war, blieb Ajax von der jüdischen Community nicht unberührt. Seit dem Umzug nach Watergraafsmeer besaß Ajax immer auch eine jüdische Fanbasis. Primär war diese geografisch bedingt. Aus dem Middenweg, wo das Ajax-Stadion De Meer lag, wird stadteinwärts zunächst die Linnaeustraat, die in die Plantage Middenlaan übergeht, die Wohngegend der bürgerlichen Juden. An diese schließt sich das alte jüdische Viertel der Kleinhändler und Arbeiter an. Auf dem Weg vom Stadtzentrum zum De Meer passierte man also die hauptsächlichen Wohngegenden der Amsterdamer Juden. Für deren Bewohner war das Ajax-Stadion leicht erreichbar. Sofern sie sich für Fußball begeisterten, waren die im alten Judenviertel und im Plantage-Viertel lebenden Juden Anhänger von Ajax. Der Rabbiner Rebbe Meyer de Hond, eine schillernde Gestalt in der jüdischen Gemeinde und Propagandist einer traditionellen jüdischen Lebensart, beschwerte sich 1926 darüber, dass die Juden zu häufig Ajax und zu selten die Synagoge besuchen würden. (Rebbe Meyer de Hond wurde 1943 in Sobibor ermordet. An den charismatischen Rabbiner erinnert heute die Dr.-Meyer-de-Hond-Brücke über der Nieuwe Achtersgracht.)
Ajax war kein jüdischer Klub, aber es existierte eine Nähe zum jüdischen Amsterdam. So wurden Meisterschaften im 1921 errichteten Großkino Abraham Tuschinski in der Reguliersbreestraat gefeiert. (Abraham Icek Tuschinski, ein niederländischer Kinobetreiber jüdisch-polnischer Herkunft, wurde 1942 in Auschwitz ermordet. Das Tuschinski, das 2001 sorgfältig renoviert wurde, ist noch heute das bedeutendste und bekannteste Kino der Niederlande.)
Unter den Mitgliedern des Klubs bildeten die Juden nur eine kleine Minderheit; die ärmeren Juden konnten sich eine Mitgliedschaft gar nicht leisten. Und jüdische Spieler gab es in der Geschichte von Ajax nur ganz wenige. Der bekannteste von ihnen war der Flügelstürmer Eddy Hamel, ein in New York geborener amerikanischer Staatsbürger, der von 1922 bis 1930 in 125 Ligaspielen für Ajax auflief. Hamel lebte nicht im Judenviertel, sondern an der Amstelkade im Süden Amsterdams. Am 30. April 1943 wurde er in Auschwitz ermordet.
Heute leben nur noch ca. 15.000 Juden in Amsterdam, aber die Bezeichnung der Stadt als „Mokum“ ist unverändert populär. „Mokum“ (hebräisch: makum) stammt aus dem Jiddischen und bedeutetet „Platz“ und „sicherer Hafen“. „Ik woon in Mokum“, bekennen auch nicht-jüdische Amsterdamer mit Stolz.