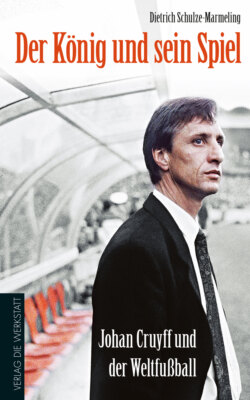Читать книгу Der König und sein Spiel - Dietrich Schulze-Marmeling - Страница 28
Die „Breslauers“
ОглавлениеDas Image eines „Judenklubs“ entwickelt Ajax erst zwei Jahrzehnte nach dem Holocaust und dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Genauer: in den Jahren, als Ajax mit Johan Cruyff zu einem der besten und denkwürdigsten Teams der Weltfußballgeschichte avancierte.
Das Thema wird auch im Klubmuseum „Ajax Experience“ am Amsterdamer Rembrandtplein angesprochen. Unter der Überschrift „Wie Zijn We? Ajax, Jodenclub?“ heißt es, Ajax würde „fälschlich“ als solcher bezeichnet. Zu keinem Zeitpunkt habe Ajax mehr jüdische Spieler in seinen Reihen gehabt als andere Amsterdamer Klubs. Was niemand je behauptet hat und was deshalb das Thema ein wenig verfehlt.
1964 wurde der Amsterdamer Jude Jaap van Praag Präsident von Ajax. Auch sein Vater Mozes war ein Ajaciede gewesen. Mozes van Praag hatte zunächst in der Diamantenindustrie gearbeitet, einem traditionell von Juden dominierten Gewerbe. Später eröffnete er ein Klaviergeschäft. Die van Praags lebten im „jüdischen“ Osten Amsterdams, in der Pretoriusstraat. Seit 1912 war Mozes van Praag ein Gönner des Klubs. Und natürlich pilgerte er mit seinem Sohn Jaap zu jedem Spiel von Ajax im nur 1,5 Kilometer von seinem Wohnhaus entfernten De Meer.
Der spätere Ajax-Präsident begann seine berufliche Karriere im Musikgeschäft seines Vaters. Früh erkannte er die Zukunft von Vinylscheiben und eröffnete am Spui, einem heute von vielen Buchläden umgebenen Platz im Zentrum von Amsterdam, den ersten Schallplattenladen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Jaap van Praag Besitzer einer Reihe von Elektro- und Schallplattenläden und ein wohlhabender Mann. Krieg und Besatzung hatte er unter dem Decknamen Jaap van Rijn in einem Haus in Overtoom, das er kaum verlassen konnte, überlebt. Seine Eltern und seine kleinere Schwester wurden von den Nazis ermordet. Im November 1945 bedankte sich Jaap van Praag in einer Veröffentlichung des Ajax-Vorstands bei „allen Ajax-Freunden, die mir, nach meiner langen Zeit des Verstecktseins, mit so viel Freundlichkeit begegnet sind“.
Van Praag war der Kopf eines Netzwerks von Holocaust-Überlebenden, die am Aufstieg von Ajax zu einer europäischen Topadresse entscheidend mitwirkten. Simon Kuper: „Das große Ajax-Team der 1970er wurde in gewisser Weise in Teilen vom Holocaust geformt.“ Eine Reihe von Gönnern in den goldenen Jahren waren Juden, so der Immobilien-Tycoon Maup Caransa (zuweilen bezeichnete die Presse Ajax als „Caransajax“), dessen Hauptrivale auf dem Immobilienmarkt, Jaap Kronenberg, außerdem der Textilhändler Leo Horn, ein ehemaliger Weltklasseschiedsrichter, in dessen 31 Geschäften zeitweise auch die Ajax-Spieler Piet Keizer und Ruud Krol arbeiteten. Auch Rob Cohen zählte dazu, Besitzer einer Kette von Fleischerläden und des berühmten jüdischen (aber nicht koscheren) Sandwich-Shops „De Kuil“, in den er das Ajax-Team nach Titelgewinnen zum Dinner einlud. Rob Cohens gleichnamiger Sohn ist Schwiegervater und Manager des Nationalspielers und heutigen Ajax-Trainers Ronald de Boer.
Simon Kuper bemüht zur Charakterisierung der jüdischen Geschäftsleute, die zum Aufstieg von Ajax beitrugen, eine Figur aus Leon de Winters 1996 erschienenem Roman „SuperTex“. Der jüdische Textil-Tycoon Simon Breslauer ist der einzige Holocaust-Überlebende seiner Familie. Nach dem Krieg stürzt er sich in den Aufbau eines florierenden Textilunternehmens mit dem Namen SuperTex, das billige Massenware produziert. Leute wie Breslauer wollen nicht darüber nachdenken, geschweige denn darüber sprechen, was ihnen und ihrer Familie zugestoßen ist. Gleichzeitig ist es ihnen unmöglich, das Geschehene zu bewältigen. Sie gründen Unternehmen, um nie wieder in die Abhängigkeit eines Mitmenschen zu geraten und Demütigungen zu erfahren. Sie häufen ein Vermögen an, damit ihre Kinder für den „worst case“, die Rückkehr der Nazis, gewappnet sind. Am Ende landet die Romanfigur Simon Breslauer mit seinem Mercedes 560 SEL nahe der Stadt Loodsrecht in einem Graben und ertrinkt. Im richtigen Leben war es Jaap van Praag, der 1987 seinen Wagen in der Nähe von Badhoevedorp in einen Graben fuhr und an den Folgen des Unfalls starb.
Auf dem Feld wurde die jüdische Community in der bis 1974 währenden Ära van Praag nur durch zwei Spieler repräsentiert: Sjaak Swart, von dem später noch die Rede sein wird, und Bennie Muller. Für viele Ajax-Fans waren Swart und Muller aber vor allem typische „Amsterdamer Jungs“, mehr als alle anderen Spieler.
Der emsige Mittelfeldspieler Muller (Jg. 1938) bestritt von 1957 bis 1970 für Ajax 341 Erstligaspiele (30 Tore). Beim ersten Europapokalfinale der Amsterdamer 1969 war der 43-fache Nationalspieler noch dabei, nicht aber beim folgenden Triumphzug der Jahre 1971 bis 1973. Den Aufstieg der niederländischen Nationalelf verpasste Muller total. In seinen 43 Länderspielen verließ Muller nur zwölfmal als Sieger den Platz. Nach dem Ende seiner Karriere eröffnete er im Jordaan-Viertel einen Tabakladen.
Mullers Sohn Danny ging 1988 knapp 19-jährig mit dem Trainer Johan Cruyff zum FC Barcelona, wo er ein Jahr im B-Team verbrachte. Anschließend spielte er u. a. für die Eredivisie-Klubs AZ Alkmaar und RKC Waalwijk. Danny Muller galt als sehr großes Talent, wurde aber von chronischen Achillessehnenproblemen geplagt.