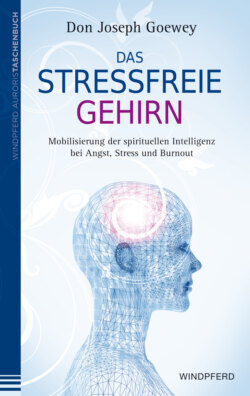Читать книгу Das stressfreie Gehirn - Don Joseph Goewey - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog: Meine Aufgabe
ОглавлениеIn fourteen months I only smiled once and I didn't do it consciously. Somebody’s got to find your trail. I guess it must be up to me. *
Bob Dylan, Up to Me
Vor zwanzig Jahren kam eines zum anderen, der Mut verließ mich und das alles erzeugte einen wahren Sturm von Stress. Paradoxerweise geschah das, als meine Karriere sich gerade einem Höhepunkt zu nähern schien. Erst eineinhalb Jahre zuvor war es mir gelungen, einige der hellsten Köpfe auf dem Gebiet der Medizin davon zu überzeugen, dass ich der beste der Kandidaten sei, die sich für den Posten des Geschäftsführers der Medizinischen Fakultät der Stanford-Universität beworben hatten. Dies war die größte Abteilung der Universität und der Posten ein potenzielles Sprungbrett zu noch größeren Aufgaben. Alle Menschen in meiner Umgebung waren ziemlich beeindruckt, als mir diese Position angeboten wurde.
Ich erinnere mich noch an den ersten Tag, an dem ich zur Arbeit fuhr. Ich fuhr durch das Weideland, auf dem Leland Stanford einst sein Vieh gehalten hatte, bog in den Pasteur Drive ein und fuhr auf die riesige Eiche zu, die vor dem wundervollen sandfarbenen Gebäude der Medizinischen Fakultät steht. Der große Springbrunnen am Eingang spuckte Wasserfontänen in die Luft, die der Wind zu einem Sprühregen auffächerte, durch den die Wand des Gebäudes hindurchleuchtete. Zwischen den hohen Säulen, welche die schlichte, fast karge Fassade des Gebäudes schmückten, hingen große Kupferkessel, aus denen rote und gelbe Rankengewächse quollen. An jenem Tag hatte ich das Gefühl, Camelot zu betreten.
Es dauert nicht lange, bis diese Illusion sich in Luft auflöste. Der Ort war alles andere als Camelot. Das soll nicht heißen, dass die Arbeit an der Medizinischen Fakultät nicht inspirierend war. Mit Intellektuellen von Weltklasse zusammenzuarbeiten, erweiterte meinen Horizont und förderte meine Fähigkeiten. Ich lernte, effektiv mit komplexen Sachverhalten umzugehen, die Fakten mit brutaler Ehrlichkeit zu sehen und fadenscheinige Argumente, die zu bequemen Lösungen führen sollten, zu entlarven. Es konfrontierte mich auch mit der Naturwissenschaft, einer Disziplin, die ich auf der Schule gemieden hatte wie die Pest. In Stanford begann ich die Naturwissenschaft zu lieben, und dafür bin ich für ewig dankbar. Gleichzeitig bekam ich aber auch den Eindruck, dass diese Weltklasse-Intellektuellen auch Weltklasse-Egos besaßen, und es bereitete mir große Schwierigkeiten, sie dazu zu bringen, mit unserem strategischen Plan zu kooperieren. Es herrschte eine übertriebene Kritiksucht und Fehler wurden gnadenlos bestraft, was auf dem Gebiet der Medizin natürlich verständlich ist. Aber die Kollegen schienen sich geradezu über die Fehler der anderen zu freuen. Die Schlappe des einen war ein Gewinn des anderen, und das führte zu einer Atmosphäre des Misstrauens. So sah ich die Situation zumindest zu jener Zeit.
In dieser Umgebung hatten es die Frauen besonders schwer, selbst diejenigen, die über hohe medizinische Qualifikationen verfügten. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich – es war noch zu Anfang meiner Tätigkeit dort – von einer Besprechung in mein Büro zurückkehrte und eine Assistenzärztin weinend vor der Eingangstür zur Medizinischen Fakultät stehen sah. Als ich sie fragte, was denn los sei, sagte sie nur „Ich passe einfach nicht hierher“ und rannte davon. Ich kam allmählich zu derselben Schlussfolgerung. Ich hatte das Gefühl, am falschen Ort zu sein, und fürchtete, dass man mir das anmerkte. Ich besaß jedoch nicht den Mut, den Job zu kündigen, nicht mit einer Frau und vier Kindern, die zu versorgen waren. Ich hatte auch Angst vor dem, was meine Freunde und meine Familie vielleicht von mir denken würden. Sie hatten mich dafür gefeiert, dass ich die Stelle erhalten hatte, und ich fürchtete, sie würden schlecht von mir denken, wenn ich nicht damit zurechtkam.
So belastend die Arbeit damals auch erschien, meine damit und mit meinem Leben im Allgemeinen verbundenen Ängste waren noch viel schlimmer. Sie mögen sich fragen, warum Sie ein Buch über die Bewältigung von Stress von einem Autor lesen sollten, der selber so schlecht mit seinem Stress zurechtgekommen ist. Meine Antwort darauf ist: Welcher Autor wäre besser geeignet als einer, der das Minenfeld selber durchquert hat? Und das Minenfeld meiner Ängste und des Stresses, der damit einherging, erstreckte sich weit über meinen Arbeitsplatz hinaus. Zu jener Zeit hatte ich fast ständig Angst, ohne mir dessen jedoch bewusst zu sein. Ich fürchtete, was die Leute von mir denken könnten, und ich fürchtete Flauten in unseren Gesprächen. Ich fürchtete mich vor den Rechnungen auf meinem Schreibtisch, den Schecks, die ich ausstellte, und den Schulden, die ich machte. Ich fürchtete zu versagen in einer Situation, in der ich allem Anschein nach Erfolg hatte. Ich fürchtete mich angesichts der kleinen Stiche in meiner Brust, der geschwollenen Lymphknoten, die gelegentlich im Hals meiner Kinder auftauchten, wenn sie sich erkältet hatten, und angesichts des merkwürdigen Klopfens im Motor meines Wagens. Ich hatte Angst vor Zuneigung, intimen Momenten und dem unglücklichen Ausdruck in den Augen meiner Frau. Ich ging an die meisten Situationen mit einem Gefühl des Risikos heran, so als könne mich jemand durchschauen, mich anklagen und mich aus dem Weg räumen. Ein Freund von mir machte einen Witz und sagte, er habe manchmal, wenn er sich Bares aus einem Geldautomaten hole, die Befürchtung, aus dem Automaten könnte plötzlich ein Polizist heraustreten und ihn für das Verbrechen, einen ehrbaren Bürger zu imitieren, verhaften – und er sprach damit genau meine Ängste an. Ich lebte unter einer mir selbst auferlegten Tyrannei und war vor dieser auf der Flucht. Ich befand mich eigentlich ständig auf der Flucht, fühlte mich selten wirklich wohl, wirklich frei. Ich erfuhr das, was Rollo May ein „namenloses und formloses Unbehagen“ genannt hat.1
Das Unbehagen verschlimmerte sich noch, als die Universität mir eine Bewährungsfrist setzte und mir noch drei Monate gab, meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Als der Stichtag näher kam, wurde aus meiner Angst blankes Entsetzen und mein Selbstvertrauen ging in den Keller, was wiederum mein Vermögen, noch die Kurve zu kriegen, beeinträchtigte.
Sören Kierkegaard, der große Philosoph, schrieb:
Kein Großinquisitor hat so entsetzliche Foltern in Bereitschaft wie die Angst; kein Spion weiß so geschickt den Verdächtigen gerade in dem Augenblick anzugehen, in dem er am schwächsten ist, oder weiß die Schlinge, in der er gefangen werden soll, so bestrickend zu legen, wie die Angst es weiß; und kein scharfsinniger Richter versteht den Angeklagten so zu examinieren wie die Angst, die ihn niemals loslässt, nicht bei der Zerstreuung, nicht im Lärm, nicht bei der Arbeit, nicht am Tage, nicht in der Nacht. 2
An dem angekündigten Tag fiel dann das Fallbeil: Ich wurde entlassen. Neun Tage später wurde bei mir ein Gehirntumor diagnostiziert. Als sei das noch nicht genug, vertiefte das Ringen mit all diesen Schwierigkeiten auch noch die Risse in meiner Ehe, statt meine Frau und mich einander näherzubringen. Sosehr wir uns auch bemühten, wir vermochten den Abgrund, der sich zwischen uns aufgetan hatte, nicht mehr zu überbrücken. Ich glaube, ich habe mich nie in meinem Leben einsamer und verlorener gefühlt als damals. Meine Gemütsverfassung schwankte zwischen blankem Entsetzen und totaler Taubheit. Und ich begann, den Glauben an das Leben zu verlieren.
Die gute Nachricht war, dass der Tumor gutartig war und nur langsam wuchs. Die schlechte Nachricht war seine Größe und seine Lokalisierung. Das Krebsgeschwür war ziemlich groß und übte Druck auf den fünften, siebten und achten Kranialnerv aus, was zu einer ungünstigen Prognose führte. Es hieß, ich könnte durch die nötige Operation die Hälfte meines Gehörs verlieren, mein Gleichgewichtsgefühl könnte leiden und meine linke Gesichtshälfte gelähmt werden. Ich war damals achtunddreißig Jahre alt und die medizinische Prognose war ein schwerer Schlag für mich. Wie sollte ich eine neue Karriere starten können, wenn ich am Stock zum Einstellungsgespräch gehumpelt kam und meine Qualifikation mit einem zur Hälfte erstarrten Gesicht anpries? Es erschien mir offensichtlich, dass das Leben, das ich bisher geführt hatte, zu Ende war und dass meine Familie in Zukunft in Armut würde leben müssen.
Durch die Beziehungen, die sich an der Medizinischen Fakultät ergeben hatten, konnte ich den besten Gehirnchirurgen finden, auch wenn dieser nicht gleich verfügbar war. Aus medizinischer Sicht war das nicht schlimm, da der Tumor nur langsam wuchs. Der Aufschub war in der Tat eine Erleichterung, so ziemlich die einzige Erleichterung, die ich seit Monaten verspürt hatte. Ich hatte es nicht eilig, mich mit einer Gesichtslähmung oder einem torkelnden Gang anzufreunden. So seltsam es sich auch anhören mag, aber es war wirklich ein Segen für mich, auf die Operation warten zu müssen. Das ließ mir die Zeit, in meinem Leiden bis zum tiefsten Punkt meiner Verzweiflung vorzustoßen; ich erreichte ihn eine Woche vor meiner Operation. Es war ein kalter, grauer Tag. Ich war allein zu Hause und ging hinaus auf die Terrasse, um eine Zigarette zu rauchen und meinen Blick über die Hügel schweifen zu lassen, in der Hoffnung, meine Angst dadurch ein wenig lindern zu können. Doch meine Angst wuchs nur noch mehr als Reaktion auf die Schreckensbilder meiner Zukunft, die ich mir von Furcht getrieben ausmalte. Die Furcht unterspülte den brüchigen Grat der Sicherheit, auf dem ich balancierte, um noch irgendwie bei Verstand zu bleiben, und ich fiel in ein Loch, in das ich tiefer und tiefer versank, hinab in eine finstere Höhle in meinem Geist. Je tiefer ich fiel, desto dunkler wurde es. Je dunkler es wurde, desto mehr Angst bekam ich, bis ich mich schließlich in einem Zustand nackter Panik befand. Es war ein Albtraum. Ich hatte keine Ahnung, wie ich den psychischen Absturz hätte abfangen können, und so blieb mir nichts anderes übrig, als mich der Erfahrung völlig zu überlassen. Als ich das tat, vertiefte sich mein Entsetzen noch. Die Situation wurde unerträglich, und an irgendeinem Punkt begann mein Bewusstsein sich nach innen zurückzuziehen, bis zu einem Punkt, an dem ich völlig zu verschwinden schien.
Dann erwachte mein Bewusstsein wieder zum Leben, wie ein Phönix, der sich aus der Asche erhebt. Mein Geist fühlte sich ausgeleert an, wie geläutert und seltsam geräumig, wie der blaue Himmel nach einem Unwetter. Alles war still und von einer ungewöhnlichen Weite. Die Stille wurde immer greifbarer und bekam etwas Lebendiges – wie das erste Frühlingserwachen. Die Stille umgab und durchdrang mich, und zum ersten Mal seit sehr langer Zeit fühlte ich mich in Frieden. Ich entspannte mich völlig in diese Empfindung hinein, so wie wir uns in das Nachlassen von Schmerzen hinein entspannen. Während ich das tat, begann ich mich geliebt zu fühlen, ich weiß nicht, von wem. Vielleicht war es bloß so, dass ich mich selbst zum ersten Mal liebte; vielleicht war es auch die schlichte Erleichterung und Dankbarkeit, endlich Sicherheit erreicht zu haben.
Darüber dachte ich in dem Moment jedoch nicht nach. Ich war völlig überwältigt von dem Gefühl, geliebt zu sein; es griff allmählich als Mitgefühl in meinem Herzen um sich. Ich empfand Mitgefühl für alle Leidenden, einschließlich meiner selbst. Die Aufrichtigkeit meines Mitgefühls schien einen sehr alten Kummer zu heilen, und zum ersten Mal seit Gott weiß wie langer Zeit begann ich zu weinen. Die kummervollen Tränen setzten zugleich ein Gefühl der Freude und des Erstaunens frei über das Abenteuer und das Privileg, lebendig zu sein. Als ich den nächsten Atemzug nahm, kam er mir wie der Atem des Lebens vor. Als ich die Augen öffnete und mich umsah, war mein erster bewusster Gedanke, dass mit mir alles in Ordnung war. Darauf folgte die Einsicht, dass schon immer alles mit mir in Ordnung gewesen war und auch immer alles in Ordnung sein würde. Mein gewohnter Zynismus erhob sich nicht, um gegen das Gefühl Einspruch zu erheben. Alles wird gut sein, und was auch immer geschieht, wird gut sein – mir war vollkommen evident, dass diese Aussage zutraf.*
Ich schaute auf meine Hand, und die Zigarette, die ich zwischen den Fingern hielt, war erst zur Hälfte verglüht. Das war schwer zu begreifen, denn die Erfahrung, die ich soeben gemacht hatte, fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Als ich wieder einigermaßen bei mir war, machte ich einen Realitätscheck: Habe ich einen Gehirntumor? Die Antwort war: ja. Ist die Prognose immer noch dieselbe? Die Antwort war: ja. Bin ich dabei, mich unter die Arbeitslosen einzureihen? Die Antwort war: ja. Liegt meine Ehe auf Eis? Ja, ja, und wieder ja. Und trotzdem hatte ich noch das Gefühl, alles werde in Ordnung sein. Trotz der schwierigen Umstände, mit denen ich mich konfrontiert sah, fühlte ich mich innerlich in Frieden.
Die Erfahrung hielt an, und die folgende Woche war pure Glückseligkeit. Ich dachte nicht viel, redete nicht viel, und ich machte mir keine Sorgen. Meine Angst war verschwunden. Der Leiter der Medizinischen Fakultät war so freundlich, das Anstellungsverhältnis bis nach meiner Operation aufrechtzuerhalten und mir danach sechs Wochen bezahlten Erholungsurlaub zuzugestehen. Ich hatte eigentlich nicht vorgehabt, noch mal in mein Büro zurückzukehren, aber jetzt wollte ich einfach dort sein. Meine friedvolle Geisteshaltung warf ein positives und optimistisches Licht auf alles, und ich glaube, ich wollte sie einfach auf die Probe stellen. Der Dekan hatte die Medizinische Fakultät einst einen „gottverlassenen Ort“ genannt, und ich wollte herausfinden, ob meine neue Sichtweise dem Stress und der Belastung, die dieser Ort für mich bedeutete, standhalten würde. Zu meiner großen Freude erwies sich mein Frieden als stabil genug. Die Dinge, die mich zuvor gestresst hatten, machten mir nun nichts mehr aus. Mein Herz öffnete sich für Menschen, die ich für meine Feinde gehalten hatte und die ich noch eine Woche zuvor für meinen Untergang verantwortlich gemacht hatte. Mir wurde jetzt klar, dass ich die meisten meiner Wahrnehmungen tatsächlich in meinem Kopf produziert hatte, und ich wollte meinem Kopf die Chance zu Heilung geben. Ich arbeitete bis wenige Tage vor meiner Operation und wenn ich mich recht erinnere, hatte ich während der ganzen Zeit keinen einzigen negativen Gedanken.
Eines Tages, kurz vor meiner Operation, suchte mich der Geschäftsleiter der Psychiatrischen Abteilung auf. Sein Name war Karl, und er sollte einen neuen Posten im Büro des Dekans erhalten und der Personalabteilung vorstehen. Dies bedeutete, dass seine Stelle vakant wurde. Karl hatte den Eindruck, dass man mir in der Medizinischen Abteilung übel mitgespielt hatte, und er glaubte, ich wäre in der Psychiatrischen Abteilung besser aufgehoben. Ich war offen für seinen Vorschlag und Karl arrangierte ein Vorstellungsgespräch beim Leiter der Psychiatrischen Abteilung für mich. Karl und ich kannten einander kaum, und es gab eigentlich keinen anderen Grund für ihn, sich einzumischen, außer um etwas richtigzustellen, was er als unfair empfunden hatte. Ich ging zu dem Vorstellungsgespräch, und als ich gerade dabei war, meinen Koffer für das Krankenhaus zu packen, rief der Leiter der Psychiatrischen Abteilung mich an und bot mir die Stelle an. Natürlich nahm ich ohne zu zögern an. Alles wird gut sein, und was auch immer geschieht, wird gut sein, dachte ich für mich, als ich den Hörer auflegte. Dann nickte ich voller Dankbarkeit für das gute Herz von Karl. Ich fühlte mich gesegnet, so als kümmere sich eine Legion von Engeln um mich.
Als ich im Krankenhaus eincheckte, war ich voller Zuversicht, wie Michael Jordan vor einem Meisterschaftsspiel. Die Operation war ein voller Erfolg, was den guten Ruf meines Chirurgen noch beträchtlich erhöhte. Die einzige Beeinträchtigung, die ich davontrug, war ein zwanzigprozentiger Verlust meines Hörvermögens, und das einzige Problem, das nicht gelöst wurde, war meine Ehe. Ein Jahr später ließen meine Frau und ich uns scheiden. Es war schmerzlich, aber Mitgefühl ließ uns die Sache schließlich gut durchstehen.
In der Psychiatrischen Abteilung war ich tatsächlich besser aufgehoben. In meiner Jugend hatte ich das große Privileg gehabt, mit dem herausragenden amerikanischen Psychologen Carl R. Rogers zu arbeiten, und so fühlte ich mich hier in meinem Element. Es war aufregend, in der Psychiatrischen Abteilung zu arbeiten, zumal sich gerade zu jener Zeit die Theorie der Geist-Körper-Verbindung entwickelte. Es fiel mir schwer, mich nicht von meinen Verwaltungsaufgaben ablenken zu lassen. Wie hätte es anders sein können? Als Insider der Abteilung konnte ich die Arbeit einiger Giganten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet beobachten. Dazu gehörten William Dement, der Vater der Schlafmedizin, Karl Pribram, der das holografische Gehirnmodell der kognitiven Funktionen entwickelte; David Spiegel, einer der führenden Forscher auf dem Gebiet der Psychosomatik; und Irvin Yalom, der das Standardwerk über Gruppenpsychotherapie geschrieben hat. Als ich einmal einen vollgestopften Wandschrank ausräumte, förderte ich sogar zwei verschollene Tonbandspulen von Jane Goodall zutage, die darauf mit ihren Forschungskollegen über Primatologie diskutiert.
So gern ich auch in dieser Abteilung arbeitete, hatte ich doch das Gefühl, dass diese Stelle nur eine vorübergehende sein würde. Der Gedanke, die Universität hinter mir zu lassen, machte sich in mir zunehmend breit. Sie war für mich nur so etwas wie eine Zwischenstation zwischen dem Ort, an dem ich nicht mehr zuhause war, und dem Ort, den ich erreichen wollte. Der Friede, den ich an jenem Tag jenseits des Schreckens auf der Terrasse erfahren hatte, hatte mich verwandelt. Ich musste immer wieder daran denken, wie gern ich in einer Organisation arbeiten würde, die Menschen hilft, solchen Schmerz, wie ich ihn an jenem Tag erfahren hatte, zu transformieren. Ich wusste nicht, ob es überhaupt solch eine Institution gab, nur, dass es mich dazu trieb, sie zu finden.
Eines Tages nahm ich gerade an einer Besprechung mit dem Vorstandsvorsitzenden und den Abteilungsleitern teil, als etwas Seltsames geschah. Ich hatte gerade einen Sachverhalt, der mir wichtig war, verteidigt, als mein Geist abzuschweifen begann. Vor meinem geistigen Auge sah ich mich zwanzig Jahre später immer noch an demselben Tisch sitzen und gelangweilt über den Streitpunkt des Tages diskutieren. Schlimmer noch: Ich fühlte, wie ich voller Bedauern war darüber, dass ich mein Leben einfach hatte an mir vorbeiziehen lassen. Das Ganze war mehr als nur ein Tagtraum. Ich war vollkommen klar dabei, so sehr, dass ich regelrecht erschüttert war, als ich zu der augenblicklichen Besprechung zurückkehrte. Ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas mir sagte, ich solle jetzt sofort aufstehen, in mein Büro gehen und meine Kündigung schreiben. Irgendwie war mir klar, dass ich nicht darüber schlafen dürfte – wenn ich dann wieder aufwachte, würden zwanzig Jahre vergangen sein. Es hieß: jetzt oder nie! Mit klopfendem Herz stand ich auf, entschuldigte mich, ging zurück in mein Büro und tat dort das Mutigste, das ich je getan habe. In Momenten wie diesem sind Mut und Verrücktheit oft nicht voneinander zu unterscheiden. Es lief alles auf einen vertrauensvollen Sprung in einen Abgrund hinaus – und ich tat diesen Sprung. Ich schrieb meine Kündigung, formulierte zuerst eine fristlose Kündigung und machte dann eine Kündigung nach einer Frist von drei Monaten daraus – das beruhigte mein schreckliches Herzklopfen ein wenig. Drei Monate später ließ ich die Sicherheit einer festen Anstellung hinter mir und ging mit nur wenigen Ersparnissen allein hinaus in eine kalte, unfreundliche Welt. Mein einziger Kompass war meine innere Vision. Ein Jahr lang suchte ich nach der Institution, die mir vorschwebte. Als mir das Geld ausging, nahm ich einen Teilzeitjob in einer Fabrik an und lieh mir etwas von meinem besten Freund. Ich fand einfach nichts, was meinen Vorstellungen entsprach. Es war entmutigend, aber dann, als ich die Suche gerade aufgeben wollte, fand ich das, was ich gesucht hatte. Es war eine gemeinnützige Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, Schwerkranken und Sterbenden zu helfen, mit der enormen psychologischen und spirituellen Herausforderung ihrer Situation umzugehen. Das Institut in Marin County, gleich jenseits der Golden-Gate-Brücke, war international bekannt für seinen Ansatz. Ich hatte bisher noch nicht davon gehört, obwohl es damals bereits seit fünfzehn Jahren bestand.
Das Center for Attitudinal Healing (Zentrum für Heilung durch Geisteshaltung) oder „das Zentrum“, wie es von seinen Klienten und den freiwilligen Helfern genannt wurde, war 1975 von dem anerkannten Psychiater und Bestsellerautor Dr. med. Gerald Jampolsky gegründet worden – gemeinsam mit Patsy Robinson, einer Frau, die in der Lage war, eine Vision zu nehmen und sie in der Welt zu verwirklichen. Die Klienten des Zentrums kamen aus allen Lebensbereichen und Altersgruppen. Das Spektrum reichte von Eltern, die ein Kind verloren hatten, bis zu Menschen, bei denen eine lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert worden war. Viele von ihnen hatten mit einer Stressbelastung umzugehen, die sich die meisten von uns kaum vorstellen können. Eine Zeit lang arbeitete das Zentrum auch mit Kriegsflüchtlingen, die alles verloren hatten. Die zentralen Prinzipien des Zentrums entsprachen der mein Leben verändernden Erfahrung auf der Terrasse: Die Leute dort definierten Gesundheit als inneren Frieden und verstanden Heilung als das Loslassen von Angst. Das Zentrum hatte zudem ein Modell entwickelt, das auf der Unterstützung durch eine Gruppe basierte und den Aufbau einer Gemeinschaft betonte; es ähnelte dem Modell, das ich aus meiner Arbeit mit Dr. Carl Rogers kannte. Das Programm basierte vollständig auf einer Körperschaft von zweihundert Freiwilligen, die den Klienten ihre Dienste kostenlos anboten und von einem Stab von Mitarbeitern des Instituts ausgebildet und begleitet wurden.
In der Organisation herrschte eine Atmosphäre der Bescheidenheit. Sie war in einem alten Lagerhaus in Tiburon untergebracht, gelegen in den Hafenanlagen am nördlichen Ende der Bucht von San Francisco. Die Möbel waren alt, das Gebäude ebenso, und die Wände waren von Kinderzeichnungen geschmückt. Doch das Institut war sauber und ordentlich und es lag dort eine lebendige und freundliche Energie in der Luft. Hier fand man eine dem Dienen verpflichtete Gemeinschaft, in der jedermann bedingungsloser Respekt entgegengebracht wurde. Hier wurde jedermann, jung oder alt, gleichermaßen als Lernender und als Lehrer betrachtet. Der Lehrplan war einfach und direkt: Es ging darum zu lernen, wie man Angst in jeglicher Erscheinungsform loslassen kann. Menschen aus aller Welt suchten das Zentrum auf. Professoren, Ärzte und Therapeuten kamen, um sich weiterzubilden, gewöhnliche Bürger aus allen Lebensbereichen kamen, um zu helfen, Arme ebenso wie Reiche spendeten Geld, und es tauchten sogar einige Suchende auf, die sich auf einer Pilgerschaft der Suche nach dem Sinn des Lebens befanden. Für alle wurde rasch eine Arbeit gefunden. Mehr als einhundert dieser Menschen gründeten nach der Rückkehr in ihre gewohnte Umgebung ein eigenes Zentrum. Dieser kleine Lichtpunkt war die Mutter einer globalen Gemeinschaft, die sich der Überwindung von Angst widmet.
Im Laufe seiner Arbeit entwickelte das Zentrum eines der bedeutendsten Modelle der psychiatrischen Betreuung in einer Gemeinschaft. Das war genau der Bereich, der mich interessierte, und es war aufregend, die Arbeit dieser Menschen zu beobachten. Ihr Modell war ebenso effektiv wie das der Anonymen Alkoholiker. Und die Gründe für diese Effektivität waren ähnliche wie bei den Anonymen Alkoholikern: Hier saßen Menschen in einem Kreis, die von praktischen Prinzipien geleitet wurden, mit Gleichheit als dem ersten Prinzip; und das führte zu einem Gefühl der gegenseitigen Verbundenheit, das wahrhaft heilsam sein kann.
Etwa einen Monat lang verbrachte ich all meine verfügbare Zeit im Zentrum, um zu sehen, ob dies wirklich der Ort war, nach dem ich gesucht hatte. Ich kaufte und las viele der im dortigen Buchladen angebotenen Bücher, ich lernte Patsy Robinson und die gesamte Belegschaft kennen, und ich lernte so viel wie möglich über die angebotenen Programme. Es war in der Tat der Ort, nach dem ich gesucht hatte. Wie es bei so vielen anderen Menschen geschah, verliebte ich mich in diese Gemeinschaft. Schließlich wurde ich dafür rekrutiert, als Komoderator für die Hilfsgruppe für HIV-Infizierte zu fungieren. Aus dieser Gruppe ergaben sich viele Segnungen für mich; eine davon war eine Arbeitsstelle. Durch meinen Komoderator hörte ich, dass die Stelle des Geschäftsführers bei einer lokalen AIDS-Organisation frei geworden war. Ich bewarb mich und wurde eingestellt.
Die AIDS-Epidemie war damals gerade auf ihrem Höhepunkt, und während der nächsten drei Jahre arbeitete ich mit einem Haufen von Heiligen, Außenseitern, Engeln, Gaunern und Helden, schwulen und heterosexuellen Männern und Frauen, Kindern, Prostituierten und Süchtigen. Die Belegschaft und die Freiwilligen, die in dieser Organisation arbeiteten, gehörten zu den wunderbarsten Menschen, denen ich je begegnet bin – und sie mussten es sein, denn sie hatten es mit verheerenden Umständen zu tun.
Ein Bild hat sich mir besonders tief ins Gedächtnis eingebrannt: Es war ein großes Haus mit Mietwohnungen, in dem einer meiner Mitarbeiter lebte. Dieses Haus war einmal so etwas wie ein Hort für Schwule gewesen, die hier zusammenlebten, sich liebten und einander unterstützten. In den guten Tagen vor dem Auftreten von AIDS teilten sie ihre Freuden miteinander. Sie pflegten einander bei Erkältungen und Grippe, standen sich gegenseitig in emotionalen Krisen bei und packten bei schwerer körperlicher Arbeit mit an. Sie begingen Thanksgiving, Weihnachten, Geburtstage und Begräbnisse zusammen, eben alles, was es so zu feiern und zu betrauern gab. Sie freuten sich an der Gesellschaft der anderen und kümmerten sich umeinander. Kurz gesagt: Sie waren echte Nachbarn. Nachdem die Seuche zugeschlagen hatte, lebte kaum noch jemand in dem Gebäude. Es hatte für eine Weile etwas von einer Geisterstadt.
Ich werde auch niemals die unglaublich kranken und ausgemergelten Körper in den Hospizen und Krankenhäusern vergessen. Ich hatte vorher nicht gewusst, dass Menschen derart krank werden und dermaßen leiden können. Aber ebenso unvergesslich ist für mich, welcher Geist der Menschlichkeit all dieses Leiden durchwehte. Er manifestierte sich in dem Lächeln, das über ein ausgezehrtes Gesicht huschte, und in der Unverwüstlichkeit von Pflegern, die wieder und wieder über Trauer und Entmutigung hinweggingen, um präsent und liebevoll zu sein und das zu tun, was als Nächstes zu tun war. Die Tränen und das Lachen der Menschen, die mit der Epidemie rangen, entsprangen einem Ort tief in ihrem Inneren, ebenso wie ihre Güte und ihr Mitgefühl. Und wer könnte die Menschen vergessen, die durch ihre Aktivitäten die Forschung vorantrieben, der es schließlich gelang, aus der tödlichen eine chronische Erkrankung zu machen? Manchmal denke ich, dass die Menschen, die gegen AIDS kämpfen, die Sanftmütigen sind, die die Erde erben werden. Sie lassen die emotionale und spirituelle Intelligenz erkennen, die meiner Meinung nach nötig sein wird, wenn wir den nächsten Schritt in der Evolution der menschlichen Kultur tun wollen.
Drei Jahre später verließ ich die AIDS-Hilfsorganisation und wurde zum Geschäftsführer des Zentrums in den Hafenanlagen von Tiburon. Die Erfahrung dort war ebenfalls sehr belohnend. In den Selbsthilfegruppen, Workshops und Beratungsdiensten des Zentrums arbeite ich mit Hunderten von Menschen zusammen, die demonstrierten, dass es möglich ist, die eigene Erfahrung durch tief greifende Veränderung der Geisteshaltung zu beeinflussen, ganz gleich, wie schlimm die eigene Situation ist. Bei einigen ging der Wandel schneller vonstatten, andere brauchten länger. Aber aus den ganzen zwölf Jahren meiner Arbeit am Zentrum erinnere ich mich an keinen Fall, in dem ein Mensch nicht in seine Heimat gelangt wäre. Mit „Heimat“ meine ich hier die Erfahrung von Frieden – jene Erfahrung, die dort beginnt, wo die Angst aufhört, und die weiter wachsen kann bis zu einer Geistesverfassung, die es dem Menschen ermöglicht, jegliche widrigen Umstände zu transzendieren. Diese Menschen haben mir geholfen zu erkennen, dass es möglich ist, ohne Angst in dieser Welt zu leben – womit nicht gesagt sein soll, dass dies ein Leben ohne alle Ängste ist. Diese Menschen stellten sich ihren Ängsten Tag für Tag; sie begegneten ihnen mit einer Präsenz, die es ihnen ermöglichte, ihre Verluste und Probleme anzunehmen und sie schließlich zu transzendieren.
Zwei Frauen, denen ich dort begegnet bin, sind für mich Paradebeispiele dafür, welche Transformation bei Menschen möglich ist. Wenn ich einmal das Gefühl habe, das Leben hätte mir schlechte Karten gegeben, brauche ich nur an diese Frauen zu denken, und sofort wird mir das Herz leichter, meine Wirbelsäule richtet sich auf und ich gehe erhobenen Hauptes daher.
Die erste Person war eine Klientin des Zentrums in Argentinien. Ihr Name ist Pilar. Pilar war ein Contergan-Baby. Da ihrer Mutter das Medikament während der Schwangerschaft verschrieben worden war, wurde sie ohne Arme und mit schweren Verkrüppelungen geboren. Misshandelt, vernachlässigt und beiseitegeschoben, fühlte sie sich während des größten Teils ihres Lebens als Opfer und machte ihren Eltern und der Ärzteschaft bittere Vorwürfe wegen ihres Unglücks. Als sie schließlich erwachsen war, musste sie sich allein einer Welt stellen, die Pilar als abstoßend empfand. Wenn irgendein Mensch mit Recht zornig auf das Leben sein darf, dann war es Pilar – und für lange Zeit war sie sehr zornig.
Mithilfe des Zentrums begann sie, über ihr Schicksal und über den Aufruhr ihrer Gefühle hinauszuwachsen. Sie begann sich ihr Leben Moment für Moment wieder anzueignen, indem sie durch Versuch und Irrtum lernte, eine friedliche und vergebende Geisteshaltung zu entwickeln. Ganz allmählich befreite sie sich von der beschränkten und einschränkenden Existenz, die von ihrer Angst, ihrem Pessimismus und ihrem Zorn ständig erneuert worden waren. Was aufgrund ihrer beharrlichen Bemühungen schließlich hervortrat, war Pilar als eine heile Person – lebendig und frei, mit Würde, Intelligenz und der Kraft, Berge zu versetzen. Und sie versetzte tatsächlich Berge. Sie erfüllte sich einen Traum, dessen Erfüllung die meisten Menschen, die sie kannten, für unmöglich gehalten hatten. Sie wurde Künstlerin und malte mit den Füßen. Ihre Kunst gewann schließlich breite Anerkennung und gilt heute als einer der Nationalschätze Argentiniens.
Ich bin stolzer Besitzer zweier ihrer Gemälde. Die Zeit, die ich mit Pilar verbracht habe, war kurz, aber inspirierend, auch wenn wir nur wenig miteinander redeten. Sie spricht Spanisch und ich beherrsche diese Sprache nicht, aber das spielte keine Rolle. Allein schon ihr Gesicht war ein Kunstwerk; es war von einer Geisteshaltung durchstrahlt, die mehr kommunizierte, als Worte zu sagen vermögen. „Was für eine Lektion in Demut ist es doch, einen solchen Menschen zu sehen“, schrieb Dr. Alberto Loizaga, ein Psychiater, der das Zentrum in Argentinien gegründet hat, „einen Menschen, der sich nicht als Opfer fühlt, sondern der eine leidenschaftliche Liebe zum Leben besitzt und dieser durch das Medium der Kunst Ausdruck verleiht.“3
Die zweite Frau heißt Lubie. Als wir uns trafen, war sie vor dem Krieg in Bosnien auf der Flucht. Sie nahm an einem Workshop teil, den wir auf dem Höhepunkt dieses schrecklichen Krieges in Zagreb in Kroatien gaben. Im Gegensatz zu Pilar, die mehrere Monate brauchte, bis sie zu ihrem Durchbruch kam, dauerte das bei Lubie nur wenige Tage.
Der Workshop war Teil eines vom Außenministerium der US-Regierung finanzierten Programms, das Kriegsflüchtlingen helfen sollte, mit dem posttraumatischen Stress als Folge der unsäglichen Brutalität, deren Zeuge sie geworden waren, zurechtzukommen. Lubie war nur eine von dreihundert Teilnehmern an diesem Workshop, aber sie fiel mir sofort auf. Ich weiß noch genau, wie sie den Raum betrat und einen Platz in der dritten Reihe gleich am Seitengang einnahm. Sie war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, so als trage sie Trauer. Ihre Augen waren hinter einer Sonnenbrille versteckt und ihr Haar war von einem Kopftuch bedeckt. Während der ganzen Vormittagssitzung saß sie bewegungslos da, ohne das Kopftuch oder die Sonnenbrille abzunehmen; sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt und sah mich, der ich den Workshop leitete, an. Sie ließ keinerlei Gefühle erkennen; alles, was ich sehen konnte, waren herabgezogene Mundwinkel, was sich auch nicht änderte, wenn etwas Komisches passierte.
Die Mittagspause kam, und ich erwartete nicht, sie nach der Pause wieder zu sehen. Als ich die Nachmittagssitzung eröffnete, war sie jedoch wieder da und saß auf demselben Platz. Sie trug jetzt kein Kopftuch und keine Sonnenbrille mehr, und ich sah den tiefen Kummer in ihren Augen. Ich war überrascht, sie auch am nächsten Tag wieder zu sehen. An diesem und dem nächsten Tag wurde die Gruppe in kleinere Diskussionsgruppen aufgeteilt, und Lubie wurde der Gruppe zugeteilt, die ich moderierte. In der Sicherheit der kleineren Gruppe öffnete Lubie sich langsam emotional und erzählte von einigen der tragischen Erfahrungen, die sie bisher in ihrem Inneren verschlossen gehalten hatte. Sie sprach über ihren Schmerz, weinte darüber, und indem sie allmählich begann, ihn zu akzeptieren, ließ ihr Leid nach. Während der letzten Sitzung war sie sehr viel entspannter und war tatsächlich eine große Hilfe für alle anderen in der Gruppe.
Es ist immer eine erstaunliche Erfahrung, Zeuge einer solchen Heilung und auch ihrer Belastbarkeit zu sein. „Das Paradoxe ist“, sagte Dr. med. Daniel Siegel, der Direktor des Mindfulness Awareness Research Center an der University of California in Los Angeles, „dass man gerade dann, wenn man fähig ist, die eigenen Grenzen zu definieren, tatsächlich Freiheit gewinnt“.4 Es ist genau so, wie Eckhart Tolle es formuliert hat: „In dem Augenblick, in dem man den eigenen Unfrieden vollkommen akzeptiert, wird dieser Unfriede in Frieden umgewandelt.“5
Obwohl es mitten im Winter war, erschien Lubie zum letzten Tag des Workshops in farbenfroher seidener Kleidung, die einen Hauch von Frühling in den Raum brachte. An diesem Tag ergriff sie vor dreihundert Menschen das Wort und erzählte, sie habe vor dem Workshop geglaubt, ihr Leben verloren zu haben. Sie hatte das Gefühl gehabt, der Krieg habe das Leben aus ihr herausgesaugt und nur eine leere, lieblose Hülle zurückgelassen, in der sie für den Rest ihres Leben voller Schmerzen würde leben müssen. Doch im Laufe der vergangenen drei Tage sei alles anders geworden. Sie hätte sich im Workshop sicher genug gefühlt, das fühlen zu können, was sie fühlen musste, und das ansehen zu können, was sie ansehen musste, und schließlich die finsteren Stimmen in ihrem Kopf, die ihr alle Freude und allen Frieden geraubt hatten, infrage zu stellen. Dann begann sie zu weinen, sagte aber, dies seien Tränen der Freude. Dies war für alle Teilnehmer des Workshops ein zutiefst heilender Moment. Ein Jahr später traf ich Lubie in Zagreb auf einen Kaffee wieder, und sie hatte offenbar keinen Rückfall in die leere Hülle erfahren, die der Krieg aus ihr gemacht hatte. Lubie ist ein Beispiel dafür, wie schnell Menschen sich ändern können, wenn sie dazu bereit sind.
Wenn wir von Umständen sprechen, die die Welt uns auferlegt hat und über die wir keinerlei Kontrolle besitzen, dann sprechen wir gern von den Tatsachen des Lebens. Bei diesen beiden Menschen hat der innere Frieden die Tatsachen transzendiert. Als eine dynamische Form des Daseins ist der Friede eine innere Stärke, die uns über die Umstände und alles, was die Welt uns anzutun vermag, hinauswachsen lässt. Angst ist das, was uns diese Kraft verlieren lässt.
Einige Zeit vor dem Ende meiner Anstellung im Zentrum forderte mein Freund Larry Stupski mich heraus, ein Programm der Stressbewältigung zu entwickeln, das helfen könne, die Arbeit gesünder, freudvoller, belohnender und erfolgreicher zu machen. Während der dreizehn Jahre, in denen das Unternehmen von Charles Schwab das enorm schnelle Wachstum erlebte, welches es so bekannt gemacht hat, arbeite Larry dort als leitender Geschäftsführer. Larry betrachtet Stress und die Störung der zwischenmenschlichen Kommunikation, die daraus resultiert, als eines der gravierendsten Hindernisse für den langfristigen Erfolg einer Firma. Ich teilte diese Ansicht und war fasziniert von der Idee, dass es tatsächlich eine Lösung für das Problem des Stresses am Arbeitsplatz geben könnte. Als ich die diesbezügliche Literatur studierte, fand ich Larrys Ansichten bestätigt. In Amerika herrscht am Arbeitsplatz oft eine stressgeladene Atmosphäre, die für die Menschen und das Unternehmen schädlich ist. Sie hat negative Auswirkungen auf die persönliche Leistung, die Teamarbeit und die Motivation und führt damit letztlich zu einer Einschränkung der Rentabilität. Sie wirkt sich außerdem auf die Familien und die Beziehungen außerhalb des Arbeitsplatzes aus, weil die Menschen ihren Stress mit nach Hause nehmen. Die meisten von uns wissen das, die meisten spüren es, und eine ganze Reihe von Studien hat gezeigt, dass die meisten wegen dieses Stresses letztlich mit ihrer Arbeit unzufrieden sind. Das Problem ist, dass niemand zu wissen scheint, was man daran ändern könnte.
Ich vertiefte mich auch in die Forschungsergebnisse der Neurowissenschaft, indem ich einen Haufen Bücher zu diesem Thema durcharbeitete. Während der vergangenen zehn Jahre hat die Neurowissenschaft bei der Erforschung der Funktionsweise unseres Bewusstseins erstaunliche Durchbrüche erzielt. Was ich herausfand, lässt sich im Großen und Ganzen folgendermaßen zusammenfassen: Stress ist Angst, Frieden ist Kraft. Angst ist der biologische Auslöser für eine Stressreaktion. Zu viel Stress beeinträchtigt die höheren Gehirnfunktionen und chronischer Stress macht es dem Gehirn unmöglich, Spitzenleistungen zu erbringen, positive Beziehungen zu pflegen und gesund zu bleiben. Friede ist offensichtlich das genaue Gegenteil von Angst und Stress. Eine auf dynamische Weise friedvolle Geisteshaltung führt, neurologisch gesehen, zu optimaler Gehirnfunktion und einem Prozess der Regeneration, der die Auswirkungen von Stress umzukehren vermag. Aus neurologischer Sicht ist Erfolg innerer Friede, und Erfolg ist das Loslassen von Angst. Und es gibt noch einen Bonus obendrauf: Eine auf dynamische Weise friedvolle Geisteshaltung führt auch zu einer erfüllenderen Lebenserfahrung. Der psychologische Begriff dafür ist „Flow“.
Kurz gesagt: Friede ist gleichbedeutend mit einem Gehirn, das seine absolute Höchstleistung zu erbringen vermag. Er führt zu einer Gehirnfunktion, die nötig ist, um auf jeder Ebene des Lebens Erfolg zu haben. Angst führt zu einem vergifteten Gehirn, das von Stresshormonen überflutet ist. Larry hatte offensichtlich Recht. Und wir hatten eine Lösung für das Problem, und zwar nicht nur für den Arbeitsplatz, wie Larry es sich gewünscht hatte, sondern ebenso für Eltern und Ehepaare, Schüler, Studenten und Lehrer. Unsere Lösung sollte im Grunde für jedermann funktionieren, dem es darum geht, Stress und die davon verursachten Unannehmlichkeiten zu überwinden.
Fünf Jahre später kulminierten meine Recherchen und meine Entwicklungsarbeit in der Gründung eines Unternehmens namens ProAttitude, welches Menschen hilft, diesen optimalen Bewusstseinszustand zu verwirklichen. Dieses Buch fasst all das zusammen, was ich über eine auf dynamische Weise friedvolle Geisteshaltung gelernt habe, und zeigt auf, welcher Prozess uns hilft, sie zu verwirklichen.
* In vierzehn Monaten lächelte ich nur einmal, und auch das tat ich nicht bewusst. Irgendjemand muss den Pfad zu dir finden. Mir scheint, das wird meine Aufgabe sein.
* Der Satz stammt von der englischen Mystikerin Juliane von Norwich, 1342 – 1416. (Anm. d. Übers.)