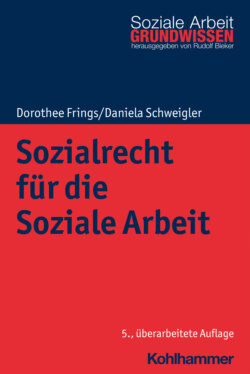Читать книгу Sozialrecht für die Soziale Arbeit - Dorothee Frings - Страница 53
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gut zu wissen – gut zu merken
ОглавлениеDie Diskussion um verbürgte soziale Rechte beschäftigt die Verfassungs- und Menschenrechtsdiskussion bereits seit der Französischen Revolution.
Der Beginn einer staatlichen Sozialpolitik in Deutschland lässt sich auf das Jahr 1881 datieren. Die Kaiserliche Botschaft vom 17. November legte die Grundlage für das Bismarksche Sozialversicherungssystem, welches bis heute in seiner Grundstruktur erhalten ist.
Trotz der hohen Bedeutung der sozialen Sicherungs- und Ausgleichssysteme haben ausdrückliche soziale Grundrechte keinen Eingang in die deutsche Verfassung gefunden.
Das Grundgesetz ist primär an Freiheitsrechten orientiert, soziale Rechte genießen jedoch den Schutz der Verfassung, wenn sie notwendige Vorbedingung sind, um ein selbst bestimmtes Leben in Würde zu führen.
Unabdingbare Voraussetzung des mit Handlungskompetenz und Würde ausgestatteten Menschen sind Rechtsansprüche gegen den Staat. Die Verweisung in die Bittstellerposition ist daher unzulässig. Aus dem Anspruch auf den Schutz der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) ist deshalb der Anspruch auf das finanzielle Existenzminimum und ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe abzuleiten.
Aus dem Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 und 3 GG) leitet sich der Anspruch auf eine Zuteilung sozialer Leistungen nach gerechten Kriterien (soziale Gerechtigkeit) ab.
Die Gestaltung des Sozialsystems liegt weitgehend in der Hand des Gesetzgebers, solange die beiden Grundprinzipien nicht angetastet werden und von dem Gestaltungsauftrag in ausreichendem Maß Gebrauch gemacht wird (Untermaßverbot).
Das Sozialrecht lässt sich in drei Bereiche gliedern: Vorsorge, Entschädigung sowie Förderung und soziale Hilfen.
Sozialleistungen dürfen nur auf der Grundlage eines Gesetzes erbracht werden (Vorbehalt des Gesetzes).
Ein Anspruch setzt eine Anspruchsgrundlage voraus. Diese gliedert sich stets in den Tatbestand (= die Voraussetzungen) und die Rechtsfolge. Die Rechtsfolge kann nur eintreten, wenn alle Voraussetzungen vorliegen.
Die Rechtsfolge kann die Verwaltung zu einer festgelegten Handlung verpflichten (»ist zu leisten«) oder ihr ein Ermessen einräumen (»kann geleistet werden«). Neben dem freien Ermessen (»kann«), welches lediglich fehlerfrei ausgeübt werden muss, findet sich auch das gebundene Ermessen (»soll geleistet werden«). Hier wird die Rechtsfolge für den Regelfall vorgegeben, Abweichungen sind nur zulässig, wenn ein Ausnahmefall (deutliches Abweichen von der Situation, die der Gesetzgeber vor Augen hatte) vorliegt.
Der öffentliche Leistungsträger gewährleistet die Rechtsansprüche des Bürgers. Soziale Dienstleistungen werden jedoch überwiegend nicht vom Leistungsträger selbst, sondern von freien Trägern erbracht. Den freien Trägern kommt eine begrenzte Vorrangstellung zu. Der öffentliche Träger soll eigene Dienste nur schaffen, wenn die Aufgabe nicht von einem freien Träger übernommen wird (Subsidiaritätsprinzip). Bestehende Dienste dürfen fortgeführt werden.
Die freien Träger bestimmen über die Ausgestaltung ihrer Tätigkeit grundsätzlich selbst und unterliegen nicht den Weisungen des öffentlichen Trägers (Trägerautonomie).
Aus diesem Verhältnis zwischen den öffentlichen und freien Trägern und den Leistungsberechtigten ergibt sich das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis: Der freie Träger verpflichtet sich gegenüber der Bürgerin vertraglich zu einer Leistung, erhält die Vergütung jedoch vom öffentlichen Träger. Der Rechtsgrund für die Leistung des öffentlichen Trägers ist der gesetzliche Anspruch der Bürgerin, der durch die Verschaffung und Vergütung der Leistung des freien Trägers erfüllt wird.
In einigen Bereichen, insbesondere in der Arbeitsförderung, wird der freie Träger durch den öffentlichen Träger mit einer Leistungserbringung beauftragt. In diesen Fällen müssen die Regeln des Vergabeverfahrens eingehalten werden, um nicht einzelne freie Träger unzulässig zu bevorzugen.
Die Finanzierung der freien Träger kann im Wege der Zuwendung oder der Entgeltfinanzierung erfolgen.
Bei der Zuwendungsfinanzierung wird den freien Trägern ein bestimmter Betrag zur Verfügung gestellt, um damit eine bestimmte Aufgabe wahrzunehmen.
Bei der Entgeltfinanzierung wird die erbrachte Leistung bezogen auf die individuellen Klienten abgerechnet. Grundlage für die Abrechnung sind im Vorfeld abgeschlossene Vereinbarungen über die Leistung und die Vergütung (in der Regel Tagessätze oder Fachleistungsstunden).
Die Entgelte werden stets prospektiv, also für einen zukünftigen Zeitraum, vereinbart.