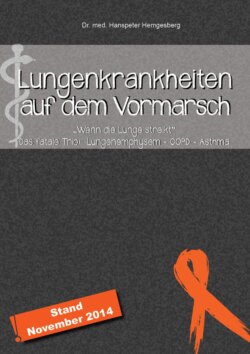Читать книгу Lungenkrankheiten auf dem Vormarsch - Dr. Hanspeter Hemgesberg - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lunge (Anatomie & Funktion)
ОглавлениеDie
Lunge
(Pulmo)
ist ein der
Atmung
dienendes, paarig angelegtes
Organ
. Sie nimmt
Sauerstoff
aus der
Atemluft
auf und transportiert
Kohlendioxid
als Endprodukt des Körperstoffwechsels ab.
D
er Mensch besitzt zwei Lungen(hälften), die zu beiden Seiten der
Brusthöhle
liegen und vom
Mediastinum
getrennt werden. Die linke Lunge (Pulmo sinister) ist in zwei, die rechte Lunge (Pulmo dexter) in drei
Lungenlappen
(Lobi pulmonis) unterteilt. Die Lungenlappen lassen sich weiter in 19
Lungen-Segmente
(Segmenta broncho-pulmonalia) gliedern, die jeweils von einem
Segmentbronchus
und einer
Segmentarterie
versorgt werden. Die Segmente sind funktionelle Untereinheiten der Lunge. Es gibt jeweils 10 Segmente pro Lungenfügel, wobei das Segmentum apicale und das Segmentum posterius auf der linken Seite zum Segmentum apicoposterius verschmelzen. Deshalb besitzt der linke Lungenflügel eigentlich nur 9 Segmente.
Die Lunge beginnt im Prinzip am Lungenhilus (Hilum pulmonis),
lateral
der Luftröhre (
Trachea
). Diese verzweigt sich in der
Bifurkation
in die beiden
Hauptbronchien
(Bronchi principales), die gemeinsam mit den
Lungenarterien
und den
Lungenvenen
in den Hilus eintreten. Der Hauptbronchus bildet den Stamm des
Bronchialbaums
, der sich innerhalb der Lunge verzweigt und letztlich über die
Bronchiolen
in die
Alveolen
übergeht.
In der Trachea und den Bronchien werden die luft-führenden Hohlräume von
Knorpelspangen
offen gehalten. In den Bronchiolen sieht man nur noch inselartige Knorpelvorkommen.
Die Alveolen enthalten keinen Knorpel. Damit die Alveolen nicht bei der Ausatmung zusammenfallen sind sie mit
Surfactant
[?] benetzt.
Außen ist die Lunge vom
viszeralen
Blatt des Lungenfells (
Pleura
) überzogen. Am Lungenhilus geht das viszerale Blatt in das parietale
Blatt der Pleura
(„Rippenfell“)
über. Die Pleuraduplikatur
kaudal
des Hilus bezeichnet man als
Ligamentum pulmonale
.
A
ls
Lungenfunktion
wird die
physiologische
oder
pathologische
Funktion der
Lunge
als Organ für den Gasaustausch bei der äußeren
Atmung
bezeichnet.
Im
medizinischen
Alltag hat sich der Begriff Lungenfunktion (Abk. LuFu) auch als Sammel- und Oberbegriff für die verschiedenen Untersuchungsverfahren der Lungenvolumen-Messgrößen und anderer Kennzahlen der Lungenfunktion eingebürgert, z.B. der
Spirometrie
(
„kleine Lungenfunktion“
) und der
Bodyplethysmographie
(
„große Lungenfunktion“
) [vgl. Diagnostik].
Die
physiologische Funktion der Lunge
besteht im sogenannten Gasaustausch, der Aufnahme von
Sauerstoff
in den Körper und Abgabe von
Kohlendioxid
aus dem Körper. Damit spielt die Lunge auch in der Regulation des
Säure-Basen-Haushaltes
eine wichtige Rolle.
So der „Normalzustand“.
B
ei Erkrankungen im Bereich des Atmungsorgans sieht das schon ganz anders aus.
Einmal abgesehen von (zumeist) nur kurzzeitig andauernden Beschwerden bei akuten Entzündungen (z.B. Bronchtis, Bronchial-Katarrh), die zu keiner Behinderung/Störung des Gasaustausches führen, bringen gravierend(er)e „Lungenerkrankungen“ stets eine mehr oder minder und vielmals progrediente (fortschreitende) Gasaustausch-Störung - eine „Ventilationsstörung“ oder eine „Belüftungsstörung“ mit sich.
Bei den
Ventilationsstörungen
gilt es zu unterscheiden zwischen:
1. Obstuktive Ventilationsstörung
= obstruktive Lungenfunktionsstörung
Hier ist der
Atemwegswiderstand erhöht
. Verursacht werden kann dies durch Sekret oder Fremdkörper in den Atemwegen - Bronchien (z.B. bei chronischer Bronchitis), durch einengenden Druck von außen (z.B. Tumor oder Ödeme), durch Emphyseme (Lungenüberblähung) oder Verengung der Bronchien (z.B. durch Asthma bronchiale oder spastische Bronchitis).
Die Obstruktive Lungenfunktionsstörung zeigt sich im
Tiffeneau-Test
durch forcierte Exspiration, wobei das Forcierte Exspiratorische Sekunden- Volumen (FEV1) erniedrigt ist, die Forcierte Vitalkapazität (FVC) aber gleich bleibt. Ebenso können ein erhöhtes Residualvolumen sowie eine verminderte Vitalkapazität bei länger andauernder Obstruktion diagnostiziert werden.
Krankheitsbilder, die eine Obstruktive Ventilationsstörung verursachen, sind Asthma, chronische Bronchitis bzw. COPD, Fremdkörperaspiration.
2. Restriktive Ventilationsstörung
= restriktiven Lungenfunktionsstörung
Hier ist die Vitalkapazität und die totale Lungenkapazität vermindert. Verursacht ist dies durch eine eingeschränkte Compliance des Atemapparats (die Dehnungsfähigkeit ist eingeschränkt). Das Auftreten einer restriktiven Lungenfunktionsstörung kann z.B. an Verwachsungen der Pleura, Lungenfibrose, Verlust von Lungengewebe oder Thorax-Beweglichkeit (zum Beispiel Skoliose, Trichterbrust) liegen.
3. Respiratorische Insuffizienz
Nach der GOLD-Klassifikation [vgl. Klassifikation bei Besprechung COPD, später im Buch] liegt sie vor, wenn der Sauerstoffpartialdruck im arteriellen Blut unter 60 mmHg oder Kohlendioxidpartialdruck im arteriellen Blut über 50 mmHg liegt.
Außerdem ist zu unterscheiden zwischen
Perfusions-
und
Diffusions-Störungen
:
1. Perfusionsstörungen
Unter
Perfusion
ist die Durchblutung der Lungenkapillaren zu verstehen, angepasst an die Ventilation.
Perfusionsstörungen:
Bei Gefäßverschlüssen ist die Perfusion im Verhältnis zur Ventilation eingeschränkt. Sie beruhen auf einem Missverhältnis von Durchblutung und Belüftung von Lungenabschnitten. Beispiele sind Lungenembolie, Lungenfibrose (Verdickung der Alveolar-Membran) und Lungenemphysem (Lungenüberblähung). Bei eingeschränkter oder fehlender Perfusion wird der Totraum vergrößert (der Raum, der nicht am Gasaustausch beteiligt ist).
2. Diffusionsstörungen
Die
Diffusion
ist ein passiver Transportvorgang, Teilchen wandern vom Ort höherer Konzentration zum Ort niedriger Konzentration.
Gasaustausch in der Lunge: O
2
gelangt aus der Luft in den Alveolen durch die Membran in die Kapillaren, CO
2
aus dem Lungenkapillarblut in die Alveole.
Diffusionsstörungen:
D.s. Gasaustauschstörungen, die zu einer Lungenfunktionsstörung führen. Das können sein: verlängerter Weg des Austausches von O
2
/CO
2
bei Lungenfibrose durch Verdickung der Alveolar-Membran. Verlust von Alveolen: Austauschfläche ist verkleinert bei Pneumonie und Lungenemphysem. Verkürzte Kontaktzeit: bei Lungenresektion.
N
unmehr zu Erkrankungen der Lunge und zwar ausschließlich zu chronischen Lungenkrankheiten