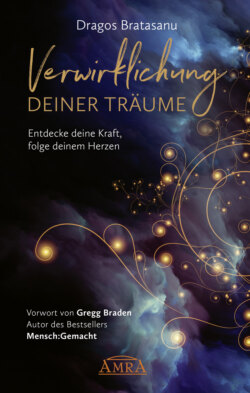Читать книгу Verwirklichung deiner Träume - Dragos Bratasanu - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 In dieser Stadt lächelt niemand mehr
Lügen wurden zur Norm,
das Trügerische wurde zur Realität.
Juli 1984. Eine Kleinstadt in Osteuropa.
≻ Erster Abschnitt
Ich kam 1984 in einer kleinen Stadt in Rumänien zur Welt, zehn Minuten vor Mitternacht. Mein Vater war geschäftlich unterwegs und meine Mutter allein in der Wohnung, als die Fruchtblase platzte.
Achtzehn Jahre lang lebten wir drei in derselben Wohnung, bis ich wegen meines Studiums wegzog. Aber meine Eltern erzählten mir nicht viel über ihr Leben vor meiner Geburt. Häufig sah ich mir ihre Fotos aus der Zeit ihrer Jugend an, weil ich sie etwas besser kennenlernen wollte. Offenbar hatten sie damals einen großen Freundeskreis gehabt. Auf diesen Aufnahmen hatte meine Mutter meinem Vater stets die Arme um den Hals geschlungen. Manchmal malte ich mir ihre früheren Lebensgeschichten aus, an denen sie mich nicht teilhaben ließen: zwei schöne Fremde mit Blumen im Haar, die nach Freiheit gierten. Sie waren jung, verliebt ins Leben und ineinander. Aber sie wuchsen während der schrecklichsten Jahre des Kommunismus in Osteuropa auf.
Man kann sich noch so sehr bemühen, anhand alter Fotos eine Geschichte zu erzählen: Das Papier zeigt einem nur, was man dich sehen lassen will. Die Wahrheit bleibt ein Geheimnis des menschlichen Herzens.
Nach ihrer Heirat zogen meine Eltern in eine kleine Hafenstadt an der Donau. Der ältere Teil der Stadt wurde im fünfzehnten Jahrhundert gebaut und strahlte die Atmosphäre eines ruhigen Pariser Viertels aus. Noch vor fünfzig Jahren wirkten die Häuser wie riesige Hochzeitstorten: Die hohen weißen Gebäude waren an den Fenstern mit Rosetten verziert und die Holztüren mit Ornamenten wie steinernen Ahornblättern, gemeißelten kleinen Säulen, Farnen und Meereswellen. In den Balkonkästen blühten in üppiger Pracht weiße, blaue und purpurrote Blumen. Sonntagmorgens verließen die Menschen ihre Häuser, um durch den Park zu schlendern oder zur Kirche zu gehen. Dafür zogen sie sich so fein an wie die Figürchen von Braut und Bräutigam, die normalerweise eine Hochzeitstorte schmücken.
In jenen Tagen begrüßten sich die Menschen, schwatzten und lachten miteinander auf den Straßen. Damals lächelten die Menschen dieser Stadt.
Doch in der Zeit, als meine Eltern zur Welt kamen, übernahm die Kommunistische Partei die Herrschaft über das Land. Man zwang die Menschen, aus ihren Häusern auszuziehen, und jeder, der sich widersetzte, landete im Gefängnis. Die Menschen mussten auch ihre Bauernhöfe und Tiere aufgeben und ließen hinter sich ein ganzes Arbeitsleben und Tränenspuren zurück. Man siedelte sie in eigens für sie errichtete Mietskasernen um. Diese Bauten verbreiteten sich wie Tumore auf dem Angesicht des Landes. Man nannte sie »Streichholzschachteln«: graue übereinander gestapelte Schachteln aus Beton, jede vollgestopft mit notleidenden Seelen.
In ihrer Verzweiflung schwammen manche Leute im Schutz der Nacht ans andere Ufer der Donau, um dort entweder in die Freiheit zu gelangen oder den Tod zu finden. Nur wenigen gelang die Flucht ins Ausland, und dann blickten sie niemals wieder auf ihr früheres Leben zurück. Doch die meisten Flüchtlinge wurden abgefangen, und danach ließ man sie, von allen vergessen, in unterirdischen Gefängnissen schmachten. Viele hatten Angst vor der Flucht und blieben deshalb im Lande.
Diejenigen, die wussten, wie man Rundfunkempfänger baut, versteckten sich nach Einbruch der Dunkelheit in ihren Kellern und schalteten bestimmte europäische Sender ein, um etwas über die westliche Welt zu erfahren. Das örtliche Radio und die Fernsehprogramme brachten nur kommunistische Propaganda. Hätte man diesen Sendungen geglaubt, hätte man meinen können, am besten Ort auf der ganzen Welt zu leben.
Wenn der Himmel aus vollkommener Liebe geschaffen wurde, so war das Fundament des Staates Rumänien absolute Angst. Wenn der Himmel Freiheit bedeutet, war mein Winkel auf dieser Welt ein einziger Kerker. Nur war es den meisten Menschen gar nicht klar, dass sie sich in einem Kerker befanden. Sie erhielten eine Ausbildung, lernten aber nur das, was sie wissen mussten, um ihre Arbeit zu tun. Man schickte sie dann zu einer Arbeitsstelle irgendwo im Land, sie hatten jedoch nicht die Freiheit, ihren Lebensweg selbst zu bestimmen. Sie erhielten eine Wohnung und Lohn, durften das Land jedoch niemals verlassen.
Seinerzeit war Rumänien ein Seelengefängnis, und die Sehnsucht nach Freiheit galt als Todsünde. Die Menschen hatten Vater und Mutter zu ehren – und beides verkörperte die Kommunistische Partei. Neben der Partei durften sie keine anderen Götter verehren – und es gab auch keine anderen. Sie durften den Namen der Partei auch nicht unnütz im Munde führen, denn wer das Falsche sagte, wurde eingesperrt. Diejenigen, die Gedichte schrieben, Lieder spielten oder ihren Schülerinnen und Schülern von Freiheit erzählten, wurden verhaftet und für schuldig befunden.
In dieser Umgebung lernten die Menschen, andere Menschen zu fürchten und niemandem zu vertrauen, und sie passten sich den gesellschaftlichen Zwängen an. Sie schlugen die Türen ihrer Seele zu, lebten allein und wagten nicht, ihr Inneres nach außen hin auszudrücken. Sie versiegelten ihren kreativen Geist. Sie verstummten gegenüber der Wahrheit, gegenüber ihren Träumen, gegenüber der Freiheit, die sie gebraucht hätten, um aufzublühen. Ihre Worte und ihr Verhalten handhabten sie so, dass sie in diesem sozialen Unfeld überleben konnten. Sie verschlossen die Wahrheit in ihrem Inneren und arbeiteten jeden Tag daran, sie zu missachten und in sich verborgen zu halten.
Im Laufe der Jahre wurden bei ihnen Lügen zur Norm und das Trügerische zur Realität. Ihre Gedanken waren sorgenschwer und voller Angst, und die Lügen, die sie lebten, wurden zu ihrer Lebenserfahrung. Tag für Tag zogen sich die Menschen nach der Arbeit in die Keller ihrer Gebäude zurück, versteckten sich dort so, dass niemand sie sehen konnte, und verdrängten die Realität durch das Trinken. Die Wahrheit verrottete in ihrem Inneren, und der Alkohol diente als Schmerzmittel.
Heute lächelt in dieser Stadt niemand mehr.
≻ Zweiter Abschnitt
Am Tag meiner Geburt packte meine Mutter ihre Sachen und machte sich allein auf den Weg zur Notaufnahme der Klinik. Ich drehte mich in ihrem Leib und stemmte meine Füße gegen die Wände, damit ich nicht herausfiel. Zwölf Stunden lang wendete ich mich von dem Licht ab und auch von den Stimmen, die mich aufforderten, herauszukommen. Doch plötzlich öffnete sich die Decke über mir. Zwei blaue Arme griffen nach meinen Beinen und zerrten mich nach draußen. Ich brüllte, aber das beeindruckte sie nicht.
Meine Mutter schlief mit mir auf der Brust ein. In dieser Nacht legte sie mich nach ihrem Kaiserschnitt nahe an ihr Herz, und dort umfängt sie mich seitdem immer noch, genau wie mein Vater.
In dieser Stadt, in der niemand lächelte, wuchs ich auf und ging dort zur Schule. Die anderen Kinder lachten über meinen riesigen Kopf. Er ähnelte dem üppigen Pusteblumenkopf eines Löwenzahns auf einem dünnen Stängel. Meine Ohren waren zusammengefaltet aus dem Mutterleib gekommen, und meine Mutter musste mir mehrere Monate lang einen Mullverband um den Kopf wickeln. Ich sah damit wie ein Elefant aus. Wenn ich zu sprechen versuchte, brabbelte ich irgendetwas, brachte die beabsichtigten Wörter in meinem Gehirn durcheinander, während ich probierte, sie in die richtige Reihenfolge zu bringen.
Ständig zwinkerte ich mit dem rechten Auge, und die Winkel meiner Oberlippe hoben sich alle zwei Sekunden, ohne dass ich es ihnen erlaubt hatte. Irgendwann löste ein anderer Tick diesen Tick ab, doch es folgten noch weitere. Zunächst zuckte meine Oberlippe so, dass ich wie ein verwirrter Hund aussah, der mit sanftem Blick knurrt. Dann sackte meine Unterlippe so weit herunter, dass meine Verwandten meinten, ich wäre ständig betrunken. Als meine Lippen wieder normales Aussehen annahmen, beschloss mein Mund, dauernd grundlos zu lächeln, doch nie zogen sich beide Mundwinkel gleichzeitig hoch. Es war so, als wollte ich nun mit den Lippen zwinkern. Ich dachte, ich würde niemals eine Freundin finden.
In der ersten Klasse erzählte uns der Lehrer eines Tages, dass unsere Seele unsichtbare Kräfte habe und wir uns mit anderen Menschen allein kraft unserer Gedanken verständigen könnten. Ich hatte mich in ein Mädchen aus meiner Klasse verknallt, aber da ich meiner Mimik nicht vertrauen konnte, wagte ich nicht, sie anzusprechen. Als ich an jenem Tag nach Hause ging, beschloss ich, dem Mädchen kraft meiner Gedanken eine Botschaft zu schicken. Ich drückte meine Augen zu, verkrampfte meine Hände und spannte meinen Körper an, um ihr gedanklich mitzuteilen, dass ich sie gerne hatte. Und dann kam mein Vater herein und fragte mich, ob ich etwa versuchte, mein großes Geschäft im Bett zu erledigen.
Schließlich schaffte ich es drei Tage später, dem Mädchen einen guten Morgen zu wünschen. Vier Jahre danach brachte ich den Mut auf, ihr einen Kuss zu geben. Die guten Dinge im Leben brauchen eben Zeit …
≻ Dritter Abschnitt
Meine ersten Lebensjahre waren zugleich die letzten, härtesten Jahre des Kommunismus in Rumänien. Meine Eltern opferten sich für mich auf, doch in unserem Land waren ihre Möglichkeiten sehr begrenzt. Meine Mutter arbeitete in einer Bäckerei und mein Vater mühte sich Woche für Woche sechs oder sogar sieben Tage lang in einem Industriebetrieb mit sehr anstrengender Arbeit ab, um sicherzustellen, dass ich alles erhielt, was ich brauchte.
Und dann wurden die Lebensmittel knapp. Meine Großeltern mussten vor der Morgendämmerung stundenlang vor einem Lebensmittelladen Schlange stehen, um eine Flasche Milch mit nach Hause zu bringen. Nach acht Uhr früh waren die Ladenregale leer. Einmal pro Woche konnten die Menschen mit den von den Behörden kontrollierten Lebensmittelmarken ein paar Eier und etwas Fleisch kaufen. Die Gebetszeile »Und gib uns heute unser täglich Brot« hatte für uns inzwischen wörtliche Bedeutung. Meine Familie durfte pro Tag laut Bezugsschein kaum mehr als einen einzigen Laib Brot abholen. Bei jeder Mahlzeit riefen mir meine Verwandten ins Gedächtnis, wie teuer Lebensmittel waren. Sie drängten mich zwar zu essen, verrieten mir jedoch zugleich die ungeheuren Kosten für Hühnchen, Tomaten, Käse und jedes andere Häppchen auf meinem Teller.
Als ich fünf Jahre alt wurde, nahmen mich meine Eltern in den einzigen Süßwarenladen in der Stadt mit. Ich machte große Augen, meine Pupillen weiteten sich, und es verschlug mir den Atem. Meine Geschmacksknospen tanzten Rock’n’Roll, der auch meine Ohren erfasste. Mein Kiefer klappte zu einem dämlichen Grinsen herunter, als eine Flasche auf den Tisch gestellt wurde. »Was ist das für ein Getränk, und was ist das für eine Farbe?«, fragte ich meine Eltern. »Hab so was noch nie gesehen.« Und wieso bin ich der Einzige am Tisch, der so was trinkt?, dachte ich bei mir.
Pepsi-Cola war in meinem Land so rar, dass man eine Flasche davon nur dann bekommen konnte, wenn man an einem bestimmten Tag des Monats zur richtigen Zeit in diesem Laden auftauchte – und falls man mit dem Ladeninhaber gut befreundet war. Meine Eltern hatten ihn schon Wochen zuvor dazu überredet, eine Flasche für mich zu verstecken, aber für sie hatte er keine weitere Flasche übrig. (Meine erste Coca-Cola bekam ich erst nach fünf weiteren Jahren.)
Wie die meisten Kinder glaubte ich alles, was mir die Menschen in meinem Umfeld erzählten. Ich glaubte ihnen, wenn sie sagten, das Leben sei hart. Ich glaubte ihnen, dass wir nicht genügend Geld zum Leben hätten. Ich glaubte ihnen, dass es derzeit schwer sei, mit dem Geld auszukommen. Ich glaubte ihnen, dass die Reichen Verbrecher und die Menschen einander gegenüber feindselig eingestellt seien. Ich glaubte, dass nur andere Leute das sein, tun oder haben konnten, was sie wollten – nicht aber ich. Ich hielt mich für einen Niemand und meinte, meine einzige Chance im Leben liege darin, gute Schulnoten zu bekommen. Doch zugleich glaubte ich, nicht schlau genug zu sein, um das zu schaffen. Im Laufe der Zeit setzte sich in mir der Gedanke fest, dass ich ein unzulänglicher Mensch sei.
Ich brauchte fünfzehn Jahre zu der Erkenntnis, auf welche Weise die soziale Umgebung unsere persönlichen Realitäten erschafft … fünfzehn Jahre dazu zu merken, wie falsch ich das Leben an sich und mich selbst wahrnahm und einschätzte.