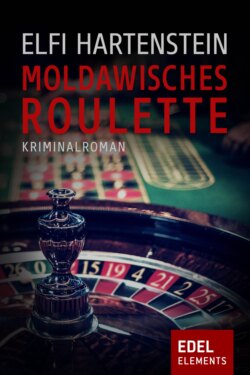Читать книгу Moldawisches Roulette - Elfi Hartenstein - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеMitunter treibt es mich abends doch noch einmal nach draußen. Zumal da etwas ist, das ich mir, sooft ich mir das Bild auch wieder vor Augen halte, einfach nicht erklären kann. Es widerspricht jeder Logik. Dass ich in der Schule keine Leuchte in Mathematik war, lag eindeutig am Lehrer. Denn nachdenken, kombinieren und Schlüsse ziehen kann ich sehr wohl. Und es beschäftigt mich, dass auch Wolf, der Mathematiker und von daher viel systematischer ist als ich, mir die Sache nicht erklären konnte. Ich male mir also etwas Farbe ins Gesicht, vergewissere mich, dass meine Schuhe geputzt sind, stecke Geld, Zigaretten und Halstabletten ein und mache mich auf den Weg zu meinem Auto. Zehn Minuten später parke ich vor dem Seabeco.
In diesem Land gibt es einen feinen Unterschied zwischen den Menschen. Die einen sind die, die zwar irgendwie an Devisen kommen, sie jedoch nicht ausgeben, sondern als Notgroschen in Tüten und Kuverts zu Hause versteckt halten, die nur bei Bedarf hervorgeholt werden.
Die anderen tragen ihre Dollar- oder Euro-Scheine in der Tasche, um sie bei Gelegenheit als Zahlungsmittel einzusetzen. Im Seabeco machen sie den Großteil des Publikums aus.
Ich setze mich an die Bar, lege den Mantel auf den Hocker links von mir und bestelle ein Bier. Ich sitze seitlich zum Raum, so dass ich die getönte Glastür im Auge behalten und das Hin und Her der Gäste beobachten kann. Es ist noch früh, gerade mal zehn Uhr, aber in dieser Stadt scheinen ordentliche Menschen um diese Zeit längst zu Hause zu sein. Am Nachtleben nimmt nur teil, wer ein etwas ungeregelteres Leben führt und Devisen in Umlauf bringen kann. Weil Vorstellungen in Theatern, Konzerten und Kinos bereits um sechs – sonntags sogar schon um vier – beginnen, sieht es spätestens gegen neun Uhr so aus, als habe sich die einheimische Bevölkerung in Luft aufgelöst. Straßen und Fußwege, meist unbeleuchtet und dazu voller Unebenheiten und tiefer Löcher, lassen jeden Weg in der Dunkelheit zu einem Slalom zwischen Fußangeln werden. Dazu kommt die ständige Angst, man könnte überfallen und ausgeraubt werden. Wenn es nach Tamara oder Nadja ginge, dürfte ich mich nach Anbruch der Dunkelheit nicht einmal mehr einem Taxi anvertrauen, weil die Fahrer angeblich nur darauf warten, mich, als Frau und obendrein auch noch als Ausländerin, um den Inhalt meiner Handtasche zu bringen. »Und glaub bloß nicht«, warnen sie mich immer wieder, »dass du, falls dir so etwas passiert, irgendeine Art von Hilfe bei der Polizei bekommst. Die protokollieren deinen Fall, und damit hat sich das dann. Die machen höchstens noch gemeinsame Sache mit dem, der dich überfallen hat. Stecken doch alle unter einer Decke.«
Dem Gerücht, Polizisten seien die eigentlichen Verbrecher, bin ich schon öfter begegnet. Insgeheim lache ich darüber. Aber trotzdem kann ich mich der Erkenntnis nicht verschließen, dass sie anscheinend einer anderen Spezies Mensch angehören.
»Sie sind doch nicht böse, wenn ich frage, wo Sie herkommen?«
Ein Mann hat sich auf den Barhocker neben jenem gesetzt, auf dem ich meinen Mantel deponiert habe. Er trägt dunkle Hosen, ein hellblaues Hemd und ein graues Wolljackett. Keine Krawatte. Er hat schwarze Locken, ein schmales Gesicht und braune Augen. Dem Tonfall nach zu schließen ist er Österreicher. Ich schätze ihn auf Ende zwanzig. Einen Moment überlege ich, dann sage ich: »Deutschland.«
»Habe ich mir gedacht. Ich meine, dass Sie Ausländerin sind.« Er lächelt. »Und was hat Sie ausgerechnet in diese Stadt verschlagen?«
»Ich arbeite hier. Und Sie?«
»Ich bin Journalist. Man hat mich hergeschickt, damit ich einen Bericht über diesen Weinkeller schreibe. Sie haben vielleicht von ihm gehört.«
Ich nicke. Ich habe von ihm gehört. Genauer gesagt, wir waren dort, Wolf und ich. Letzte Woche. Ich habe nicht vor, ihm das zu erzählen. Vermutlich weiß er, dass normal Sterbliche nicht ohne weiteres Zugang haben. Man braucht Beziehungen. Oder zumindest ein offizielles Empfehlungsschreiben.
»Wer hat Sie hergeschickt?«
Er nennt den Namen einer Fachzeitschrift, den ich sofort wieder vergesse. Die Redaktion sitzt in Wien.
»Aha.« Es ist nicht das erste Mal, dass ich denke, Österreicher sind irgendwie neugieriger auf andere Länder als wir. Und eine Spur besser informiert.
»Allerdings muss ich erst noch herausfinden, wo er eigentlich ist.« Wenn er lacht, sieht er aus wie ein großer netter Junge, der sich auf ein Pfadfinderspiel freut.
»Wie viel Zeit hat man Ihnen dazu gegeben?«
»Zwei Tage. Aber ich bin gerade erst mit der Nachmittagsmaschine angekommen.«
Als er sein Bierglas zum Mund führt, fällt mir auf, dass er lange Finger und schmale Handgelenke hat.
»Ist es schwer, hier zu leben?«, fragt er.
»Anders.«
Seinem Gesicht sehe ich an, dass er damit nicht viel anfangen kann. »Vor allem, weil man sich daran gewöhnen muss, dass alles etwas länger braucht. Das kann manchmal ziemlich frustrierend sein. Man muss warten lernen.«
»Verstehe.«
»Das heißt«, schiebe ich trotzdem nach, »wahrscheinlich wäre es besser, wenn Sie sich darauf einstellen würden, dass Sie vielleicht etwas mehr als zwei Tage hier bleiben müssen.«
Das geht gegen seine Pfadfinderehre, aber er grinst freundlich. »Mal sehen.«
Ob er mir noch ein Bier bestellen darf, will er wissen. Ich werfe einen Blick zu der getönten Glastür hinüber, hinter der sich nicht viel zu tun scheint, beschließe, dass ich noch Zeit habe, und frage ihn, ob er etwas dagegen hat, wenn ich auf Kognak umsteige. Nachdem er bestellt hat, erzählt er mir, dass er im Cosmos abgestiegen ist. »Dieser riesige Bau, über zwanzig Stockwerke … Können Sie sich erklären, wozu man in einer Stadt, in der es keinen Tourismus gibt, so große Hotels braucht? Wer mietet sich da wohl ein?« Sein weicher Wiener Dialekt klingt mir angenehm im Ohr. Aber was das Cosmos angeht, muss ich passen. Vermutlich ist es einmal für irgendwelche Parteibonzen konzipiert worden, und nun wartet es wieder auf bessere Zeiten.
»Geschäftsleute«, sage ich, »Handeltreibende aus der Ukraine oder Weißrussland vielleicht, die noch nicht das ganz große Geld machen, um im Codru oder Dacia oder sogar hier, im Seabeco, zu logieren.«
Er nickt. Und nun will er natürlich auch wissen, welche Art von Arbeit mich hierher gelockt hat.
»Ganz einfach«, setze ich an, aber weil ich im selben Moment sehe, wie mehrere Herren hinter der Glastür verschwinden, stocke ich. Er folgt meinem Blick.
»Was ist das dort drüben?«
»Ein Casino.«
»Ach so. Seltsam.«
»Wieso?«
»Na ja, weil es hier offenbar an jeder Ecke ein Casino gibt. Jedes größere Hotel scheint ein eigenes zu haben.«
Nicht schlecht, denke ich. Zumindest dafür, dass er noch keinen halben Tag hier ist. Dieser Pfadfinder macht die Augen hübsch weit auf.
»Sind das richtige Casinos?«, fragt er. »Ich meine, wie bei uns? Roulette, Blackjack und so?«
»Schon. Spielen Sie?«
Er kneift die Augen zusammen. »Selten. Das heißt, zu Hause eigentlich nie. Aber«, er rutscht sich auf seinem Hocker zurecht, »ich würde es mir gern ansehen. Gibt es denn tatsächlich Leute, die dafür Geld haben?«
»Und ob.«
Er nippt an seinem Bier, schaut wieder zur Glastür hinüber, gibt sich schließlich einen Ruck. »Verzeihen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Pacher, Rudolf. Rudi Pacher.«
»Pia Ritter.«
Einen Moment zögert er noch. Dann fragt er endlich: »Haben Sie nicht Lust, mal mit mir da reinzuschauen?«